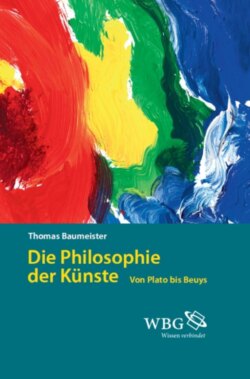Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
PLATO: KUNST UND POLITIK2 1. Einleitende Bemerkungen
ОглавлениеPlatos Symposion gipfelt in einem Bild von großer Eindringlichkeit: dem Bild des einsam in der Morgendämmerung wachenden Sokrates. Das Gespräch über die Liebe, bei dem die Gäste einander ihre Ansicht der Sache vortrugen, sah sich plötzlich durch die Ankunft des Alkibiades unterbrochen, der spät am Abend, mit viel Hallo und in Begleitung von Musikern und Tänzerinnen, unerwartet die Gesprächsrunde aus ihren Betrachtungen herausriss. Nach der Rede des Alkibiades über den Eros, die zugleich eine Art Liebeserklärung an Sokrates ist, begann, so wird berichtet, ein heftiges Gelage. Nun, gegen Morgen ist es schließlich still geworden. Die meisten Gäste sind fortgegangen, andere hat die Trunkenheit überwältigt. Nur Sokrates ist unermüdlich ins Gespräch vertieft. Der Mengen genossenen Weines ungeachtet, ist er nüchtern geblieben. Seinen beiden mit dem Schlaf kämpfenden Gesprächspartnern, dem Tragödiendichter Agathon und dem Komödiendichter Aristophanes, versucht er klar zu machen, dass der wahre Komödienschreiber imstande sein muss, Tragödien zu schreiben und umgekehrt. Mit dieser recht rätselhaften Bemerkung endet das Gespräch, denn auch die beiden Dichter hat inzwischen der Schlaf übermannt. Nur Sokrates ist wach geblieben: Einsam und nüchtern, im heraufdämmernden Morgen tief in Gedanken versunken, so meint ihn der Leser vor sich zu sehen.
Szenen von großem poetischem Reiz und mythisch-dichterische Abschweifungen, die eine geradezu musikalische Stimmung atmen, findet man in zahlreichen platonischen Dialogen. Ebenso auffallend wie dieser poetische Ton ist Platos Vermögen, die menschliche Tragweite der jeweiligen philosophischen Auseinandersetzung mit dramaturgischen Mitteln zu verdeutlichen. Buch 1 der Politeia und der Dialog Gorgias etwa sind alles andere als lediglich nüchterne theoretische Abhandlungen zum Verhältnis von Recht und Macht. Sie machen vielmehr auch den persönlichen Bezug der Beteiligten zu diesem Thema sichtbar. So wird etwa gezeigt, wie ein Gespräch entarten und eine gewalttätige Wendung nehmen kann, wenn die Gesprächspartner sich um Argumente verlegen sehen. In der Politeia ist es Thrasymachos, der stets gereizter und unwilliger wird und sich schließlich dem Gespräch entziehen möchte, als er sich von Sokrates in die Enge getrieben sieht.3 Ein anderes sprechendes Beispiel für die literarische Kunst Platos ist der Beginn des Protagoras. Hier wird dem Leser im Stile der Komödie aufs Anschaulichste gezeigt, wie sehr die intellektuelle Jugend Athens durch die Sophisten verzaubert wurde. Sokrates wird nämlich bereits zu nachtschlafender Zeit von einem über alle Maßen aufgeregten Hippokrates, der ihm die Ankunft des berühmten Protagoras verkünden will, mit stürmischen Schlägen an die Haustür geweckt. So sehr ist der junge Mann von diesem Ereignis aufgewühlt, dass er noch nicht einmal den Sonnenaufgang abwarten kann.4
Somit zeichnen sich zahlreiche platonische Dialoge durch dichterischen Sinn für das sprechende Detail und für die vielsagende dramatische Konstellation aus. Es ist hier nicht unsere Absicht, auf diese Beispiele näher einzugehen. Sie können jedenfalls bereits deutlich machen, dass die platonischen Dialoge keine mehr oder weniger unterhaltend kostümierten philosophischen Abhandlungen sind. Sie stellen vielmehr ein eigenes literarisches Genre dar. Es sind literarische, poetisch-philosophische Kunstwerke, bei denen die Dramaturgie, die Dialogregie und die mise en scène nicht weniger wichtig sind als die Argumente oder Scheinargumente, die von den Unterrednern ins Feld geführt werden.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass derselbe Sokrates, dessen Bild von Plato mit so viel dichterischer Kunst beschworen wird, die überlieferte Dichtkunst schonungslos kritisiert, und hierbei auch die Meinung Platos selbst zum Ausdruck zu bringen scheint. Wir vernehmen mit Verwunderung, dass die großen klassischen Werke der Dichtkunst, vor allem die homerischen Epen, in nur stark gereinigter Form im ‚Staat der Zukunft‘ zugelassen werden dürfen, wie Sokrates anhand einer Fülle von Beispielen auseinandersetzt. Da ihre Kunst als verderblich zu betrachten sei, müssten die Tragödien- und Komödiendichter, also auch die beiden Dichter aus dem Symposion, ebenso wie das Schauspiel, aus der Polis verbannt werden. Nur Preisgesänge auf moralisch untadelige Menschen seien zugelassen. Tragödien und Komödien dagegen hätten im Staat nichts zu suchen.
Wie ist diese erstaunliche Kritik, die an die repressive Kunstpolitik von Theokratien und totalitären Staaten denken lässt, zu verstehen? In welchem Zusammenhang muss dieser Angriff auf die mimetischen, die mimischen und die nachbildenden Künste gesehen werden? Geht es hier bereits um Kunsttheorie im modernen Sinne, etwa um den Ansatz einer imitation theory of art; oder sind nicht vielmehr ganz andere Zielsetzungen bestimmend?
Folgende Themen lassen sich in diesem Zusammenhang unterscheiden.
– Platos Auseinandersetzung mit der Sophistik und den Sophisten, die nahezu sein gesamtes Werk durchzieht.
– Hiermit verbunden ist das Thema des Scheins (pseudos) und der trügenden Erscheinung; des Scheins im Gegensatz zur Wahrheit, des Scheins der Redekunst und der Dichtkunst, demgegenüber Sokrates den verantwortlichen Gebrauch des logos verteidigt, die Kunst des Gesprächs, die Dialektik.
– Drittens ist die Frage nach dem Wesen der Schönheit und des Eros zu nennen, der sich, nach sokratischer Überzeugung, durch das Schöne angezogen fühlt und nach dem Schönen strebt (Phaidros, Symposion). Ausgehend von der für die Griechen so wichtigen ‚physischen Schönheit‘ verteidigt Sokrates eine verinnerlichte und ethische Auffassung vom Schönen (Hippias major, Symposion, Politeia).
– Schließlich geht es um das Wesen der Tätigkeit des Rhapsoden, des Vortragskünstlers. Handelt es sich hier um Kunst (technè) im echten Sinne, die auf wirklichem Wissen beruht? Oder verdankt sie sich einem unkontrollierbaren Gefühl oder gar göttlicher Inspiration?
Soweit die hauptsächlichen Gesichtspunkte in den platonisch-sokratischen Äußerungen zu den Künsten, von denen hier vornehmlich die ersten drei behandelt werden sollen. Die Darstellung von Platos Bild der Dichtkunst und seiner Kritik an den mimetischen Künsten in der Politeia wird den Anfang machen. Es folgt, anhand des Dialogs Hippias Major und des Symposion, eine Skizze der gesellschaftlich-kulturellen und politischen Hintergründe der platonischen Auseinandersetzung mit den Künsten. Platos eigenes Verständnis des eigentlichen Kunstwerks, der wahren Tragödie, beschließt diese Darlegungen, gefolgt von einem kurzen Ausblick auf die Nachgeschichte des platonisch-sokratischen Argwohns gegenüber der Kunst.