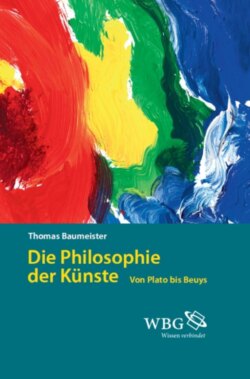Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Bemerkungen zur Deutung
ОглавлениеWie muss dieser Angriff auf die Dichtkunst beurteilt werden, in dem Plausibles mit anscheinend sarkastischen Übertreibungen einhergeht? Ist es wirklich Platos Überzeugung, dass die Dichter und die mimetischen Künstler uns keinerlei Einsicht in die Natur der Dinge verschaffen? Dass sie an gediegener Kenntnis von jedem gestandenen Handwerker übertroffen werden? Ist es die Aufgabe der Dichter, auf allen Gebieten sachverständig zu sein und die Menschen sittlich zu verbessern? Derartige Annahmen und Forderungen sind alles andere als selbstverständlich und bedürfen der Erklärung.
Dass für die Werke der Dichter, zumal diejenigen Homers, eine erzieherische Wirkung beansprucht wurde, lässt sich relativ leicht einsichtig machen. So wie die Bibel immer mehr war als nur ein literarisches Kunstwerk oder eine Sammlung von Märchen, so wurden offenbar auch die Werke Homers als ein Schatz an Weltkenntnis, von Lebensweisheiten, von religiösen Wahrheiten und ethischen Richtlinien angesehen. Nach allgemeiner Meinung haben die Griechen Hesiod und Homer ihre Götter zu verdanken, indem jene die mythischen und religiösen Vorstellungen zu einem mehr oder weniger systematischen Ganzen zusammenfassten.11 Ebenso wie die Bibel waren auch die alten Dichtwerke der Griechen eine das Bewusstsein bildende und je nach den Umständen auch verbildende Macht. Eine verbildende Macht, da die in der Ilias propagierten alten Helden- und Herrschertugenden – Tapferkeit mit Grausamkeit und Rachsucht, Stolz mit unversöhnlicher Egozentrik verbunden – Haltungen sind, die in der politischen Kultur der Polis, die immer wieder von Krisen erschüttert wurde, eher als Untugenden anzusehen sind. In dem Athen von Sokrates und Plato sind offenbar andere Fertigkeiten erforderlich als in einer archaischen Kriegerkultur: Versöhnungsbereitschaft, das Vermögen zu verhandeln und vor allem der Wille, dem Wohl und der Erhaltung des Ganzen den Vorrang vor der Befriedigung persönlichen Ehrgeizes und materieller Interessen zu geben.
Von hier aus gesehen fällt auch Licht auf die ausführliche Breite von Sokrates’ Homerkritik. Vieles weist darauf hin, dass die Homerzitate und die detaillierten Ausführungen hierzu vor allem die Funktion eines Spiegels hatten, in dem die Missstände der Gegenwart sichtbar gemacht werden sollten: Nepotismus, Grausamkeit, übertriebene Sucht nach Anerkennung, Untugenden nicht nur der Vornehmen und Mächtigen unter den wegen ihres Dünkels berüchtigten Athenern, sondern auch des Demos, dessen Ambitionen die Stabilität der athenischen Polis zu untergraben drohten. Ehrgeiz, wie wichtig er auch immer für einen Politiker ist, kann, wenn das Maß verloren geht, zu einer für den Zusammenhalt der Polis bedrohlichsten Kräfte werden. Bei Homer wird diese Tugend oder Untugend vornehmlich durch Agamemnon und Achilleus verkörpert. Unter den Zeitgenossen des Sokrates ist es vor allem Alkibiades, der aufsehenerregende späte Gast im Symposion, der diese Haltung in ihren anziehenden und verderblichen Aspekten repräsentiert. Die Kritik an Homer in der Politeia ist also schwerlich ein Produkt philosophischer Weltfremdheit, wie man denken könnte. Vieles spricht dafür, dass sie auch als Kritik der politischen Verhältnisse der Zeit zu lesen ist und auf sehr reale Bedrohungen der Existenz der athenischen Polis Bezug nimmt.
Ähnliches scheint auch für Sokrates’ Kritik an der Tragödie zu gelten. Die Warnung vor den Gefahren, die von der Tragödie ausgehen, kann, auch im Lichte der damaligen Zeit, zunächst sehr übertrieben wirken. Sollten Theaterstücke tatsächlich die Charakterfestigkeit der Bürger untergraben? Zwar kann man sich an dieser Stelle der extremen Ausdrucksmittel erinnern, die der attischen Tragödie zu Gebote standen. Man denke zum Beispiel an die Schreiexzesse der Kassandra im zweiten Teil der Oresteia des Aischylos, an die Wehklagen des Philoktet, an die Klagen des Chors, die durch die Akustik der griechischen Theater auf aufwühlende Weise verstärkt wurden.12 Es sind diese Äußerungen affektiver Hochspannung, die das Publikum ohne Zweifel in ihren Bann schlugen und es bezauberten. Ob dieser Verlust an Selbstbesinnung jedoch so tief greifend war, wie von Sokrates suggeriert wird, mag man bezweifeln. So liegt auch hier wieder der Gedanke nahe, dass die Kritik an der Tragödie seiner Zeit auch auf Entartungserscheinungen der politischen Welt zielt. Das tragische Kunstwerk ist eines ihrer Verfallssymptome.
Anders als heute war im Athen des Sokrates die Aufführung von Theaterstücken ein Ereignis von großem öffentlichem und politischem Belang, die von reichen Bürgern und Politikern finanziert wurden. Vor allem jedoch – und dies ist nicht weniger wichtig – begann die politische Welt, die von rhetorisch begabten Menschen beherrscht wurde, selbst einem Theaterstück zu ähneln. Nicht anders als bei der Tragödie ging es darum, die Emotionen der Zuschauer und Zuhörer zu mobilisieren, um so die nüchterne Überlegung zu erschweren oder gar zu verhindern. Man erinnere sich etwa an die von Thukydides geschilderte fieberhafte Erregung der Athener, die die Vorbereitung des sizilianischen Feldzugs begleitete und die von Alkibiades angestachelt wurde.13 Plato und Sokrates sind solcher Emotionalisierung des Publikums mit Misstrauen begegnet. Wer von heftiger Erregung beherrscht wird, läuft Gefahr, sich selbst und das Gefühl für Maß und Proportion zu verlieren.
Die Tragödie, wie sie in der Politeia gesehen wird, kultiviert diesen Aufruhr der Leidenschaften so wie 2400 Jahre später die Musikdramen Richard Wagners auf narkotisierende Weise mit den Emotionen des Zuhörers spielen.14 Sokrates’ Darlegungen zufolge lenke das tragische Kunstwerk (und die die Leidenschaften aufpeitschende Rhetorik) von den wirklichen Schrecknissen des menschlichen Lebens ab: Nicht Macht und Reichtum als solche sind das wirklich Erstrebenswerte. Nicht das Unglück, das den Menschen von außen überfällt, ist das wahrhaft zu Fürchtende. Vielmehr ist die Unordnung einer ungerechten und disharmonischen Seele das Größte aller Übel, sowohl für den Einzelnen als auch für die politische Gemeinschaft. Ungleich ärger als Unglück zu erleiden, sei es, ungerecht zu sein und Unschuldige ins Unglück zu stürzen. Die Entfesselung der Emotionen trübe den Blick. Anstatt sich in fremdem Leiden zu verlieren, solle der Zuschauer sich seiner eigentlichen Lebensaufgabe erinnern: ein gerechtes und durch die Vernunft geordnetes Leben zu führen.
Sokrates wirft den mimetischen Künsten vor, eine bloße Abspiegelung des Bestehenden zu sein, eine Kritik, die auf dem hier umrissenen politisch-moralischen Hintergrund an Plausibilität gewinnt. Die Tragödiendichter geben nur ein Spiegelbild der unvollkommenen Wirklichkeit, indem sie Menschen zeigen, die von ihren Leidenschaften hin- und hergeworfen werden. Sie verfehlen hiermit ihr eigentliches Ziel, nämlich das wahrhaft Vornehme und Vortreffliche darzustellen. Und nicht genug damit: Das, was im wirklichen Leben verworfen zu werden verdient, umgeben die Dichter mit einer verführerischen ästhetischen Aura.