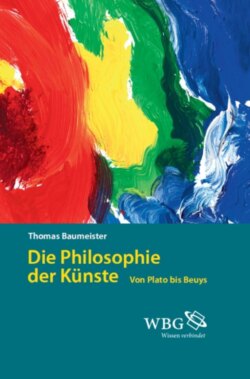Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Mimesis und Dichtkunst 2.1 Mimesis
ОглавлениеIm 4. Kapitel der Poetik führt Aristoteles zwei Ursachen der Dichtkunst an: die den Menschen auszeichnende Freude an der Nachahmung und die Empfänglichkeit für Harmonie und Rhythmus. Der Mensch unterscheidet sich, so Aristoteles, von allen anderen lebenden Wesen sowohl durch sein Talent zum Darstellen als auch durch das Vergnügen, das er an solchen Darstellungen findet. Getreue Abbilder von Dingen, die in der Wirklichkeit Abscheu hervorrufen, betrachten wir, so Aristoteles, nicht ohne Vergnügen, d.h. nicht ohne Interesse. „Die Ursache hiervon“, so fährt er fort, „[ist,] dass das Lernen (mathesis) nicht nur dem Philosophen besonders angenehm ist, sondern auch allen anderen Menschen, sei es auch in etwas geringerem Maße.“ Es scheint somit vor allem das Erkennen des Abgebildeten zu sein, das mit Vergnügen verbunden ist. Dass das Abbilden mit Lernen – man lernt, wie etwas aussieht – und dem Erwerb von Kenntnissen zu tun hat, mag in unserer Kultur, die uns mit Bildern überflutet, nicht ohne Weiteres einleuchten (allerdings kann auch die häufig als abstrakt verschriene neuzeitliche Naturwissenschaft nicht ohne Abbildungen auskommen).38 Auch auf dem Gebiet der Kunst ist das Abbilden, das imitatio naturae-Prinzip, das die Kunsttheorie in Europa lange beherrscht hat, durch Erscheinungen wie die abstrakte Malerei und die Musik in Misskredit geraten. Noch immer kann man der Meinung begegnen, dass die Fotografie die Aufgaben der figurativen Malerei definitiv übernommen habe und dass das eigentliche Wesen der Künste sich erst dann offenbare, wenn sie von abbildenden Elementen gereinigt wären.39 Eine Theorie der Mimesis scheint gegenwärtig, auf den ersten Blick jedenfalls, nicht auf enthusiastischen Empfang hoffen zu können.40
Doch sehen wir genauer hin. Der Begriff der Mimesis hat ursprünglich Bezug auf den Mimen, den mimus, den Darsteller, der mittels mimischer Mittel das Typische von Haltung und Bewegung einer Person oder eines Menschentypus sichtbar zu machen vermag. Jeder weiß, wie es ist, wenn eine mimisch begabte Person einen anderen treffend zu imitieren versteht. Erfolgreiches Darstellen, wie jemand ist, Mimesis, ist somit mehr als lediglich etwas zu wiederholen oder zu kopieren. Vielmehr ist es ein Sichtbarmachen von etwas, dass jeder eigentlich schon kennt, ohne es jedoch jemals richtig wahrgenommen zu haben. Mimesis ist somit eher ein Offenbar-Machen, ein Enthüllen, und keineswegs dem Herumtragen von Spiegeln gleichzusetzen, wie Sokrates die Mimesis (in der Malerei) sarkastisch charakterisieren zu müssen meinte. Ist es Sache der Nachahmung, das Typische und Wesentliche sichtbar zu machen und der diffusen Wirklichkeit zu entreißen, dann impliziert sie Abstraktion und Selektion, die Wahl eines bestimmten Gesichtspunktes und nicht zuletzt ein besonderes Beobachtungstalent. Mimesis lässt uns dasjenige besser erkennen und verstehen, an dem wir sonst achtlos vorbeigehen, und erfüllt somit zweifellos eine kognitive Funktion, die aller Bekenntnisse zu einem missverstandenen Avantgardismus zum Trotz sich als unverzichtbar herausgestellt hat. Mimesis fällt somit keineswegs mit einer naturalistischen Wiedergabe der Wirklichkeit zusammen, sondern kann und muss mit einer gehörigen Dosis Stilisierung einhergehen. Die Aufführungspraxis der Zeit mit Masken und Kothurnen belegt das ebenso wie Aristoteles’ Forderung an die Dichter, das vielfarbige Geschehen auf das Wesentliche eines Handlungsverlaufs zu reduzieren. Übrigens weisen auch die sogenannten ‚nichtfigurativen‘ Künste, wie Musik und abstrakte Malerei, mimetische Elemente auf: Ja, Mimisches, die ausdrucksvolle Gestikulation und Bewegung, kann ihnen in besonderem Maße eignen. Auch Musik, für die sich keine Naturvorbilder namhaft machen lassen, wie die einer bachschen Fuge, ist mimisch; sie exemplifiziert Arten der Bewegung, des Schreitens, des Auseinandertretens, des Zueinanderfindens der Stimmen; sie ist Mimesis eines Nichtexistierenden oder, wenn man so will, nicht so sehr Nachahmung als vielmehr Vorahnung eines Tuns und Bewegens.41 Auch die in der Kunst der Gegenwart geübte Praxis, Kunstwerke, Environments aus Bruchstücken der Dingwelt herzustellen, schließt mimetische Elemente ein. Sie kann Wesentliches einer bestimmten Situation sichtbar machen, wie etwa, um ein Werk des 20. Jahrhunderts zu nennen, das wie hoffnungslos an der Decke aufgehängte Klassenzimmer von Rebecca Horn, mit seinen generationenalten Schulbänken und herabhängenden Schläuchen, aus denen sinister tickend, wie die Minuten einer nicht enden wollenden Schulstunde im Sommer, eine schwarze, an Tinte gemahnende Flüssigkeit tropft.
Häufig wird gegen die Mimesis und die Annahme, dass Kunstwerke kraft ihres Kunstcharakters Wahrheit zum Ausdruck bringen können, Folgendes vorgebracht: „Wäre ein Kunstwerk […] positive Erkenntnisvermittlung, würde ein einmaliges Konstatieren [seines Wahrheitsgehalts] ausreichen.“42 Mimesis, das Kunstwerk als Erkenntnismittel, lasse unerklärt, warum man zum gelungenen Werk immer wieder aufs Neue zurückkehren kann. Eine klassische Antwort auf diesen Einwand lautet: Die Darstellung einer Situation, eines Geschehens kann so exemplarisch, plastisch und wirklichkeitshaltig sein, dass man sich immer wieder mit dem Werk befassen kann. Was ein Schneesturm, eine nächtliche Odyssee bei Eiseskälte und im Schneetreiben in concreto ist, kann einem paradigmatisch an Tolstojs gleichnamiger Erzählung aufgehen. Was eine Entscheidungssituation ist, können einem Die Hiketiden des Aischylos, der Philoktet des Sophokles eindringlichst vor Augen stellen. Was der Verlust eines geliebten Menschen bedeutet, lässt einen Prousts Albertine disparue auf ungeahnte Weise erkennen. Von „positiver Erkenntnisvermittlung“ kann hier sicher gesprochen werden, was übrigens nicht bedeutet, dass die hier „erkannten“ Sachverhalte uns nichts weiter zu denken geben. Allerdings ist richtig, dass nicht alle Kunstwerke uns in diesem Sinne Erkenntnis verschaffen, etwa die freien Spiele der Fantasie. Doch spricht dies nicht gegen die Geltung dieses kognitiven Kunstverständnisses, es begrenzt nur ihren Anwendungsbereich.