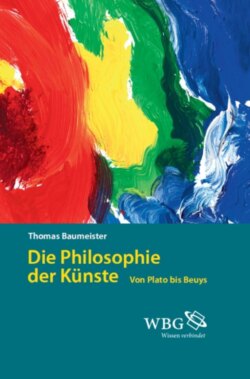Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Sophistik, Politik und Dichtkunst 3.1 Einleitende Bemerkungen
ОглавлениеEingangs wurde auf die Verwandtschaft zwischen der platonisch-sokratischen Kritik an der Dichtkunst und Platos lebenslanger Kritik an den Sophisten hingewiesen. Sowohl von den Dichtern als auch den Sophisten wird behauptet, dass sie Schein produzieren, dass sie vielgestaltig wie Proteus sind und ständig in anderen Verkleidungen auftreten, wie Schauspieler oder wie die homerischen Götter. Was Homer zugeschrieben wurde – er sei auf allen wesentlichen Gebieten des menschlichen Lebens und Tuns sachverständig – das war offenkundig auch der Anspruch der neuen Weisheitslehrer, ein Anspruch, den Sokrates als unbegründet zu entlarven nicht müde wird. Die Polemik gegen die Sophisten ist zweifellos eines der zentralen Motive in den platonischen Dialogen. Plato führt diesen Kampf mit einer Vielfalt von satirischen Mitteln, die von subtiler Ironie bis (etwa im Protagoras und Hippias Major) zu possenhaften Effekten reichen.
Wer jedoch waren die Sophisten und in welcher Situation sind sie aufgetreten?15 Die Sophisten, wörtlich: weise Männer, waren umherreisende Intellektuelle, die gegen Bezahlung – wie der Aristokrat Plato schmähend hervorhebt – über die neuen Entwicklungen in den verschiedensten Wissenszweigen unterrichteten, öffentliche Vorträge abhielten und in gewissem Umfange als wandelnde Enzyklopädien gelten konnten, die über alles Wissenswerte Aufschluss zu geben versprachen. Vor allem haben die Sophisten als Lehrer der Redekunst, der Beredsamkeit und als bezahlte Redner Prestige erworben. Sie galten als Spezialisten für Recht und Gerechtigkeit – so erscheinen sie jedenfalls bei Plato – und des schönen und verführerischen Wortgebrauchs. Die athenische Demokratie, die Teilnahme der Bürger an der politischen Entscheidungsfindung, musste begreiflicherweise eine Nachfrage nach Sachverständigen auf dem Gebiet der Redekunst entstehen lassen. Die große Attraktivität der Sophisten vor allem für die jüngeren Bürger von Athen kann vor diesem Hintergrund nur allzu verständlich werden.
Der vom platonischen Sokrates häufig vorgebrachte Vorwurf, die Sophisten verfügten nur über Scheinkenntnis, ist gewiss eine satirische Übertreibung, wie auch das vornehmlich negative Bild, das Plato von diesen neuen Weisheitslehrern entwirft, zweifellos polemisch verzeichnet ist. Will man Plato Glauben schenken, dann gaben die Sophisten vor, alles beweisen und auch einer schlechten Sache den Schein von Wahrheit und Gültigkeit verleihen zu können. Der platonische Sokrates wird daher nicht müde, daran zu erinnern, dass die Kunst der ‚schönen Rede‘ ohne wirkliche Kenntnis dessen, was gut und gerecht ist, ein gefährliches Instrument ist, das die politische Ordnung in ihren Fundamenten bedroht. Doch wäre es verkehrt, in den Sophisten nur zynische Demagogen und Advokaten eines prinzipienlosen Opportunismus sehen zu wollen. Der von Protagoras und anderen gelehrte Subjektivismus und Relativismus, ihr Angriff auf die Annahme allgemeingültiger Wahrheiten, war sicher eine ernst zu nehmende philosophische Herausforderung.
Gegen die Bedrohungen des sophistischen Relativismus präsentiert Plato in seinen Dialogen Sokrates als die kritische Gegenkraft. Hierbei spielte sicher auch das Streben eine Rolle, den verehrten Lehrer gegen den Vorwurf zu verteidigen, selbst ein Sophist und Verführer der Jugend gewesen zu sein. Zwar bedient sich der platonische Sokrates nicht selten der Waffen seiner Gegner. Er verleitet seine meistens jungen Gesprächspartner mit Scheinargumenten und rhetorischen Fragen zu Zugeständnissen, die den wahren Sachverhalt verzeichnen. Doch hat diese sokratische Taktik gewiss nicht primär den Sinn, die rhetorische oder intellektuelle Superiorität des Sokrates zu demonstrieren. Zwar gibt es Dialoge eher didaktischen Zuschnitts, in denen es um die Prüfung der argumentativen und logischen Fähigkeiten seiner Gesprächspartner geht. Doch ist es oftmals auch – H.-G. Gadamer hat darauf hingewiesen – um die Prüfung der charakterlichen Standfestigkeit der Gesprächsteilnehmer und um die Tiefe der jeweils verteidigten Überzeugungen zu tun. Wer sich allzu schnell durch Scheinargumente in die Enge treiben lässt, verrät, dass er nicht wirklich hinter der von ihm verteidigten Sache steht und das Gespräch möglicherweise nur als Spiel auffasst, bei dem es nur darum geht, den Gegner in die Enge zu treiben und ihm eine Niederlage beizubringen. Sokrates bildet das Gegenbild zu dieser spielerischen Haltung. Hinter seiner freundschaftlich gefärbten Ironie verkörpert er einen neuen Ernst und eine neue Form von Tapferkeit, die sich auf nichts anderes gründet als auf die Einsicht in die Idee des Guten, die Plato zufolge ebenso unbezweifelbar ist wie die mathematische Erkenntnis. Sokrates verkörpert den Gegenpol zu einer übermäßig sinnlich-ästhetischen Kultur, in der physische Schönheit ebenso wichtig war wie Beredsamkeit, geistreicher Witz und das Talent, Menschen vermittels der logoi zu betören. Der athenischen Verliebtheit in den Schein steht eine neue verinnerlichte Auffassung von Schönheit gegenüber, die sich in Sokrates’ Leben und Sterben manifestiert.
Das eingangs erwähnte Symposion bringt diesen Gegensatz als Kontrast zwischen Sokrates und Alkibiades auf besonders lebendige Weise zum Ausdruck. Auf der einen Seite, der junge, schöne, reiche und ehrgeizige Politiker, der bekennt, dass er Sokrates schon länger nicht unter die Augen zu kommen wage, da dieser sein Buhlen um die Gunst der Menge missbillige. Auf der anderen Seite Sokrates mit dem Aussehen eines Satyrs, dessen innere Schönheit und dessen Tapferkeit in der Schlacht von Potidaia von Alkibiades in allen Tonarten gepriesen werden. Ernst und Scherz verbinden sich in diesem Dialog, ein Ernst, der sich nur dem ganz erschließt, der weiß, dass der Dialog kurz vor dem sizilianischen Abenteuer stattfindet, das für Athen in einer Katastrophe enden wird. Alkibiades war die treibende Kraft hinter dieser riskanten Politik, die der Überlieferung nach von Sokrates nicht gebilligt wurde. So zeigt sich wie in der Politeia auch hier, dass „Schönheit“ für Plato höchst aktuelle politische und ethische Implikationen hat.16