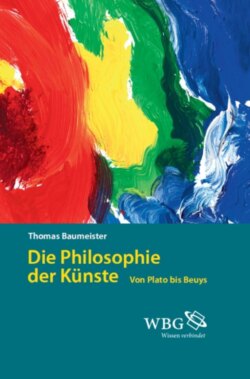Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Abschließende Bemerkungen
ОглавлениеDie Kunstform der Tragödie entstand in einer Gesellschaft, deren politische Strukturen die Teilnahme der Bürger an der politischen Entscheidungsfindung erforderlich machten. Die Tragödie, jedenfalls das Bild, das Aristoteles von ihr zeichnet, stellt vor allem den Menschen in den Mittelpunkt. Über die mythischen und religiösen Aspekte der Tragödie, die bei der modernen Deutung der Tragödie im Vordergrund stehen, hüllt er sich in Stillschweigen. Nicht die Arglist, der Neid der Götter oder das Schicksal werden von Aristoteles als Ursache der tragischen Verstrickung angegeben, sondern der Mensch selbst und sein Handeln in seiner inhärenten Fehlbarkeit.
Im Denken des späten Altertums spielt die Tragödie, jedenfalls in ihrer klassischen Form, keine Rolle mehr. Dies verwundert nicht, da mit dem Römischen Weltreich und seinem enormen juristischen, militärischen administrativen Apparat das individuelle Handeln in seinem Gewicht begrenzt wurde. Die philosophischen Ethiken der Zeit weisen einen mehr oder weniger privaten Charakter auf. Ein stoischer oder epikureischer Rückzug aus der Welt der öffentlichen Angelegenheiten wird vor allem empfohlen. Die tragischen Aspekte des Handelns sehen sich somit in den Hintergrund gedrängt. In den Werken Senecas erhält die Tragödie die Aufgabe, die Verderblichkeit der Leidenschaften darzustellen und die unerschütterliche stoische Seelenruhe im Sturm von Leidenschaften und Leiden mit drastischen Mitteln zu demonstrieren.58
Bei Plotin und im Christentum tritt schließlich die Sorge um das eigene Seelenheil in den Mittelpunkt. Eine Tragödie klassischen Stils kann das Christentum nicht kennen, denn es stellt nicht das menschliche Handeln in das Zentrum, sondern das gläubige Verhältnis des Einzelnen zu Gott, das ihm durch Gottes Gnadentat zuteil wird. Die Heilsgeschichte wird das eigentliche Drama. Im Vergleich hiermit und im Vergleich mit dem Verlust der ewigen Seligkeit ist jedes weltliche Unglück nur von untergeordneter Bedeutung, oder nur eine der Leitersprossen, die den Menschen zur Erlösung hinaufzuführen vermögen.
37 Aristoteles, 384–322 v. Chr.
38 Man denke nur an die Astronomie oder die fotografische Erforschung des Mikrobereichs.
39 J. C. Jensen, Caspar David Friedrich, Köln 1974, 238. Siehe auch C. Greenbergs Bild von der Entwicklung der modernen Malerei.
40 Auch innerhalb des dekonstruktivistischen Denkens ist die Mimesis in Verruf gekommen. Gilles Deleuze sprach von der Diktatur der Repräsentation, von der Diktatur der Kategorien Ähnlichkeit, Selbigkeit, Abbild und Urbild. Es sei unmöglich geworden, von der einen und einzigen Wirklichkeit zu sprechen. Hiermit aber verlieren auch die Begriffe der Mimesis, insofern sie Wirkliches zu fassen versuchen, der adaequatio, der Wahrheit usw. ihre Geltung. Dasselbe Los ist in dieser Optik den Begriffen des Wesens und des Wesentlichen beschieden. Dass ein Kunstwerk, ein Foto etwas Wesentliches sichtbar macht, etwas Typisches getroffen hat, ist in den Augen mancher Theoretiker bereits eine Annahme von eklatanter Naivität. Angesichts dieser Einschätzung ist daran zu erinnern, dass die Tatsache, dass die Wirklichkeit von verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden kann, noch nicht besagt, dass es nicht doch ein und dieselbe Wirklichkeit ist, die wir unter verschiedenen Aspekten beschreiben. Ähnliches gilt auch für die Begriffe ähnlich, typisch und wesentlich. Etwas ist typisch, wesentlich oder ähnelt etwas anderem stets in einer bestimmten Beziehung, die man im Prinzip spezifizieren kann. Dass diese Beschaffenheiten keine absoluten Eigenschaften angeben und nur in Beziehung auf einen Kontext in Erscheinung treten, ja, dass der Beurteilende zu ihrer Erfassung über ein reiches Arsenal an Fertigkeiten verfügen muss, untergräbt nicht notwendigerweise ihre objektive Geltung. Trotz zahlreicher postmoderner Bedenken fahren wir fort, das Sprachspiel zu spielen, in dem wir sagen, dass das Wesentliche, das Charakteristische einer Person überzeugend getroffen sei und dass jemand das Charakteristische sichtbar zu machen wusste. Das dekonstruktivistische Denken lässt in mancher Beziehung an den philosophischen Idealismus und den Skeptizismus denken, deren Argumente man gewiss ernst nehmen muss, die jedoch für unser natürliches Selbstverständnis und Weltverständnis eigentümlich folgenlos bleiben. Doch wird man auch anerkennen, dass im auch die Künstler beschäftigenden Zweifel an Abbildbarkeit der Wirklichkeit bestimmte Seiten der heutigen Medienwelt zum Ausdruck kommen, die Bilder konstruieren, für die keine Originale mehr namhaft zu machen sind.
41 Siehe auch T. Baumeister, Muziek en betekenis, in ANTW 4, 1991, 294–308.
42 R. Sonderegger, Wie Kunst (auch) mit der Wahrheit spielen kann, in Falsche Gegensätze, hrsg. von A. Kern und R. Sonderegger, Frankfurt am Main 2002, 231. Zum Begriff der ‚ästhetischen Erfahrung‘ siehe auch das letzte Kapitel des vorliegenden Buches.
43 K. von Fritz, Entstehung und Inhalt des Neunten Kapitels von Aristoteles’ Poetik, in derselbe: Antike und moderne Tragödie, Berlin 1962.
44 Zum Begriff des ‚Wahrscheinlichen‘ vgl. Jauss’ einschlägige Studie in Nachahmung und Illusion, hrsg. von H. R. Jauss, München 1964.
45 Aristoteles, op. cit., 25.
46 Hier ist nur vom Film, nicht von der Romanvorlage die Rede.
47 Siehe auch: A. B. Neschke, Die ‚Poetik‘ des Aristoteles: Textstruktur und Textbedeutung, Frankfurt am Main 1975.
48 Aristoteles, Die Poetik, op. cit., Kap. 6, 19.
49 Aristoteles, op. cit., Kapitel 7, 25.
50 Allerdings konzediert Aristoteles, dass man das Zufällige oder Unwahrscheinliche, das nicht aus der Logik der Handlung folgt, in der Tragödie nicht immer vermeiden könne. Doch solle man es besser verbergen, es etwa in die nicht gezeigte Vorgeschichte des Dramas verlegen, wie dies in Sophokles’ König Ödipus der Fall sei.
51 P. Szondi, Tragik des Oedipus, in derselbe, Versuch über das Tragische, Frankfurt 1961.
52 Siehe zum Folgenden K. von Fritz, op. cit. Auch J. M. Bremer, Hamartia. Tragic Error in the Poetics of Aristotle and in Greek Tragedy, Amsterdam 1969.
53 Aristoteles, Politik, 1339 a, 11–Schluss.
54 Aristoteles, Politik, 1342 a. Nach der Übers. von Franz Susemihl bearbeitet, mit Nummerierungen, Gliederungen und Anm. versehen von N. Tsouyopolous und E. Grassi, Hamburg 1965.
55 Wolfgang Schadewald war einer der wichtigsten Vertreter der therapeutischen Lesart.
56 Diese Überlegungen zur Katharsis haben vom Gedankenaustausch mit J. Kulenkampff über Passagen von dessen Erlanger Ästhetik-Vorlesung 2011 profitiert, dessen Lesart sich allerdings von der hier präsentierten unterscheidet: Die Tragödie erwecke – so Kulenkampff – diese Emotionen und bringe sie schließlich in ihrer aktuellen Heftigkeit durch Lösung des Handlungsknotens zum Erlöschen.
57 Gadamer hat diesen Gemütszustand als ‚Wehmut‘ bezeichnet, d.h. als Gefühl eines Verlustes, den wir doch hinnehmen müssen. „Die Zustimmung der tragischen Wehmut gilt nicht dem tragischen Verlauf als solchem […] sondern meint eine metaphysische Seinsordnung, die für alle gilt. Das ‚so ist es‘ ist eine Art Selbsterkenntnis des Zuschauers, der von den Verblendungen, in denen er, wie ein jeder, lebt, einsichtig zurückkommt“. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1965, 126.
58 Zur stoischen Tragödie K. von Fritz, Tragische Schuld und poetische Gerechtigkeit, in Antike und Moderne Tragödie, Berlin 1962.