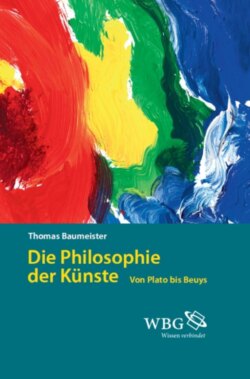Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3 Die Kunst
ОглавлениеWerfen wir abschließend noch einen Blick auf Plotins Theorie der Kunst, der techné und der poeisis und des künstlerischen Schaffens. Von einer Theorie der schönen Künste im modernen Sinne kann allerdings bei Plotin kaum die Rede sein. Denn Plotins Betrachtungen zur Kunst sind keineswegs Zweck an sich, sie haben vielmehr die Aufgabe, eine metaphysische Struktur zu verdeutlichen, das Verhältnis alles Wirklichen (und des Ganzen der Wirklichkeit) zur auf dem Einen beruhenden Idee, die den Bauplan jeglichen Seienden in sich birgt. Das Artefakt, das Werk der schönen Kunst und seine Verfertigung sind im Rahmen dieser Themenstellung vor allem Beispiele, an denen ein Sachverhalt sehr viel allgemeinerer Art verdeutlicht werden soll (Plotin, Enn., V, 8.1).
Plotin geht in diesem Zusammenhang von dem Vergleich zweier steinerner Massen aus. Während die eine ‚formlos‘ und ungestalt ist, ist die andere zu dem Bilde eines Gottes oder eines schönen Menschen umgestaltet.82 Worauf beruht nun die Schönheit des geformten Steins? In seiner Materialität, seinem Steinsein kann die Schönheit nicht liegen, meint Plotin, denn sonst müsste ja auch der ungeformte Stein schön genannt werden. Es sind daher ausschließlich Form und Gestalt, denen das Werk seine Schönheit zu verdanken hat. Diese Gestalt, so erfahren wir, existierte bereits in der Seele des Künstlers und zwar nicht, insofern er Augen hat und Hände, sondern insofern er an der Kunst, der techné, teilhat, d.h., insofern die Idee des Werkes in ihm war. Techné wird hier im Sinne des Aristoteles als eine Form des Wissens, der Erkenntnis verstanden und nicht etwa nur als manuelle Geschicklichkeit, als Treffsicherheit von Hand und Auge. Und Plotin fährt fort:
„In der Kunst [der Einsicht in die Idee] war Schönheit also in höherem Maße anwesend; denn nicht das Urbild (eidos), das in der Kunst ist, ging in den Stein über, sie bleibt vielmehr in der Kunst. Und von ihr ging eine andere Idee aus, die geringer war. Und auch diese blieb nicht rein in ihm (wie die Kunst es fordert), sondern nur insofern als der Stein der Kunst [der Idee] gehorcht.“ (Plotin, Enn., 8; 1–3)
Jedem Herstellen, jeder poiesis liegt also die techné zugrunde, der Bezug auf eine Idee, ein Urbild, das der Künstler nachzubilden habe. Diese Idee erleidet jedoch, Plotin zufolge, in dem Maß, in dem sie sich konkretisiert, eine mehrfache Degradierung. Zum einen gehe von der Idee des Schönen eine Idee geringeren Ranges aus, gemeint ist wohl die Idee eines körperlichen Schönen. Zum andern trete diese Idee, indem sie sich im Stein realisiert, in eine niedrigere Existenzform ein. Allerdings werde mit diesem ‚Eintreten‘ der Idee in die Materie die Idee nicht selbst zu etwas Materiellem. Die Idee bleibe unverändert und unbeweglich an ihrem Ort, wie ja auch die Idee eines Gebrauchsgegenstandes nicht selbst in seine Realisierung eingeht, sondern als Modell im Geiste ihres Herstellers bewahrt ist. Plotin meint hieraus schließen zu können, dass die Realisierung der Idee immer auch Abfall und Entfernung von ihr sei. Auf bildhafte Weise versucht er, diesen Sachverhalt zu umschreiben. Indem die Wärme sich von der Wärmequelle entfernt, wird sie schwächer, indem eine Kraft sich verbreitet, verliert sie an Intensität. In ähnlicher Weise unterliege die Idee einer ontologischen Abschwächung und erfahre die hemmende Gewalt des Stofflichen. So gelangt Plotin zu der Annahme, dass die Idee des Schönen, die der Verfertigung der Sache vorausgeht, schöner und vortrefflicher als jede ihrer Realisierungen ist.
Doch dürfe man die Künste darum nicht gering schätzen, fährt er fort, als ahmten sie lediglich die sichtbare Natur nach, wie der platonische Sokrates in der Politeia behauptete. Vielmehr steigen sie hinauf zu den Urbildern, die der Natur selbst zugrunde liegen.
„Außerdem bringen die Künste viel aus sich selbst hervor und wenn bei einem Dinge etwas fehlt, so ergänzen sie das Fehlende, weil sie im Besitze der Schönheit sind. So hat Phidias das Bild von Zeus geformt, nicht nach einem sinnlichen Vorbild, sondern, wie Zeus erscheinen würde, wenn er sich vor unseren Blicken zeigen wollte.“83
Mit dieser letzten Wendung84 ist der platonisch-sokratische Angriff auf die Kunst abgeschwächt, ja, zu einem nicht geringen Teil zurückgenommen. Dem bildenden Künstler, obschon nicht nur ihm, wird nun das Privileg des direkten Zugangs zu den Ideen zugeschrieben. Er vermag die Urbilder, das Göttliche selbst sichtbar zu machen, wie es sich den Augen der Menschen zeigen würde, wenn es aus seiner Verborgenheit hervortreten wollte. Hiermit ist bereits ein wichtiger Schritt in Richtung auf die Rangerhöhung des Künstlers getan, wie sie sich mehr als 1000 Jahre später in der italienischen Renaissance durchsetzen wird. Die platonisierenden Kunsttheorien sollten sich in der Zukunft mit Blick auf den Prestigegewinn des Künstlers als besonders verlockend erweisen. Nicht weniger wichtig war jedoch ein anderes Element, das in die entgegengesetzte Richtung weist, nämlich die Annahme, dass die materielle Realisierung der Idee Abschwächung und Trübung ihrer Strahlkraft sei. Die Verwirklichung ist Manifestation und zugleich Verunreinigung des Urbildes, das für sich genommen seine Realisierung an Schönheit übertrifft. So wird die Rangerhöhung, die dem Künstler und seinem Werk zuteil wird, zugleich auch wieder eingeschränkt, wenn nicht gar zurückgenommen.85
Wie weitreichend auch die Wirkung des neuplatonischen Denkens auf dem Gebiet der Kunsttheorie in der Vergangenheit gewesen sein mag, im Lichte gegenwärtiger Erfahrungen werden zentrale Annahmen der plotinischen Kunstlehre Befremden hervorrufen. Vor allem zwei ihrer Züge erscheinen problematisch: zum einen die Degradierung, ja, vollständige Vernachlässigung des materiellen Aspekts des Kunstwerks; zum andern die als selbstverständlich geltende Voraussetzung, dass die Aktivität des Künstlers darin bestehe, einem vorgegebenen Modell (der Idee) zu folgen, das sowohl ontologisch als auch ‚ästhetisch‘ von höherem Rang sei als die Ausführung. Plotin lässt keinen Zweifel daran, dass die Idee, das eigentlich Schöne sei, das nur mit den Augen des Geistes wahrgenommen werden könne, und den Sinnen verschlossen sei.
Nun steht hinter dieser letzten Annahme gewiss auch der Gedanke, dass die Kunst mit dem Göttlichen zu tun hat, dass jedoch der wirkliche Gott sein steinernes oder bronzenes Abbild unendlich übertrifft. Das Abbild kann nie mit seinem Urbild zusammenfallen, ebenso wenig wie das Abbild des Guten oder die Erscheinung des Guten (so wurde die körperliche Schönheit häufig definiert) schon das wirkliche Gute selbst ist. Doch stößt der Leser neben solchen Überlegungen bei Plotin und seinen Nachfolgern auf Erwägungen, die schwerer nachvollziehbar sind. Auf einige der hiermit verbundenen Probleme werden wir bei der Erörterung von Augustinus näher eingehen. Beschränken wir uns hier zunächst auf zwei Punkte: auf die Vernachlässigung der Materialität des Kunstwerks und auf Plotins Vorstellung vom künstlerischen Schaffensprozess.
Plotin behauptet, die Schönheit eines Bildwerks könne nur der Form, der Idee zukommen, da der ungeformte Stein als solcher nicht schön genannt werden kann. Plotin lässt jedoch eine dritte Möglichkeit außer Betracht: nämlich dass die Schönheit eines Artefakts dem Zusammenwirken von Form und Materie zu verdanken ist, dass es gerade die innige Verschränkung von Idee und Materialität ist, die die Schönheit eines Kunstwerks ausmacht. Aus eigener Anschauung wissen wir, wie sehr Bedeutung und Ausdruck eines Werks sich verändern, wenn es in ein anderes Medium übertragen wird. Man denke etwa an die Marmorrepliken von in Ton oder Bronze ausgeführten Werken von Rodin. Den Marmorfassungen geht die Gespanntheit und die Energie, die Beweglichkeit der Struktur, die Verbindung von Widerständigkeit und Geschmeidigkeit ab, die Rodins Werke in Bronze kennzeichnen. Sie sind summarischer und kühler als ihre Gegenstücke in Metall.86 Für unser heutiges Verständnis vom Kunstwerk ist daher vor allem die Art und Weise wichtig, wie es zustande gekommen ist. Wer eine Figur aus dem Stein herausmeißelt, gibt seinem Werk einen anderen Charakter als jemand, der den Ton mit seinen bloßen Händen formt und der auf dem Material die handgreiflichen Spuren seines Tuns hinterlässt. Wir brauchen
„nur unbefangenen Auges zu sehen, was der Künstler tatsächlich tut, um zu begreifen, dass er eine Seite der Welt fasst, die nur durch seine Mittel zu fassen ist, und zu einem Bewusstsein der Wirklichkeit gelangt, das durch kein Denken jemals erreicht werden kann.“87
Mit diesen Worten hat Conrad Fiedler im Jahre 1887 diese antiplatonistische Einsicht, die für unser heutiges Verständnis des Ästhetischen von grundlegender Bedeutung ist, zum Ausdruck gebracht.
Plotins Absehen von der materiellen Existenz der Kunstwerke kommt auch in seiner Stellungnahme zu den räumlichen Dimensionen eines Kunstwerks zum Ausdruck.
„Und gesetzt, dass, ob groß oder klein, es sich um dieselbe Form handelt, und diese Form in gleicher Weise die Seele des Betrachters berührt und auf sie denselben Eindruck macht, durch ihr eigenes Vermögen, dann kann die Schönheit nicht dem Umfang der Masse zugeschrieben werden.“ (Plotin, Enn., V, 8, 2)
In der Tat zählen für Plotin nur die internen Maßverhältnisse des Gegenstandes, wobei es unwesentlich ist, ob diese Verhältnisse in einem Objekt von geringen oder von monumentalen Abmessungen realisiert sind. Auch diese Annahme wird uns befremden, da die Wirkung, die ein Kunstwerk auf uns hat, sicher nicht von seinen räumlichen Dimensionen unabhängig ist. Es ist eben ein Unterschied ums Ganze, ob die Nike von Samothrake oder der Eiffelturm im Miniaturformat auf unserem Schreibtisch stehen oder ob wir sie in wahrer Größe vor uns oder über uns erblicken.
Aus Plotins Bemerkung erhellt somit die rein geistige und rein intellektuelle Orientierung seiner Kunstauffassung. Die Erfahrung von ‚Kleinheit‘ und ‚Größe‘ ist keine ausschließlich geistige Erfahrung. Sie ist relativ zu unserem Körper und dessen Größe und zu unserem körperlichen Selbstgefühl. Plotin sieht hier also von der Perspektivität und Relativität unserer Erfahrung räumlicher Gegenstände ab. Und hiermit werden auch Bestimmungen wie ‚riesig‘, ‚gigantisch‘, ‚zierlich‘, ‚niedlich‘ und ‚monumental‘ hinfällig, die in unserer Erfahrung (auch von Kunstwerken) eine wesentliche Rolle spielen. Zudem: Wenn es wahr ist, was manche Philosophen meinen, dass auch Maß und Messen relativ auf den Körper des Messenden sind, dann wäre auch die Möglichkeit, überhaupt von Maßverhältnissen zu reden, verloren.88
Plotins Absehen von Körper und Material, seine absolute Anschauung von Größenverhältnissen und Gestalt kehren in seiner intellektualistischen Auffassung von der künstlerischen Aktivität wieder. Wir Heutigen jedoch haben – nicht zuletzt durch die Kunst des 20. Jahrhunderts – gelernt, dass die Bildung einer künstlerischen Idee keine rein geistige Angelegenheit ist. Vielmehr formt sich die Idee, wenn man sie denn überhaupt annehmen muss, allererst in der Wechselwirkung von Hand, Auge und Material, das selbst ein wesentlicher Faktor in diesem Prozess und nicht nur passiver Stoff ist, lediglich dazu bestimmt, die Form aufzunehmen. Nicht nur eine Idee wird vom Künstler ausgedrückt, vielmehr hinterlässt sein Körper im Werk die Spuren seiner Tätigkeit, wenn nicht gar der Körper selbst das Medium des Ausdrucks ist. Nicht zuletzt sind es ja oft Motorik und Gebärde, die wir bei einem Kunstwerk bewundern – etwa die Entschiedenheit und Reinheit der Bewegung des Bleistifts auf dem Papier bei einer Picasso-Zeichnung –, die sich mit der Eleganz und Resolutheit der Bewegungen eines geübten Sportlers messen kann.
Mehr noch als in anderen Jahrhunderten versteht der Künstler sein Tun heute nicht so sehr als Nachahmung eines Vorgegebenen und sei es auch einer Idee, sondern eher als ein In-Bewegung-Versetzen von Materialien, Themen und Gestalten, ohne dass das Resultat dieser Interaktion sich von vornherein absehen ließe.89 Doch, so könnte der Anhänger der Ideentheorie einwenden, warum sollte die Tatsache, dass ein Künstler, Dichter usw. das Ziel seines Tuns experimentierend ertasten muss, gegen die Annahme sprechen, dass sein Tun durch Ideen geleitet wird? Behält nicht die Lehre von der idea, wenn auch in gewandelter Form, letztlich doch ihr gutes Recht?
Angesichts dieser Frage sollte man sich daran erinnern, dass der Begriff der Idee wesentlich mit den Begriffen der Zweckbestimmung und der Notwendigkeit, d.h. der notwendigen Verbindung des Mannigfaltigen zu einem Ganzen, verknüpft ist. Wer die Idee einer Sache erfasst, begreift ihren Zweck und weiß daher auch, welche Eigenschaften der Sache zukommen müssen, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll. So hat Aristoteles aus der Bestimmung der Tragödie, bestimmte Affekte zu erregen, notwendige Eigenschaften des tragischen Kunstwerks abgeleitet. Doch wie weit reicht die Erschließungskraft des Zweckbegriffs? Angesichts der unendlichen Verzweigung der Welt der Kunst scheint es wenig aussichtsreich, bestimmte Werke mit definiten Zwecksetzungen zu verbinden. Wenn überhaupt, lassen diese sich oft nur mit Hinweis auf das Werk selbst bezeichnen. „Das Kunstwerk will nicht etwas anderes übertragen, sondern sich selbst“, so hat Wittgenstein diesen Sachverhalt bündig formuliert und hiermit den platonisierenden Kunsttheorien den Boden entzogen.90 Und weiter: Wollte man mit jedem gelungenen Werk eine Idee verbinden, so würde man schnell zu einer unerwünschten Überbevölkerung des Ideenhimmels gelangen. Und schließlich: Ist der stimmige Zusammenhang in einem Kunstwerk wirklich in jeder wesentlichen Beziehung ein notwendiger Zusammenhang? Besteht zwischen den vielen musikalischen Gedanken in einer Klaviersonate von Mozart ein Verhältnis der Notwendigkeit? Gewiss mag es Notwendigkeiten auf dem Gebiet der Akkordverbindung, der musikalischen Syntax usw. geben, ohne dass sich jedoch im Ganzen eines Werkes eine durchgängige, alternativlose Gesetzmäßigkeit erkennen ließe. So spricht viel dafür, den Begriff der (in Zwecksetzungen verankerten) Notwendigkeit durch den des Möglichen, des Passenden, des Sinnvollen, des Sinnreichen usw. zu ersetzen. Auf die metaphysische Hypothese eines Reichs der Ideen könnte man dann wohl verzichten.
Martin Heidegger hat in Vom Ursprung des Kunstwerks versucht, sich von der Vorherrschaft des Platonismus freizumachen. Ihm ging es darum, das Kunstwerk als Ereignis zu verstehen, das in keiner Idee vorgezeichnet und vorweggenommen ist. Im Zusammenhang hiermit strebte er danach, dem Eigenwert und Eigensinn des Materials, zum Beispiel von Marmor, Holz, Alabaster, Filz und Eisen gerecht zu werden, die jeweils ihre eigene Sprache sprechen.91 Heidegger, aber auch M. Merleau-Ponty und T. W. Adorno haben die Legitimität der klassischen Dichotomie und Hierarchie von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, von Form und Stoff, von eidos und hylé, von Körper und Seele, in Zweifel gezogen. Nicht zuletzt deshalb, weil die verschiedenen Spielarten des Stofflichen jeweils ihr eigenes Wesen haben, das nicht in der bloßen Vorstellung, als Idee, sondern erst in der leibhaften Gegenwart der Dinge zum Ausdruck kommt.
59 Plotin, 204/205–269/270 n. Chr.
60 Übrigens sind auch die Porträts des Sokrates nicht zu seinen Lebzeiten entstanden.
61 Siehe P. Brown, Die letzten Heiden, Frankfurt am Main 1995, 85. Originalausgabe: The Making of Late Antiquity, Harvard 1978.
62 Siehe Platos 7. Brief und Phaidros (274b). Vgl. H.-G. Gadamer, Dialektik und Sophistik im siebenten platonischen Brief, Heidelberg 1964.
63 P. Brown, Die Entstehung des christlichen Europa, München 1999, 26. Originalausgabe: Divergent Christendoms. The Emergence of a Christian Europe 200–1000 A. D., Oxford 1995.
64 Inwiefern die mystische Seite von Plotins Gedanken Kontakten mit der indischen Philosophie, von denen sein Biograf berichtet, zu verdanken ist, ist ungeklärt.
65 Siehe E. Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie. Studien zur Bibliothek Warburg V, Leipzig-Berlin 1924.
66 Aristoteles, Eudemische Ethik, 1216 a, 11–14.
67 Zeugnisse aus späterer Zeit sagen Ähnliches. Das große Schauspiel der Wirklichkeit – so Seneca – erfordere den Menschen als Zuschauer. Die Beweglichkeit des menschlichen Hauptes sei ihm nicht nur als einem Lebewesen von Nutzen, sondern erlaube ihm vor allem, dem Umlauf der Gestirne zu folgen. Siehe H. Blumenberg, Der Prozeß der theoretischen Neugierde, erw. und überarb. Neuausgabe von Die Legitimität der Neuzeit. Dritter Teil, Frankfurt am Main 1974, 45–46. Seneca, De otio, c. 32. Siehe auch Ovid, Metamorphosen, I, 76–88.
68 Siehe H.-G. Gadamer, Antike Atomtheorie, und Plato und die vorsokratische Kosmologie, in derselbe, Der Anfang des Wissens, Stuttgart 1999.
69 Vgl. auch I. Kant, Kritik der Urteilskraft, § 77 zu der Möglichkeit, die Zweckmäßigkeit der Organismen ohne eine zwecksetzende Instanz zu erklären.
70 „Das Viele“, so heißt es bei Plotin, „würde sein Sein verlieren, wenn es dasjenige nicht gäbe, das vor der Vielheit liegt“, das also selbst nicht Vielheit ist. Vieles ist nur im Zusammenhang eines Bandes der Einheit, das dem Ganzen ein bestimmtes Gepräge verleiht. Stirbt ein Lebewesen, so zerfällt die ursprüngliche Einheit nicht schlechthin. Vielmehr treten neue Einheiten an die Stelle der vorangegangenen, seien sie auch von geringerem Range und von geringerer Mächtigkeit. Auch die scheinbar formlosen Elemente wie ‚Wasser‘ und ‚Erde‘, die Plotin gelegentlich heranzieht, um das Wesen der noch ungeformten hylé zu erläutern, werden noch durch die Form beherrscht, sofern sie nämlich eine bestimmte Natur, ein bestimmtes Wesen besitzen (Plotin, Enn., V, 1, 2; V, 8, 31). Die ‚Materie‘ im ursprünglichen Sinne des Terminus ist nichts anderes, als dasjenige, was eine bestimmte Form und Beschaffenheit annehmen kann. Für sich genommen ist sie das Nicht-Seiende, das noch nichts ist, noch keine Gestalt, kein Gesicht hat und keine Bestimmung erhalten hat, ähnlich wie ein ungeformter Tonklumpen in einer Töpferwerkstatt noch nichts ist.
71 Plotin, Enn., III, 8, 10.
72 Vgl. Hegels Begriff des Ideellsetzens des Materiellen, G. W. F. Hegel, Werke 10, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III, Theorie Werkausgabe, Frankfurt am Main 1970, 21–25.
73 Warum jedoch muss sich das Eine überhaupt in die Vielheit begeben, warum bleibt es nicht bei sich selbst? Wo kommt die Unterschiedenheit überhaupt her? Vieles spricht dafür, dass Plotin diese Frage nur mit Hilfe von Bildern und anthropomorphen Vorstellungen beantworten kann. Etwa mittels folgenden Gedankens: Das Eine als Quelle und Grund aller Vollkommenheit strebe danach, von seiner Vollkommenheit abzugeben, diese manifest zu machen, anstatt sie geizig für sich zu behalten. Überfülle und Großzügigkeit, Generosität, sind hier die Faktoren, die für das Heraustreten des Einen aus seiner Abgeschlossenheit verantwortlich sind. – Möglicherweise aber verfehlt die Frage nach dem Ursprung der Vielheit aus der Einheit letztlich den Ausgangspunkt von Plotins Überlegungen. Denn hier ist das Eine ja von vornherein als das Einigende eines Mannigfaltigen gesehen, und steht somit – ebenso wie die Form zur Materie – ursprünglich in einem inneren Bezug zu ihm. Doch bleibt die Frage bestehen, warum Plotin nicht die Vernunft, den nous, sondern das gestaltlose, bestimmungslose Eine selbst zum Prinzip alles Seienden erhoben hat. Plotin hat wiederholt unterstrichen, wie wenig selbstverständlich dieser Schritt ist. Offenbar ist hier die Überlegung leitend, dass der nous, das vernünftige Denken, Unterschied, Vielheit mit sich führt und somit nicht dasjenige sein kann, das kraft seiner reinen Einheit alles dieses Mannigfaltige beieinander hält (Plotin, Enn., VI, 9). Daher kann das Eine nicht mit dem Nous, dem vernünftigen Denken zusammenfallen, noch auch kann es als Gegenstand des Erkennens gefasst werden. Es ist vielmehr dasjenige, das ‚vor dem Denken‘ liegt. Die Seele habe sich daher in letzter Instanz mit dem Leben des Einen zu erfüllen und sich mit ihm zu vereinigen.
74 Plotin, Enn., I, 6,1.
75 Bereits Aristoteles hat in De Anima (I, 4, 407b–408a) die Vorstellung zurückgewiesen, dass die Seele und die Seelenregungen in den Bereich des Zählbaren und Messbaren fallen.
76 Zwar bedürfen die Lichterscheinungen, die Sterne etwa, eines kontrastierenden Hintergrunds, um überhaupt sichtbar zu werden, doch ist der Reiz ihrer Lichterpracht nicht in numerischen Verhältnissen zu fassen.
77 Seele (und Bewusstsein) werden von altersher mit dem Licht verglichen. Denn auch die (gesunde) Seele wird nicht durch die zahlreichen Inhalte auf die sie gerichtet ist, zerteilt und verstreut oder selbst zu einem Mannigfaltigen, sondern vermag sich wie das Licht als einfach in der Unterschiedenheit zu bewahren.
78 Der hier immer wieder auftretende Begriff der Seele kann sowohl auf die Lebensfunktionen des Organismus Bezug haben, als auch auf die seelischen Funktionen wie Streben, Verlangen, Wahrnehmen, auf das emotionale Leben, schließlich aber auch auf das Denkvermögen, den Intellekt und die Vernunft.
79 Zitiert nach Spätantike und frühes Christentum, Katalog, Liebighaus, Beitrag von D. Stutzinger, 223ff. Siehe auch J. Elsner, Art and the Roman Viewer, The Transformation of Art from the Pagan World to Christianity, Cambridge 1995, 21–48.
80 A. Grabar, Plotin et les origines de l’esthétique médiévale, Cahiers archéologiques I, Paris 1945, 15–36. Siehe auch A. Grabar, The Beginning of Christian Art, London 1967, 288–291. Cf. auch A. Riegl, Spätrömische Kunstindustrie, Nachdruck Darmstadt 1973.
81 Vgl. B. Borg: „Der zierlichste Anblick der Welt …“. Ägyptische Porträtmumien, Mainz am Rhein, 1998.
82 Siehe hierzu auch D. Diderot, L’article Beau (der Encyclopédie). Siehe auch X. Baumeister, Zum Verständnis des Artikels Beau, in Wolfenbütteler Forschungen, Wolfenbüttel-München 1980.
83 Plotin, Enn., V, 8, 1.
84 Auch Proklos und Dion Chrysostomos, der in einem seiner Werke Phidias selbst zu Wort kommen lässt, heben hervor, dass Phidias’ Zeus nicht durch Nachahmung der Wirklichkeit entstanden sei, sondern einen übersinnlichen Ursprung haben müsse. Durch Versenkung in den Zeus Homers – so Proklos – sei die Zeusstatue des Phidias entstanden. Homer’s Dichtungen galten dem Neuplatoniker Proklos – anders als dem platonischen Sokrates – als ein Werk göttlicher Eingebung. S. W. Tatarkiewicz, History of Aesthtetics I, The Hague-Paris 1970, 297–301.
85 Vgl. dagegen Goethe mit Bezug auf Plotin und die Idealisten: „Eine geistige Form wird aber keineswegs verkürzt, wenn sie in der Erscheinung hervortritt, vorausgesetzt, dass ihr Hervortreten eine Zeugung, eine wahre Fortpflanzung sei.“ Das Gezeugte kann sogar vortrefflicher sein, als das Zeugende. In Goethe Artemisausgabe, Band 9, München-Zürich 21977, 642.
86 Gestalt bedeutet hier stets zweierlei: die Idee, den Bauplan, den Zweck, aber ebenso die hiermit verbundene äußere Erscheinung, die Form, den Umriss.
87 C. Fiedler, Schriften über Kunst. Mit einer Einleitung von H. Eckstein, Köln 1997, 200. Hierzu auch W. Weijers, Zichtbaar zijn/zichtbaar maken. Fragmenten uit de geschiedenis van de kunst, in: Het machtige Beeld, Apeldoorn 1989, 15–25. Siehe vor allem auch: das Vorwort von G. Boehm zu: K. Fiedler, Schriften zur Kunst, München 1971.
88 Siehe auch Plotin, Enn., II, 8. Über das Sehen oder wie es kommt, dass Gegenstände, die weit entfernt sind, kleiner erscheinen. Bei der Behandlung des Schönen lässt Plotin die perspektivische Relativität unserer Wahrnehmung außer Betracht.
89 Siehe die zahlreichen Bemerkungen von Alain (Émile Chartier) über das Tun, das Machen etwa: „Œuvres“ oder „L’action, source du beau“, in Propos I, Bibliothèque de la Pléiade, Paris 1956, 450 und 1289–1290.
90 L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Frankfurt am Main 1977, 114. Siehe hierzu im Kant-Kapitel dieses Buches den Abschnitt über den Geniebegriff.
91 Siehe das Kapitel über Heidegger im vorliegenden Buch. Natürlich kann in einem ‚platonistischen‘ Rahmen auch vom Wesen bestimmter Stoffe die Rede sein. Doch bleibt in der Perspektive des Platonismus bei einem Kunstwerk die Stofflichkeit von nur sekundärer Bedeutung.