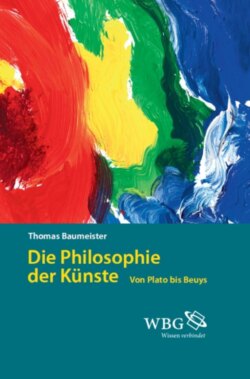Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Plotins Metaphysik
ОглавлениеPlotins Philosophie erscheint wie eine letzte große Zusammenfassung des klassischen griechischen Denkens und von dessen am Begriff der Zweckmäßigkeit orientierten Ontologie, die lehrt, dass Vernunft, der Logos, ein das Ganze organisierendes Prinzip, der Wirklichkeit zugrunde liegt. Dass die Natur, ein wohlgeordnetes Ganzes ist, ist eine der Grunderfahrungen des griechischen Denkens, die ihren Niederschlag bereits im Begriff des kosmos findet, dem Begriff der alles umfassenden Ordnung. Neben dem ethischen Verständnis des Schönen, das wir vor allem in Platos Dialogen antreffen, steht von alters her der kosmologische Begriff des Schönen, der sich mit dem ethischen verschränken kann. Als schön im eminenten Sinne gilt die ewige Ordnung der Natur, die sich aus Ungleichgewicht und Störung wiederherzustellen vermag. Das Gleichmaß der Gestirnsbewegungen konnte sowohl als Vorbild für die harmonische Verfassung der wohlgearteten Seele als auch als ihr kosmisches Gegenstück begriffen werden.
Bewunderung und Verwunderung über den Kosmos durchziehen das griechische Denken bis zur Stoa und ihren römischen Anhängern. Besonders deutlich kommt dies in einem Anaxagoras zugeschriebenen Diktum zum Ausdruck: dass die höchste, die eigentliche Bestimmung des Menschen in der Betrachtung der Ordnung des Ganzen liege – und vor allem der Bewegungen der Himmelskörper.66 Die Betrachtung der Wirklichkeit, die theoretische, kontemplative Lebensform wurde somit – wenn man der Überlieferung trauen darf – bereits von vorsokratischen Philosophen als die vornehmste menschliche Tätigkeit angesehen.67
Das sokratische Denken scheint zunächst diese kosmologische Tendenz durch eine ethisch-politische und erzieherische Zielsetzung zu ersetzen. Doch können uns Platos Timaios, aber auch bestimmte markante Passagen des Phaidon hier eines Besseren belehren. Besonders instruktiv ist in diesem Zusammenhang Sokrates’ Versuch, seine eigenen philosophischen Intentionen von denen seiner Vorgänger, den jonischen Naturphilosophen, den sogenannten physiologoi, abzusetzen. Anstelle der dort betriebenen, gleichsam materiellen Erklärungsweise schlägt Sokrates eine andere Art der Erklärung vor, die die Erscheinungen in Natur und Menschenwelt unter dem Gesichtspunkt des ‚Guten‘, d.h. der Funktionalität, zu begreifen versucht. Nicht nur menschliches Handeln ist in dieser Perspektive zu beschreiben, sondern ebenso müssen Naturvorgänge unter dem Blickwinkel der Zweckmäßigkeit, kurz, des Guten, verstanden werden. Der Zusammenhang macht deutlich, dass es sich bei der sokratischen Wendung zu den logoi, zu den einsichtigen Ursachen, nicht nur um eine Projektion von Kategorien menschlichen Handelns auf die Natur handelt. Vielmehr kommen vor allem die Erscheinungen der organischen Natur einer solchen Betrachtungsweise entgegen. Bei der Erklärung der Struktur lebender Wesen treten unvermeidlich – und das ist noch immer so – teleologische Fragen auf, Fragen nach dem funktionellen Sinn bestimmter innerer und äußerer Merkmale und innerorganischer Vorgänge. Auch die heutige Biologie stellt derartige Fragen, was jedoch nicht besagt, dass die Theorie auch von klassischen teleologischen Theoremen wie etwa der Entelechie oder der ‚inneren Form‘ Gebrauch machen muss.68
Diese teleologische Weltsicht ist in Plotins Denken ungebrochen wirksam. Der Kosmos selbst wird als ein großer Organismus gesehen, als das ‚große Tier‘, als ein großes Lebewesen, dessen Teile zur Erhaltung des Ganzen zusammenwirken. Es ist vor allem diese Bewunderung für die Ordnung des Ganzen, die Plotins Denken eine festliche Stimmung und einen Ton lyrischer Ergriffenheit verleiht. In diese bewundernde Stimmung mischt sich jedoch noch ein anderer Klang: ein Seelenton von Nostalgie und sehnsüchtigem Verlangen der Seele nach Rückkehr zu ihrer Geburtsstätte, nach Vereinigung mit dem Einen. Auch herrscht häufig ein majestätischer Zug in der Prosa Plotins. Wie viele Autoren mit mystischen Neigungen greift Plotin auf die feierliche Bilderwelt von Thronsaal, Palast und Basilika zurück, auf die Embleme profaner und sakraler Herrschaft und, was nicht minder wichtig ist, auf die Metaphorik von Licht und Glanz, wodurch seine Texte ein Klima ruhiger Erhabenheit atmen.
Wie verhalten sich jedoch das gestaltlose Eine, und die Welt in ihrem Formen- und Gestaltenreichtum zueinander? Wie sind Mystik und Ontologie miteinander verbunden? Es ist hier nicht der Ort, um Plotins Denken in all seinen Verzweigungen zu entwickeln. Doch können wir zum besseren Verständnis seiner Lehre vom Schönen nicht umhin, auf das auffallendste Paradox dieser Theorie einzugehen, nämlich auf den ins Auge springenden, vielleicht aber nur scheinbaren Widerspruch: dass das Eine, das die Wirklichkeit tragende und in ihr sich allenthalben manifestierende Prinzip (arché), zugleich jenseits dieser Wirklichkeit gelegen sein soll; dass also der alles beherrschende Ursprung durch einen unüberbrückbaren Abstand von dem geschieden ist, worin er sich bekundet.
„Alles Seiende ist durch das Eine ein Seiendes“, beginnt eine der zahlreichen Überlegungen, in denen Plotin dieses Verhältnis zu entwickeln trachtet. „Denn, was könnte es sein, wenn es nicht eines ist? Da ja, wenn man ihm die Einzahl, die von ihm ausgesagt wird, nimmt, es nicht mehr das ist, was man es nennt. Denn es kann kein Heer sein, wenn es nicht Eines sein soll, und kein Reigen und keine Herde, ohne Eines zu sein“ (Plotin, Enn., VI, 9). Alle diese Dinge sind also Einheiten, Vereinigung eines Mannigfaltigem zu einem Ganzen. Ein Heer ist durch die Einheit des Kommandos und die Loyalität der Soldaten ein Ganzes, Rhythmus und die Anweisungen des Chorführers formen die Tänzerschar zu einem Chor. Ein Boot und ein Schiff haben ihr Sein und ihre Einheit ihrer Bestimmung und ihrem Bauplan zu verdanken, wodurch die verschiedenen Bestandstücke zu einem Ganzen verbunden sind. Der Körper des Menschen ist eins dank der alles durchziehenden, lebenspendenden Seele, die alle Organe ihrer Bestimmung gemäß bewegt. Und vor allem die Schönheit und die areté, die sittliche Vortrefflichkeit, können nur als hochintegrierte Einheiten begriffen werden. Denn Schönheit ist ja nur dann gegeben, wenn die Teile ein unteilbares Ganzes formen. Und ebenso stehen beim sittlich vortrefflichen Charakter Einsicht, Gefühl und Antriebskräfte nicht in äußerlicher Beziehung zueinander, sondern befinden sich in inniger Übereinstimmung miteinander.
Nun ist für Plotin, wie schon gesagt, auch das Ganze der Welt keineswegs ein bloßes Aggregat unverbundener Elemente, ‚ein Haufen losen Sandes‘, sondern selbst eine solche Einheit des Mannigfaltigen, die von primitiven Formen der Integration bis zu höheren und höchsten Einheitsformen aufsteigt. Es kann darum nicht verwundern, dass das Eine, ein Zusammenhang stiftendes Prinzip, dem All zugrunde liegt. Ohne das Eine, so vernehmen wir, wäre das Ganze auseinandergerissen und das Zusammenpassen des Mannigfaltigen zur funktionellen Einheit wäre nur als eine Folge des blinden Zufalls anzusehen (Plotin, Enn., V, 3, 12).69 Dass der Zufall hier seine Hand im Spiele habe, ist für Plotin – anders als für die moderne Evolutionstheorie – keine ernst zunehmende Möglichkeit und ist überdies mit seiner Überzeugung von der Unerschütterlichkeit der Weltordnung nicht zu vereinbaren. Wo wir Zweck und Planmäßigkeit antreffen, da müssten wir eine planmäßig wirkende Instanz, d.h. ein Prinzip, voraussetzen.70
Wie jedoch ist nun die Behauptung Plotins zu verstehen, dass das Eine sowohl Prinzip des Vielen als auch zugleich von ihm geschieden ist und jenseits des Vielförmigen und Vielgestaltigen liegt (Plotin, Enn., V, 13)? Sollte man nicht vielmehr annehmen, dass das Eine im Vielen gegenwärtig ist, wie dies auch die von Plotin bevorzugten Metaphern nahelegen: die Metapher des Lichts, das den Raum erfüllt, die Metapher vom Baum, bei dem das vielgestaltige Ganze, von den Wurzeln bis zum Wipfel, von einem beseelenden Prinzip durchzogen ist, und das Bild der Quelle, die obschon in viele Strömen sich verzweigend doch immer ein und dieselbe Quelle bleibt?71 Was also ist gemeint?
Zum einen hat Plotin mit diesen Bildern und mit der These von der Geschiedenheit des Einen vom Vielen offensichtlich die Unerschöpflichkeit des ersten Prinzips im Blick. Geht man, wie das klassische Denken, von der Dauerhaftigkeit und Unzerstörbarkeit der Weltordnung aus, so muss die Kraft, die diese Ordnung erhält, selbst unerschöpflich sein. Da sie weder zunimmt noch abnimmt, ist sie als von dem Reich der Vielheit und der Veränderung getrennt anzusehen. Erläutern wir dies an den von Plotin bevorzugten Beispielen der Sonne und der Quelle. Die Sonne – so will er offenbar sagen –, die unablässig Licht und Wärme aussendet, verliert dabei nichts von ihrer Kraft, anders als das irdische Feuer, das ständig neuer Nahrung bedarf. Die unversiegbare Lichtquelle verausgabt sich nicht in der Vielheit, sondern bleibt gleichsam unbeweglich bei sich selbst. Nicht anders steht es mit der ständig sprudelnden Quelle: Diese verteilt sich in Bäche und Ströme, die sich von ihrem Ursprung und auch voneinander entfernen. Der unversiegbare Quell selbst jedoch verharrt an seinem Ort. Unermüdlich tätig, bewegt er eigentlich sich selbst nicht, sondern bleibt, was er ist, und ist so der Veränderung, der Vermehrung oder Verminderung seines Vermögens entzogen. So bezieht sich also die paradox wirkende Rede von der Geschiedenheit des Einen vom Vielen, dem es doch innewohnt, auf die Unerschöpflichkeit und Unveränderlichkeit des Ursprungs.
Doch hat Plotin offenbar noch Folgendes im Blick. Das Licht, das sich in eine Vielheit von Richtungen ausbreitet und die Welt in ihrer Mannigfaltigkeit sichtbar macht, bleibt hierin doch immer ein und dasselbe Licht. Obwohl es in die Vielheit hinaustritt, hier ist und dort ist, wird es selbst kein Vielfaches, vielmehr behält es seine ursprüngliche Einfachheit. So ist auch das Wasser der Quelle, das sich in viele Arme verzweigt, immer ein und dasselbe Wasser, Ausfluss ein und derselben Quelle. Dasselbe gilt auch von der Seele, der Lebenskraft, die sich in den verschiedenen Gliedmaßen und Organen eines Lebewesens manifestiert und hierin doch ein und dieselbe Seele bleibt, die dieses Vielförmige, im Raum Ausgedehnte beieinander hält.72 In die Mannigfaltigkeit sich ergießend verliert also das Eine nicht sich selbst. Denn es vermag ja nur dann das Prinzip sein, das das Mannigfaltige zu Einem verbindet, wenn es selbst kein Mannigfaltiges ist, das seinerseits auf eine einheitsstiftende Instanz angewiesen wäre. Darum muss der Ursprung als reine Einheit anerkannt werden und muss von der Vielheit, obschon er in dieser wirksam ist, auch wiederum als ein Jenseitiges geschieden sein.73