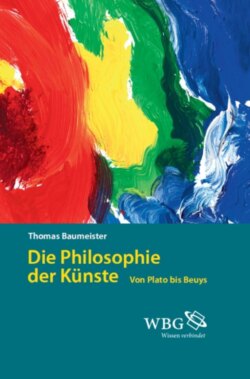Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Fobos und eleos und der Charakter des tragischen Helden
ОглавлениеNur da, wo die Einheit der Handlung und die verhängnisvolle Umkehrung gegeben sind, werden Aristoteles zufolge die tragischen Affekte in vollem Umfang hervorgerufen. Aristoteles versteht Emotionen, Affekte und Gemütsbewegungen zu Recht nicht als in sich beschlossene Gefühle, sondern als Zustände, die intentional auf einen Sachverhalt, eine Situation bezogen sind. Wer eine Emotion beschreiben will, muss daher sowohl die subjektiven als auch die objektiven Komponenten der jeweiligen Situation angeben. Und damit ist zu fragen, welche Situation den Affekten fobos und eleos entspricht.
Bei der Beantwortung dieser Frage sollte man sich der ursprünglichen Bedeutung beider Ausdrücke erinnern. Mehr noch als Furcht und Mitleid, mit denen man sie häufig übersetzt hat, bezeichnen fobos und eleos Affekte besonders heftiger Art. Fobos meint ursprünglich das Gefühl von Panik, das den Krieger in der Schlacht ergreifen und in die Flucht jagen kann. Man denke etwa an das Entsetzen, das das Erscheinen des Achilles hervorruft, als dieser das Schlachtfeld betritt, um den Tod von Patroklos zu rächen. Auch eleos verweist auf eine extreme Gefühlslage, die sich in Schreien und exzessiven Klagerufen äußert und wenig von dem Charakter von Rührung und sanfter Ergebung hat, die mit Mitleid im christlichen Sinne verbunden sind. Eleos wird vor allem dann hervorgerufen, wenn ein naher Verwandter fällt oder wenn ein junger, vielversprechender Mensch in der Blüte seiner Jugend unerwartet und unverdient vom Schicksal getroffen wird oder aber auf tragische Weise schuldlos schuldig wird.
Nicht jeder Handelnde, der sich ins Unglück stürzt, ist jedoch für Aristoteles ein geeigneter Adressat von phobos und eleos. Vielmehr bedarf der tragische Held ganz spezifischer Eigenschaften. Er muss von besserem Charakter als die meisten Menschen sein, denn nur der Untergang eines vortrefflichen Menschen, nur das Los dessen, der in gewisser Beziehung unverdient leidet, entsetzt uns. Der Untergang eines schlechten Menschen dauert uns nicht oder sollte es jedenfalls nicht, denn, so Aristoteles, ein solcher verdiene kein Mitgefühl. So vortrefflich der tragische Held auch sein mag, der Unterschied zu den Zuschauern dürfe wiederum nicht allzu groß sein, denn der tragische Schauder stellt sich nur dann ein, wenn Held oder Heldin uns ähneln, wenn wir also in ihm uns selbst erkennen. – Nicht tragisch ist es auch, Aristoteles zufolge, wenn eine Person von makellosem Charakter, ein völlig Unschuldiger, vom Verhängnis getroffen wird. Eine solche Situation würde weder Mitleiden noch Schauder, sondern lediglich Abscheu hervorrufen. – Diese letzte Bemerkung kann stutzig machen, denn warum sollte das Unglück eines makellosen Menschen nicht auch Schrecken und Jammer verbreiten können? Etwa weil der Abstand zwischen Zuschauer und Protagonist als zu groß empfunden wird? Oder hat Aristoteles das Missverhältnis zwischen der Unschuld des Opfers und seinem Los vor Augen, das nur als abscheulich und grauenvoll erlebt wird, anstatt ein Miterleben hervorzurufen? Das Entsetzen, vielleicht sogar die Empörung über diesen eklatanten Mangel an Ausgewogenheit in der Weltordnung würde dann gleichsam alle anderen Affekte überstimmen.
Weiterhin ist zur Tragik des Geschehens erforderlich, dass der Held durch eigenes Tun zu Fall kommt, durch einen Missgriff, einen Fehltritt, durch das, was Aristoteles hamartía nennt.52 In seiner Ethik unterscheidet Aristoteles drei Formen verkehrten oder misslungenen Handelns: adikía, Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, atychía, Unglück im Sinne von Pech und Missgeschick, bei dem der Zufall die Absichten des Handelnden durchkreuzt, und hamartía. Hamartanein bedeutet ursprünglich dasselbe wie ein Ziel verfehlen, einen Fehler begehen. Im Christentum kann hamartía die Bedeutung von Sünde, von schwerer sittlicher Schuld annehmen. Die hamartía im Sinne des Aristoteles dagegen hat hiermit nichts zu tun; sie verweist vielmehr auf einen Fehlgriff, der gerade nicht aus einem üblen oder verworfenen Charakter entspringt. Der tragische Held solle ja vortrefflicher sein als der gemeine Mann und die gemeine Frau. Somit müssen in gewissem Umfang selbstverschuldete Unwissenheit und Blindheit dem tragischen Missgriff zugrunde liegen. Diese Blindheit kann verschiedene Ursachen haben: Sie kann in der Art der Situation, in der gesellschaftlichen Rolle des Protagonisten begründet liegen und nicht zuletzt auch in der Art seines Charakters, seines Temperaments und seiner Leidenschaften. Diese Charakterzüge müssen keineswegs verwerflich sein, im Gegenteil: Man denke an das leidenschaftliche Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Antigone mit Bezug auf Vater und Bruder beseelt, an den Stolz, die Heftigkeit und das Ungestüm des Ödipus, an das Loyalitätsgefühl von Klytämnestra gegenüber ihrer Tochter Iphigenie. Es geht also um Eigenschaften, die ebenso vortrefflich sind, wie sie verhängnisvoll werden können. Aus eigener Erfahrung weiß jeder, dass die Vorzüge eines Menschen oft eine negative Kehrseite haben und dass auch dem Negativen etwas Positives entspricht. Ödipus wird Opfer derselben Eigenschaften, die ihn auf den Thron gebracht haben; Hartnäckigkeit und das Vermögen, ohne lange zu zögern, Entschlüsse zu fassen, Eigenschaften, die jedoch in blinde Verbissenheit und aufbrausenden Eigensinn entarten können und ihn schließlich ins Unglück stürzen. Was also ein Höchstmaß von fobos und eleos, von Jammer und Schauder, hervorruft, ist das Schauspiel eines Menschen von vortrefflichen Gaben, der gerade durch sie, jedenfalls durch sein eigenes Zutun, sich und andere ins Unglück stürzt.
Die Tragödie habe es mit Glück und Unglück zu tun und mit menschlichem Handeln, denn durch ihr Handeln würden Menschen glücklich oder unglücklich, heißt es im 6. Buch von Aristoteles’ Poetik. Diese starke Betonung des Zusammenhangs von Glück und Handeln kann verwundern. Werden Menschen nicht einfach auch durch Umstände, die außerhalb ihrer Verfügungsgewalt liegen, glücklich und unglücklich. Ist denn das Glück eines Lebens völlig von unserem Handeln abhängig, wie Aristoteles’ Formulierung zu suggerieren scheint?
Bei Licht besehen ist Aristoteles nie so weit gegangen. In seiner Ethik unterscheidet er den Kern des Glücks, seine Substanz, von den inneren und äußeren Umständen, die, wenn sie dem Handelnden günstig sind, das Glück seines Lebens erst vollständig machen. Der Kern von Glück oder Unglück liegt im guten oder schlechten Charakter des Menschen beschlossen, in seiner Haltung, seinem sittlichen Habitus. In diesem Sinne hängt das Glück des Menschen von ihm selbst und seinem Handeln ab. Doch hat Aristoteles ebenso anerkannt, dass es zum vollständigen Glück auch der glücklichen Umstände bedarf. Priamos etwa hat, ohne selbst schuldig geworden zu sein, Reich, Frau und Kinder verloren. Glücklich kann er somit nicht genannt werden. Da er aber selber ohne Fehl und Tadel war, kann er auch nicht als völlig unglücklich bezeichnet werden. So ist also das Glück des Menschen in den Augen des Aristoteles zusammengesetzter Natur. Die Substanz des Glücks beruht auf der ethischen Gesinnung und Haltung und hängt somit vom Menschen selbst und seinem Tun ab. Doch bedarf es auch der Gunst der Umstände, über die der Mensch nicht restlos verfügt, um das Glück vollständig zu machen. Ja, um überhaupt einen stabilen Charakter aufzubauen und in den Besitz der Substanz des Glückes zu gelangen, muss ein Mensch bereits einigermaßen vom Glück begünstigt sein. – Soweit der Grundgedanke der aristotelischen Lehre vom Ziel des menschlichen Lebens.
Doch bilden die Praxis, für die wir die volle Verantwortlichkeit tragen, und die Gewalt der Umstände, denen wir unterworfen sind, nicht zwei voneinander getrennte Bereiche, sondern sind eng miteinander verknüpft. Gemeint sind die unvorhergesehenen und auch nicht immer vorhersehbaren Folgen menschlichen Handelns. Es geht um die Blindheit und die Verblendung, die menschliches Sehen und Bewusstsein unvermeidlich begleiten, wie der Schatten das Licht. Menschliche Aufmerksamkeit ist immer selektiv und nie allumfassend: Indem der Mensch auf eines gerichtet ist, lässt er anderes unbeachtet. So können dem Handelnden wichtige Elemente seiner Situation, von zukünftigen Entwicklungen ganz zu schweigen, verborgen bleiben, was unbeabsichtigt verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen kann. Diese Blindheit ist oftmals mit den besten Eigenschaften eines Menschen verbunden und kann daher von besonderer Hartnäckigkeit sein. Diese unaufhebbare Fehlbarkeit des Menschen ist für Aristoteles das eigentliche Thema der Tragödie. Sie zeigt, dass die besten Absichten und vortreffliche Eigenschaften uns nicht davor bewahren, aufs Schrecklichste zu scheitern. Mit besonderer Heftigkeit trifft den Menschen vor allem das Unglück, das er durch sein eigenes Handeln heraufbeschworen hat. Es trifft ihn im Kern seines Selbst- und seines Weltvertrauens und es bedarf großer Seelenstärke, um es zu bewältigen. Es erweckt daher im besonderen Maße die beiden tragischen Affekte, fobos und eleos, die den Angelpunkt der aristotelischen Lehre von der Tragödie bilden.
Aristoteles’ Theorie der Tragödie kann daher als Ergänzung seiner Ethik verstanden werden, die vornehmlich auf denjenigen Aspekt menschlichen Glücks und menschlichen Unglücks bezogen ist, für den der Mensch selbst im vollen Sinne verantwortlich ist: die sittliche Gesinnung und Praxis. Die Tragödie nun lässt darüber hinaus die unüberschreitbaren Grenzen des Handelnden erkennen, die Niederlagen, die seinem Tun entspringen, ja, die in der Art seines Projektes angelegt sein können. Aristoteles korrigiert somit die einseitige Betrachtungsweise Platos, ohne jedoch die platonischen Ausgangspunkte vollständig preiszugeben. Während Plato die Ungerechtigkeit der Seele als das einzige wirklich große Unglück ansieht, womit im Vergleich alle anderen Katastrophen nichtig werden, hat Aristoteles die mögliche Tragik menschlichen Handelns anerkannt und ernst genommen: die Tatsache, dass der Mensch schuldlos schuldig werden kann. Doch bleibt er Platos Ausgangspunkten insofern treu, als auch er in der sittlichen Gesinnung und Praxis den Kern des menschlichen Glücks erblickt.