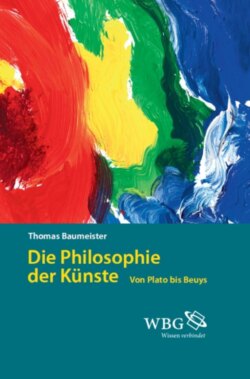Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Katharsis
ОглавлениеAristoteles’ oben zitierte Definition der Tragödie gibt an, dass die tragische Handlung darauf angelegt sei, beim Zuschauer eine Katharsis, eine Reinigung oder Befreiung zustande zu bringen; eine katharsis von fobos und eleos, von Schauder und Jammer und von ähnlichen Affekten, die durch diese Affekte selbst hervorgerufen werde. Aristoteles’ Theorie der Katharsis in der Poetik ist jedoch verloren gegangen und somit behält jede Deutung einen Rest des Hypothetischen. Bemerkungen über die Katharsis und eine Verweisung auf ihre tragische Spielart finden sich jedoch im letzten Kapitel von Aristoteles’ Politik.
Moderne Kommentatoren unterscheiden verschiedene Bedeutungen von Katharsis: eine medizinisch-psychologische Bedeutung, eine kognitive und eine religiöse. Im ersten Fall verweist der Ausdruck auf die Reinigung von Körper und Seele von störenden Elementen, von Verspannungen und Verhärtungen, von psychischen Fixierungen usw. Im zweiten Sinne nimmt der Terminus Bezug auf die Reinigung von Meinungen und Überzeugungen, von Schein und Irrtum. In der dritten Bedeutung verweist der Begriff auf die religiöse, rituelle Reinigung von Leib und Seele. Vor der Teilnahme an religiösen Zeremonien haben sich die Teilnehmer von den Verunreinigungen des täglichen Lebens zu säubern. Auch die Reinigung von Blutschuld und schweren Vergehen durch Opferhandlungen und Gebete gehört in diesen Zusammenhang.
Welche Bedeutung von Katharsis hat Aristoteles in seiner Tragödiendefinition im Auge? Wie muss der Genitiv in dieser Formulierung verstanden werden? Will Aristoteles sagen, dass der Zuschauer der Tragödie von diesen Emotionen gereinigt, d.h. von ihnen befreit werden soll. Oder meint er etwa eine Reinigung dieser Emotionen selbst, die auf ein höheres Niveau erhoben, ja sogar auf ihr eigentliches Wesen zurückgeführt werden sollen?
In den Schlusspassagen im 8. Buch der Politik53 behandelt Aristoteles die Katharsis im Sinne von ‚Befreiung von …‘ im Zusammenhang mit der musischen Erziehung. Er erinnert daran, dass die ‚Musik‘ nicht nur einem, sondern mehreren Zwecken dienen kann. (Dieses Bewusstsein von der Vielgestaltigkeit und der vielfältigen Zweckbestimmung der Phänomene ist für Aristoteles kennzeichnend und ein gutes Heilmittel gegen die unausrottbare Philosophenkrankheit, bestimmte Aspekte eines Phänomens zu verabsolutieren.) Aristoteles nennt hier die folgenden Zielsetzungen: paideia (Erziehung), katharsis (Reinigung) und diagoge, der Entspannung und ‚Erholung von der Anstrengung‘ dienend. Diagoge bedeutet ursprünglich Lebensweise und bezieht sich hier auf die vollkommenste Lebensweise und die vortrefflichsten Tätigkeiten, denen der Bürger der Polis sich in seinen Mußestunden widmen kann. Eine dieser diagogischen Beschäftigungen ist, so Aristoteles, das Hören von Musik.
Mit dieser Einteilung verwandt, obschon sich nicht ganz mit ihr deckend, ist die Unterscheidung dreier Sorten von ‚Melodien‘, nämlich den ethischen, den praktischen und den enthusiastischen. Die enthusiastische Musik wird mit religiösen Rauschzuständen und der mit ihr einhergehenden katharsis verbunden, die praktische Musik hat mit der Musik als Zeitvertreib und Unterhaltung zu tun – der Term praxis hat hier offenbar nicht auf die ethische Praxis Bezug, sondern auf den spielerischen Charakter dieser Aktivitäten. Bei der ethischen Musik schließlich geht es um die Darstellung sittlicher Haltungen und sittlicher Affekte. Diese Musik, das Hören und in gewissen Grenzen die musikalische Praxis spielen in der sittlichen Erziehung eine wichtige Rolle. Die ethisch gefärbte Musik bildet überdies auch einen Gegenstand der Diagoge. Das Hören von Musik, vor allem der sittlich bedeutsamen, gehöre zu den vortrefflichsten Beschäftigungen des Menschen in seinen Mußestunden. In der musikalischen Mimesis menschlicher Charakterformen erscheinen die Ethosgestalten auf exemplarische und die Seele erfüllende Weise.
Doch kehren wir zum Thema der Katharsis zurück. Katharsis wird in der von uns oben herangezogenen Passage aus Aristoteles’ Politik im medizinisch-psychologischen Sinn verstanden. Sie wird mit dem religiösen Enthusiasmus und mit der orgiastischen Musik, der Flöte des Dionysos, in Zusammenhang gebracht. Anders als Plato sieht Aristoteles diese Zustände nicht nur in einem negativen Licht. Er betont, dass Menschen, in unterschiedlichem Maße, emotional erregbar und manche zum (religiösen) enthusiasmos, besonders geneigt seien. „An den heiligen Melodien aber sehen wir, dass diese Leute, wenn sie die Melodien in sich aufnehmen, welche die Seele berauschen (exorgiazein), wieder zu sich gebracht werden, wie wenn sie eine Heilung und Reinigung erfahren hätten. Auf dieselbe Weise müssen auch die zu Mitleid, Furcht oder zu irgendeinem Affekt Geneigten beeinflusst werden, und auch jeder andere Mensch, soweit von jedem Affekt etwas auf seinen Teil kommt, sodass alle Menschen fähig sind, eine solche Reinigung und lustvolle Erleichterung des Gemüts zu empfinden.“54
Katharsis hat es also – diesem Passus zufolge – mit dem Gefühl von Befreiung und Entspannung zu tun, das sich nach heftiger körperlicher Anstrengung (Sport und Tanz) oder nach heftiger Gemütsbewegung einstellt, wie sie Schauspiel und Musik (oder auch Film) zustande bringen können. Alle diese Zustände versetzen uns in gewissem Sinne außer uns, entziehen uns dem Alltag und lassen ein angenehmes Gefühl von Gelöstheit oder auch ein Gefühl von Spannungslösung zurück, wenn der Spannungsbogen durchlaufen und zu einem Ende oder Abschluss gekommen ist. Aristoteles’ Bemerkungen scheinen also in die Richtung der medizinisch-psychologischen Katharsisdeutung zu deuten. Reinigung von den Affekten fobos und eleos bedeutet somit nicht eine bleibende Befreiung von diesen Emotionen, wie man abwegigerweise manchmal meinte. Es zielt vielmehr auf das Gefühl der Läuterung und Erleichterung, das sich einstellt, wenn das Verlangen nach heftiger Gemütsbewegung sich einmal richtig ausleben und entladen kann.55
Nun mag diese sozusagen therapeutische Lesart von Katharsis auf einen bestimmten Typus des Zuschauers zutreffen, der vor allem das emotional Aufwühlende um seiner selbst willen sucht, dem Gehalt des Tragischen, wie Aristoteles es in der Poetik in aller Nüchternheit umreißt, wird es jedoch schwerlich gerecht.56 Die Tragödie lässt ja sehen und erkennen, was ein Höchstmaß von Jammer und Entsetzen hervorruft und für den Menschen das eigentlich zu Fürchtende ist (von sittlicher Schuld abgesehen), nämlich mit den besten Absichten schuldig zu werden oder zu scheitern. Mitfühlen, das Ergriffensein angesichts der tragischen Vorgänge ist nicht nur etwas rein Subjektives, ein Geschehen im Innern der Seele, vielmehr gewinnen wir, indem wir mitfühlen und mitleben, Zugang zur Wirklichkeit, zur Wirklichkeit des Menschen. Die tragische Handlung, wird sie richtig verstanden, erschüttert uns, d.h., sie bringt die Grundfesten unseres Selbstverständnisses und Weltverhältnisses ins Wanken (das kann sogar auch da der Fall sein, wo sich schließlich doch noch alles glücklich fügt). So nötigt sie den vom Geschehen betroffenen Zuschauer zu grundsätzlicher Neuorientierung. Die Tragödie lässt uns die unveräußerlichen Grenzen menschlichen Handelns und Planens gerade durch ihre emotionale Intensität sehen und begreifen. Sie macht das unaufhebbare Risiko jedes entscheidenden Handelns ebenso sichtbar wie auch die Neigung ausgezeichneter Individuen, sich zu überschätzen und sich auf dem Gipfel ihres Erfolgs als Halbgötter anzusehen. So liegt es nahe, den Begriff der Katharsis auch mit dem Erwachen aus solcher Verblendung und Selbstüberschätzung zu verbinden. Katharsis auf den Zuschauer der Tragödie bezogen, würde dann bedeuten, dass dieser zu einem tieferen Verständnis der Lage kommt, auf die er mit Entsetzen und Mitgefühl antwortet. Ein tieferes Verständnis, das heißt nichts anderes als: Auch mir kann so etwas passieren. Oder genauer noch: Kein Mensch ist gegen solche Fehlgriffe und Fehltritte gefeit. Mit solcher Einsicht in das allgemein Menschliche transformieren sich unsere Affekte. Wir gewinnen Abstand zu ihnen und sind ihnen nicht mehr fassungslos ausgeliefert. Wir erkennen mittels ihrer etwas Allgemeines: Wir sind nur Menschen, keine Götter. ‚Befreiung von den Emotionen‘ bedeutet im Lichte dieser Lesart nicht Auslöschung unserer Gemütsbewegungen, sondern ihre Umbildung, Linderung des Schmerzes durch Anerkennung und Hinnahme der unüberwindlichen Grenzen der menschlichen Natur.57