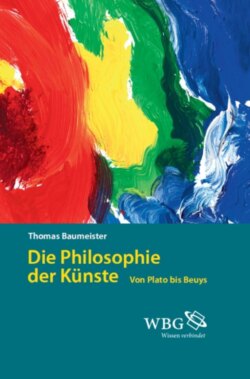Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Beispiele aus der Geschichte des Dramas
ОглавлениеDie Tragödiendichter haben über die Jahrhunderte hinweg die tragische Verschränkung von Schuld und Unschuld auf sehr verschiedene Weise zur Darstellung gebracht. Eine der klassischen Formen eines tragischen Konfliktes ist die Kollision zwischen gleichwertigen sittlichen Normen – wie er etwa bei Orest gegeben ist, der seinen Vater rächen und dabei seine Mutter töten muss. Auch der Konflikt zwischen Kreon und Antigone ist ein berühmtes Beispiel für diese Situation, die von Hegel als Kollision zwischen dem Recht des Einzelnen und der Familie und der Autorität des Staates gedeutet wurde. Man kann sich allerdings bei dieser Lesart fragen, ob Kreons Beschluss, Polyneikes unbegraben den Vögeln des Schlachtfeldes zu überlassen, wirklich politisch so zwingend ist, wie Hegel behauptet. Noch andere Faktoren spielen ja bei Sophokles eine Rolle: Kreons tiefe Abneigung gegen Ödipus und dessen Familie, das heftige Temperament, das ihm mit diesen gemein ist, all dies trägt zu seiner Verblendung bei. Auch bei Antigone nimmt der von ihr vertretene Standpunkt eine persönliche Färbung an. Es ist ihre schroffe und zugleich zarte Wesensart, eine Art Todestrieb in ihr, der Wunsch, mit ihren unglücklichen Verwandten vereint zu sein, all dies lässt sie alle Kompromisse abweisen.
In Aischylos’ Hiketiden wiederum ist der deutlich umrissene Konflikt nicht auf zwei Personen verteilt, sondern in eine Person verlegt, in die des Königs, der zwischen dem Gebot der Gastfreundschaft und der Verpflichtung, die eigene Polis nicht in Gefahr zu bringen, wählen muss – ein klassisches Beispiel für eine politische Wahlsituation. Loyalitätskonflikte wiederum, etwa der Konflikt zwischen Ehrgefühl und Liebe, sind bevorzugte Themen der tragédie classique eines Corneille.
Schuldlose Schuld ist auch dann gegeben, wenn ein Mensch in den Netzen einer todbringenden Leidenschaft gefangen ist, wie Phädra in Racines gleichnamigem Stück. Phädra, die Frau des Theseus, wird von der Liebe zu ihrem Stiefsohn wie von einer verzehrenden Krankheit befallen und geradezu vergiftet. Auch Shakespeares Othello zeigt, wie ein Mensch von edlem Charakter – als Mohr ist er ein Außenseiter in der venezianischen Gesellschaft – einer alles beherrschenden Leidenschaft erliegt und den Qualen der Eifersucht und den Einflüsterungen eines vermeintlichen Freundes zum Opfer fällt.
Shakespeares Tragödien und vor allem Historien entsprechen keineswegs den Richtlinien des Aristoteles. Anstatt den tragischen Verlauf der Handlung so konzentriert wie möglich zu präsentieren, wird dem Zufälligen, dem Episodischen und auch dem Tragikomischen breiten Raum gegeben. Indem die Gleichgültigkeit der Außenwelt gegenüber dem verhängnisvollen Geschehen unterstrichen wird, kann der tragische Effekt, anstatt abgeschwächt zu werden, sogar noch eine Steigerung erfahren. Shakespeare hat nicht gezögert, Bösewichter, Schurken und Toren in den Mittelpunkt der tragischen Handlung zu stellen, ganz im Gegensatz zu Aristoteles’ Kriterien für den rechten Tragödienhelden. Macbeth und Richard III. sind Verbrecher auf dem Königsthron, die jedoch durch ihren Stolz, ihre Tapferkeit und nicht zuletzt durch Shakespeares Sprache geadelt werden.
Dem Hamlet-Drama kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu. Auf das Episodische des Stücks, auf die Rolle, die in ihm der Zufall spielt, ist oft hingewiesen worden. Hamlet scheint noch weniger als Shakespeares andere Protagonisten die Statur eines tragischen Helden zu haben. Anstatt zu handeln, führt er närrische Gespräche mit den verschiedensten Personen, und wenn er handelt, geschieht das häufig in einer Aufwallung von explosiver Wildheit. Nun beruht sein Zögern gewiss auch darauf, dass er nicht mit Sicherheit weiß, wie sein Vater zu Tode gekommen ist. Ist der Geistererscheinung des alten Königs zu vertrauen? Hat Claudius ihn wirklich ermordet? Ungewissheiten, die das klassische Gegenstück zum Hamlet-Drama, die Oresteia nicht kennt. Hier ist die Ermordung des Vaters eine unbestreitbare, öffentliche Tatsache, und der Zweifel des Orest von Aischylos betrifft nur die Rechtmäßigkeit von Apollons Auftrag, den Tod des Vaters an der Mutter zu rächen. Doch als diese Bedenken beseitigt sind, hält ihn nichts mehr davon ab zu handeln. Anders jedoch steht es mit Hamlet: Auch als kein vernünftiger Zweifel mehr an dem Sachverhalt möglich ist, zögert er, zur Rache zu schreiten. Offenbar ist hier noch mehr im Spiel als die Ungewissheit über den Tathergang. Hamlet zaudert nicht zuletzt auch deshalb, weil er von der möglichen Tragik des menschlichen Handelns durchdrungen ist. Ist es Feigheit „or some craven scruple/of thinking too precisely on the event“ (IV/4), fragt Hamlet sich selbst angesichts seines Zögerns. Das Bewusstsein der Ungewissheit bezüglich der Folgen seines Handelns lähmt Hamlets Entschlusskraft. In diesem Sinne erscheint Shakespeares Stück als Tragödie über die Tragödie.
Das Hamlet-Drama hat noch einmal wie in einem Vergrößerungsglas das Thema der Tragödie erblicken lassen, wie es von Aristoteles gesehen wurde: Zum menschlichen Dasein gehört das mögliche Umschlagen von Absichten in ihr Gegenteil. Eine Exkursion in die Literaturgeschichte könnte deutlich machen, dass sich in der Tragödie sehr verschiedene historische Konstellationen widerspiegeln können. Das Aufkommen des modernen Gewissens, vielleicht sogar der düstere Hintergrund der Prädestinationslehre, gibt dem Hamlet-Drama seine spezifische, historische Farbe. Aischylos’ Oresteia dagegen entfaltet das Problem des Handelns in einer ganz anderen historischen Situation, nämlich auf dem Hintergrund des Entstehens einer Rechtsordnung und des Aufkommens der griechischen Polis. Die Tragödiendichtung des 19. und 20. Jahrhunderts wiederum neigt dazu, gebrochene, ja pathologische oder neurasthenische Charaktere in den Mittelpunkt zu stellen. Enge Moralauffassungen, Erbschicksale, die Ungunst beklemmender und beengender Umstände, Antriebsschwäche, das plötzliche Versagen der Nerven, ein unpassender Mitteilungsdrang sind wesentliche Faktoren der „tragischen“ oder tragikomischen Verwicklungen. Das 20. Jahrhundert mit seinen kollektiven Katastrophen schließlich war kein günstiger Nährboden für die Weiterführung der Tragödiendichtung. Dem Rückfall in kollektive Barbarei vermag wohl nur das Dokument, das unverblümte Lebenszeugnis, gerecht zu werden. Die Einsamkeit des tragischen oder gar des großen Individuums kann angesichts dieser Geschehnisse vermutlich nur obsolet und anachronistisch erscheinen.