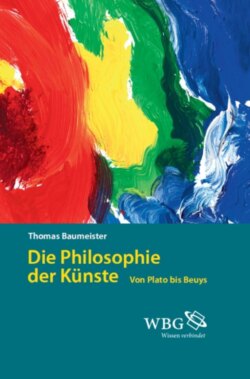Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Neuplatonismus zwischen gnostischer Weltverleugnung und heidnischer Weltverherrlichung
ОглавлениеDiese Konzeption, in der die Anerkennung der Schönheit der sinnlichen Welt und ihre Relativierung miteinander verschränkt sind, erlaubt es Plotin, sich gegen zwei in seinen Augen verderbliche Tendenzen abzugrenzen: gegen die vorbehaltlose Verherrlichung der Welt und der Sinnlichkeit einerseits, gegen die radikale Weltverleugnung der Gnostiker andererseits. Es ist diese Mittelposition zwischen zwei Extremen, die es dem Neuplatonismus möglich machte, zum Bundesgenossen des Christentums zu werden. Denn auch dieses sah sich genötigt, der heidnischen Weltbewunderung, die allerdings ebenfalls keineswegs vorbehaltlos war, entgegenzutreten, ohne jedoch in den Dualismus der Gnosis zu verfallen, die die materielle Wirklichkeit und die geistige Ordnung des Guten und des Göttlichen als zwei durch eine Kluft voneinander geschiedene Bereiche begriff. Der christliche Kampf gegen den gnostischen Dualismus hat in Plotin seinen Vorläufer.
Die Gnostiker streben – so Plotin – danach, das Göttliche von allen Erdenresten zu reinigen, indem sie das Göttliche und die uns umringende Wirklichkeit radikal voneinander trennen. Hiermit jedoch begrenzten sie auch das Vermögen der göttlichen, ordnungsstiftenden Kraft. Anstatt Gott von der Verunreinigung durch die Endlichkeit zu befreien, setzten sie ihn zu einem endlichen Wesen herab, dessen Kraft beschränkt sei – so der plotinische Einwand. Aber nicht genug hiermit: „Die Gnostiker verachten die Gesetze dieser Welt, die der Tugend“ und der Schönheit (Plotin, Enn., II, 9, 15). Denn aufgrund ihrer dualistischen Voraussetzungen sei in unserer menschlichen Wirklichkeit nichts von höherer oder göttlicher Art zu finden. Der Mensch, der in diese Welt der Finsternis geworfen ist, vermag daher das göttliche Ideal nie zu erreichen, ja vermag sich ihm noch nicht einmal anzunähern. Die sinnliche Lust müsse dieser dualistischen Theorie zufolge das Höchste sein, das der Mensch in seinem Leben erreichen könne. Die absolute Trennung des Geistigen vom Sinnlichen führt somit in den Augen Plotins zu einer Verabsolutierung der sinnlich-hedonistischen Lebensform.
Diese Konsequenzen sind für Plotin unannehmbar. Daher darf die materielle und sinnliche Wirklichkeit nicht als die Gegenmacht zum geistigen Prinzip verstanden werden, sondern als Stoff, der vom Geiste durchdrungen ist, obschon durch ihn wiederum auch die Reinheit des geistigen Lichtes getrübt und die Wirksamkeit des Ursprungs abgeschwächt wird. Plotin hat diesen erklärungsbedürftigen Sachverhalt in folgender schöner Formulierung zusammengefasst, die auch das Lebensgefühl seines Denkens bildhaft zum Ausdruck bringt. Er schreibt:
„Man stelle sich vor, wie die Seele [die Weltseele] gleichsam von außen in das unbewegte Himmelsgewölbe (insofern es noch unbeseelt ist, bewegt es sich noch nicht) hineinströmt, sich ergießt und von allen Seiten eindringt und alles erhellt; wie die Strahlen der Sonne eine dunkle Wolke, die durch ihr Licht getroffen wird, aufleuchten lässt und ihr ein goldglänzendes Aussehen gibt.“ (Plotin, Enn., V, 1, 8)
Die sich in diesem Passus manifestierende Empfänglichkeit für die Schönheit der Natur, vor allem die des Lichts, ist jedoch nicht der einzige Zug, wodurch Plotin und der Neuplatonismus für die abendländische Lehre vom Schönen wichtig geworden sind. Von zentraler Bedeutung sind daneben die folgenden drei Elemente, die teilweise schon erwähnt wurden und uns noch in der Folge beschäftigen werden:
– Der Neuplatonismus wird es dem Christentum möglich machen, die Tendenz zur Verinnerlichung mit der Bewunderung für die Wirklichkeit als Schöpfung zu verbinden, obgleich auf eine Weise, die von Spannungen beherrscht bleibt. Die Metapher, mittels derer versucht wird, diese Spannungen zu beheben, ist das Bild der Leiter, der Stadien der Wirklichkeit, die der Mensch zu durchlaufen hat, um in den Genuss der inneren Anschauung des Absoluten, ja der Einswerdung mit ihm zu kommen.
– Plotins Ontologie ist ähnlich wie die platonische und die aristotelische durch das Modell der techné, des Herstellens von Artefakten und somit durch den Begriff der Zweckmäßigkeit bestimmt. Jegliches Seiende wird als Ganzheit, als zweckmäßig organisierte Struktur betrachtet, die einem Vorbild, einem Urbild (eidos) gemäß entworfen ist oder jedenfalls im Lichte eines solchen eidos begriffen werden muss. Auch das Ganze des Seienden, die Natur (kosmos), muss als ein vom Logos beherrschtes Ganzes verstanden werden, dessen Zweck es ist, sich selbst zu erhalten. Die Bedeutung dieser ontologischen ‚Kunstlehre‘ blieb jedoch nicht auf die Natur beschränkt. Sie hat vor allem der Kunsttheorie im engeren Sinne die Begriffe zur Verfügung gestellt, die bis in die Neuzeit, ja bis in die jüngste Zeit vorherrschend bleiben sollten.
– Es wird häufig übersehen, dass das Plotins Denken bestimmende Streben nach Verinnerlichung auch eine verinnerlichte Schönheitsauffassung zur Folge hat, die von Plotin gegen die ‚pythagoreischen‘ Theorien des Schönen ins Feld geführt wird. Die Ausdrucksqualitäten von Blick und Antlitz, der Ausdruck des Seelischen, werden bei Plotin auf eine Weise betont, die seine Gedanken zum Schönen besonders anziehend erscheinen lässt und die spätere Leser an Hegels Ästhetik erinnern muss.
Im Folgenden sollen sowohl Plotins Auffassung vom Schönen als auch seine Theorie der Kunst im engeren Sinne des Wortes dargestellt werden. Doch ist es ratsam, diese Theorie in den Rahmen von Plotins Metaphysik des Einen zu stellen, weil nur auf diese Weise das metaphysische Prestige deutlich werden kann, das dem Schönen und der Kunst in der europäischen Kunsttheorie, die sich in den Spuren des Platonismus bewegte, zugesprochen wurde.