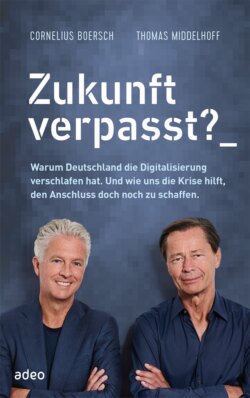Читать книгу Zukunft verpasst? - Thomas Middelhoff - Страница 10
Das große Monopoly-Spiel: Wie Deutschland auf den „Bahnhöfen“ sitzen blieb
ОглавлениеInnovationen im digitalen Bereich haben in vielen Fällen das Potenzial, sich schnell mit dem sich entwickelnden Markt zu verbreiten. Marketingtechnisch wird eine solche Verbreitung als „Diffusion“ bezeichnet. Häufig sind hierfür ein einheitlicher, in Teilen abgeschotteter Markt (China) oder ein großer, einheitlicher Sprachraum (englisch/USA/weltweit) eine wichtige Hilfe.
Dieses Phänomen konnten wir immer wieder beobachten. Beispielsweise vereinte AOL in dem Jahr seines Mergers mit TimeWarner knapp 80 Prozent des Internetverkehrs in den USA auf sich. Neben der Technologie und der leichten Zugänglichkeit, dem „ease of use“, war hierfür der ungeheure Marketingdruck ein entscheidender Faktor. Man sieht an diesem Beispiel aber auch, wie schnell eine gewonnene Marktposition technologiegetrieben und aufgrund falscher strategischer Weichenstellungen wieder verspielt werden kann.
Aus deutscher Sicht ist es heute eine fast schon dramatische Feststellung, dass all die Unternehmen, die im Jahr 2020 den Markt der digitalen Endkundenkontakte unter sich aufgeteilt haben und faktisch kontrollieren, entweder amerikanische oder chinesische Wurzeln haben. Abbildung 1 stellt diesen Sachverhalt bildhaft am Beispiel des weltbekannten Monopoly-Spiels dar. Klassische Werbemedien wie TV und Print stoßen bei jüngeren Zielgruppen zunehmend an ihre Grenzen. Alternativ bleibt deutschen Unternehmen nur die Möglichkeit, den Zugang zu diesen relevanten Zielgruppen über Plattformen wie Google oder Facebook zu erreichen. Dieses Monopol lassen sich die Gatekeeper teuer bezahlen.
Abbildung 1: Die deutschen Unternehmen haben die falsche Spielstrategie verfolgt und können nicht mehr gewinnen.
Jedem, der schon einmal Monopoly gespielt hat, ist eines deutlich: Man kann dieses Spiel nicht mehr gewinnen, wenn einer der Mitspieler die wenigen wichtigen Straßenzüge beherrscht. Die Miete, die fällig wird, wenn man zum Beispiel auf der mit Hotels bebauten Schlossallee landet, ist exorbitant. Deren Eigentümer hatten zu Beginn des Spiels nicht nur den Mut, diese Liegenschaften zu hohen Preisen zu kaufen, sondern haben diese anschließend unter Einsatz hoher Cash-Beträge durch den Bau von Hotels entwickelt. Und dank der starken Marktstellung kann der Eigentümer nun Nutzungsgebühren in exorbitanter Höhe aufrufen.
Ähnlich wie bei den absoluten Toplagen beim Monopoly gibt es im Internet nur wenige Top-Plattformen, die den Zugang zum Endkunden kontrollieren. In diesem Sinne hat das Internet trotz seiner dezentralen Architektur eine Tendenz zur Monopolisierung (Beispiel Amazon). Konzerne wie Amazon, Facebook, Alibaba, Google, Netflix, PayPal oder Tencent besitzen die digitalen Endkunden-Kontakte und zwar weltweit. Nicht ein einziges deutsches Unternehmen spielt in dieser Liga heute noch eine Rolle. Selbst das deutsche Aushängeschild Zalando kennt in den USA und China kaum jemand.
Die deutschen Unternehmen haben den eigenen und direkten Zugang zu den Endkunden im verlorenen Jahrzehnt verspielt. Die Konsequenz dieses sträflichen Versäumnisses besteht darin, dass die Gatekeeper jederzeit die Preise und Konditionen verändern können, zu denen sie den Zugang zu „ihren“ Kunden gewähren. Die aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Google und deutschen Medienunternehmen sind hierfür nur ein Beispiel.
Statt an den zukünftigen Wert der „Schlossallee“ zu glauben, haben sich deutsche Konzerne Anfang 2000 mit dem „Süd- oder Westbahnhof“ begnügt und fanden das damals in ihrer Naivität auch noch „très chique“. Allenfalls haben sich durch diese Vorgehensweise kurzfristig höhere Gewinne erzielen lassen. Aber selbst das stellen wir aufgrund unserer Beobachtungen infrage. Vielmehr wurden die handelnden Manager auf diese Weise zu Totengräbern ihrer eigenen Firmen, wie wir in den nachfolgenden Kapiteln zeigen werden.
Um bei der Monopoly-Analogie zu bleiben: Für die deutschen und europäischen Unternehmen sind in der digitalen Welt die billigen, aber wenig lukrativen „Bahnhöfe“ geblieben. Auch wenn sie jetzt mehrfach über „Los“ gehen, um ein wenig Cash zu generieren, können sie den Ausgang des Spiels nicht mehr zu ihren Gunsten verändern. Und wenn sie in dieser Spielphase die Ereigniskarte „Gehe ins Gefängnis“ ziehen, wird sie das für einen kurzen Zeitraum sogar freuen, entgehen sie so doch der Gefahr, sehr schnell wieder auf der mit Hotels bebauten Schlossallee zu landen.
Der vorhersehbare Ausgang des Spiels und die heutige Situation vieler deutscher Konzerne lässt sich mehr wirtschaftlich ausgedrückt wie folgt beschreiben: Viel mehr Alternativen, als auf die Regulierung und Zerschlagung der chinesischen und amerikanischen Mitspieler durch die Kartellbehörden oder auf technologische Innovationen und damit verbunden neue Anwendungen zu hoffen, scheinen ihnen aus heutiger Sicht nicht zu bleiben. Dies ist nun wirklich keine komfortable Situation. Allerdings eine, in die sie sich durch eigenverantwortliches, aber fehlgeleitetes Handeln während des verlorenen Jahrzehnts selbst hineinmanövriert haben.
Bei den meisten Strategieüberlegungen deutscher Konzerne um die Jahrtausendwende ging es vor allen Dingen darum, genau diese Gefahr abzuwenden. Man wollte nicht in der Situation enden, dass die Erreichung der Endkunden von Plattformen abhängig werden könnte, die von Dritten kontrolliert werden. So galt es beispielsweise bei Bertelsmann als strategisch unverzichtbar, den direkten Endkundenzugang zu sichern. Dieses Prinzip hatte bis Anfang 2000 Gültigkeit, insbesondere für digitale Plattformen, und war damals ein wichtiger Grund für die Kooperation mit Napster. Auch die New York Times ist dieser Strategie gefolgt, Anders als bei Bertelsmann haben allerdings ihre Gesellschafter die digitale Ausrichtung des gesamten Unternehmens bis heute gegen alle externen Widerstände beibehalten. Der heutige Erfolg der New York Times in der digitalen Welt, auch im Wettbewerb mit Google, ist der verdiente Erfolg dieser konsequenten Strategie und zugleich ein Lehrstück für alle deutschen Medienunternehmen.
In dem alten Geschäftsansatz „Club“ verkaufte Bertelsmann die Buchinhalte direkt an Club-Mitglieder. Die Denkweise, die mit diesem Geschäftsmodell verbunden ist, lässt sich ohne weiteres auf die digitale Welt übertragen. Ebenso wie in der alten Buchclub-Welt zahlten die AOL-Mitglieder auch in der digitalen Welt eine feste Monatsgebühr für die Nutzung ihres Services. Nichts anderes als genau dieses Geschäftsmodell betreiben heute Anbieter wie DAZN oder Netflix.
Ende März 2020 kommt beispielsweise Amazon Prime allein in Deutschland auf knapp 24 Millionen Mitglieder. Damit verfügt Amazon Prime in Deutschland nicht nur über einen größeren Mitgliederbestand als die Evangelische Kirche mit knapp 22 Millionen Mitgliedern, sondern ist auf diesem Wege an Bertelsmann vorbeigezogen, das vor noch 20 Jahren den Medienmarkt im Heimatland Deutschland beherrscht hatte.
Faktisch ist heute leider aufgrund der Verhaltensweisen der verantwortlichen Personen während des verlorenen Jahrzehnts genau das eingetreten, was strategisch als unbedingt zu vermeiden galt: Die deutschen Konzerne im Business-to-Consumer-Geschäft sind abhängig geworden von Gatekeepern, die sich, aus anderen Ländern kommend, nicht nur weltweit einen dominanten Marktanteil sichern konnten, sondern auch auf dem deutschen Markt. In einzelnen Teilbereichen haben sie zwischenzeitlich fast eine Monopolstellung erreichen können.