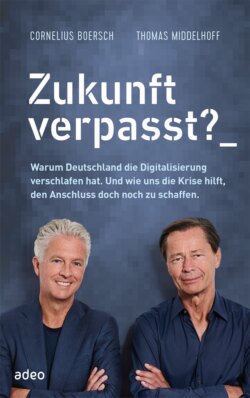Читать книгу Zukunft verpasst? - Thomas Middelhoff - Страница 15
Automobilindustrie: Volumen ist nicht alles
ОглавлениеUnd die Automobilindustrie, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft? Hier scheint die Welt im deutschen Sinne noch bestens geordnet. Allerdings nur auf den ersten Blick. Zwar steht VW endlich, nach jahrelangen Anstrengungen des ehemaligen Chefs Martin Winterkorn, auf Platz 1 des weltweiten Rankings nach Absatzzahlen. Doch Toyota, der langjährige Weltmarktführer, bewegt sich in Sichtweite. Die Differenz bei der jährlichen Produktion beträgt im Jahr 2019 knapp 200.000 Fahrzeuge, was, bezogen auf die Produktionskapazitäten der beiden Konzerne, einer Rundungsdifferenz (ca. zwei Prozent) entspricht. Als nächstgrößte deutsche Unternehmen im Ranking werden Daimler (erst) auf Platz 12 und BMW auf Platz 13 geführt.10
Als aus deutscher Sicht besorgniserregender muss allerdings ein anderer Vorgang bewertet werden: Im Listing der weltweit größten Automobilproduzenten liegt der chinesische Konzern Geely, der Volvo übernommen hat, nur knapp hinter BMW auf Platz 14. Dieser chinesische Konzern hat sich im Jahr 2018 mit 9,7 Prozent an Daimler beteiligt.11 Wir können uns schwer vorstellen, dass daraus einmal eine Überkreuzbeteiligung entstehen könnte, wohl aber, dass Geely versuchen wird, seine Beteiligung an Daimler aufzustocken.
Vertreter des Geely-Konzerns hatten Conny bereits vor einigen Jahren gefragt, ob man eine Beteiligung an der Daimler AG erwerben könne. Conny hielt dies damals für eine „Spinnerei“ und verwies seine Gesprächspartner an Investmentbanken. Vor einigen Monaten wurde bei einem Meeting mit Conny und Thomas in Hongkong von Investmentbankern, die für einen chinesischen Staatsfond tätig sind, sehr ernsthaft nach der Möglichkeit gefragt, ein größeres Aktienpaket von Daimler zu kaufen – unabhängig von der Beteiligung von Geely an Daimler. Auch dieses Beispiel verdeutlicht das große Interesse chinesischer Investoren an deutschen Technologien. Es scheint fast so, als wäre inzwischen fast jeder größere deutsche Mittelständler von chinesischen Investoren angesprochen worden.
Während die deutsche Automobilindustrie mit den Aufräumarbeiten der durch sie selbst verschuldeten Diesel-Affäre abgelenkt und belastet ist, arbeiten ihre internationalen Wettbewerber fieberhaft an neuen Konzepten und Geschäftsmodellen. Zwischenzeitlich entwickelt sich Geely mit seiner Marke Volvo zu einem ernsthaften Wettbewerber für die deutschen Premiumanbieter wie BMW, Audi und Mercedes, an dessen Mutterkonzern Geely beteiligt ist.
Mit einem Schuss Galgenhumor kann man die heutige Situation der Automobilindustrie, in die sie zum Teil unverschuldet, zum Teil aber durch eigenes Tun oder Unterlassen – Stichwort „Diesel“ – geraten ist, auch so beschreiben: Tesla, Diesel und Corona, das ist eine Katastrophe zu viel für die deutsche Automobilindustrie.
Dies kann natürlich dazu beigetragen haben, dass der Blick auf wichtige Veränderungen des Konsumentenverhaltens verstellt wurde. Immer mehr Automobilnutzer interessieren sich heute für Fractional Ownership-Modelle. Bei dieser Form des „partiellen Eigentums“ bezahlt ein Konsument nur für die tatsächliche Nutzungszeit eines Autos. Dieser Megatrend der Gesellschaft wurde von der Automobilindustrie zu spät erkannt, und es wurde zu spät darauf reagiert. Fehlende visionäre Mobilitätskonzepte der Automobilkonzerne führen nun zu einer planlosen, für uns fast verzweifelt anmutenden Initiative, in Start-ups zu investieren. Als Beispiele hierfür stehen die Konzerne Daimler und Bosch.
Dabei wird aber nicht der eigentlich wichtigsten Frage nachgegangen: „Wann werden wir den Spaß an Autos verloren haben?“ Wahrscheinlich ist dies eine Frage, die man im „Autoland“ Deutschland nicht ohne Gefahr für Leib und Leben stellen darf, während sich junge Menschen tatsächlich immer häufiger fragen, ob die Anschaffung eines Autos wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch überhaupt noch vertretbar ist.
Im Bereich der Automobilzulieferer besitzen deutsche Unternehmen eine deutlich bessere Positionierung und sind im weltweiten Ranking mit Bosch, Continental und ZF Friedrichshafen auf den Plätzen 1, 2 und 5 vertreten. Allerdings operieren die Zulieferer in der Regel als eine Art verlängerte Werkbank für die Automobilindustrie. Geht es dieser wirtschaftlich schlecht oder verschläft sie eine technologische Entwicklung – wie zum Beispiel den Elektroantrieb –, dann leidet die Zulieferindustrie überproportional. Hat die Automobilindustrie sozusagen Husten, dann liegen die Zulieferer mit Influenza im Bett.
Das Management von Continental hat dies unter Beweis gestellt, als es im Herbst 2019 den Abbau von 28.000 Stellen ankündigte. Man stehe bei Continental zwei verschiedenen Herausforderungen gegenüber: Die Produktion für Teile der Motorenherstellung (Verbrennung) und für herkömmliche Getriebe müsse zurückgefahren und zeitgleich die Fertigung neuer Komponenten (Elektro mit entsprechenden Antriebssträngen) entwickelt und neu aufgebaut werden. Nur zur Verdeutlichung der Tragweite dieser von Continental angekündigten Stellenabbau-Zahl: Sie entspricht der Menge der insgesamt bei Kaufhof und Karstadt beschäftigten Mitarbeiter. Damit wurde zugleich den zarten Entwicklungen zu mehr Digitalisierung und Investitionen in Start-ups ein abruptes Ende bereitet. Und Experten erwarten darüber hinaus eine Flut von Insolvenzen im Bereich der Automobilzulieferer, wenn die ersten Hilfspakete zur Abfederung der Corona-Auswirkungen ausgelaufen sind.
Fazit: Für alle deutschen „Vorzeigeunternehmen“ gilt, dass sie während des verlorenen Jahrzehnts nicht nur Wettbewerbskraft durch falsche Strategien eingebüßt haben, sondern darüber hinaus im internationalen Vergleich zum Teil dramatisch zurückgefallen sind. Während internationale Wettbewerber in diesem Zeitraum auf die Digitalisierung setzten, übten sich deutsche Konzernchefs in der Rolle rückwärts.
Die Konsequenzen dieses „kollektiven Fehlers“ werden bei den deutschen Konzernen im vor uns liegenden Jahrzehnt bis Ende 2030 schmerzlich zu spüren sein. Auch ein kurzfristiges Gegensteuern wird die Auswirkungen nicht mehr korrigieren können. Die Früchte von Programmen, die heute eingeleitet werden, können nach dem Phänomen der Entkoppelung von Ursache und Wirkungen erst in zehn Jahren deutlich sichtbar werden.