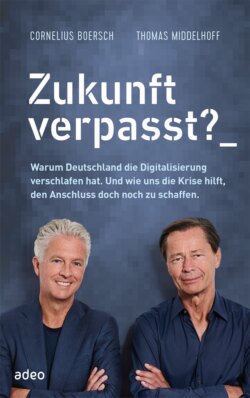Читать книгу Zukunft verpasst? - Thomas Middelhoff - Страница 12
Metro und Amazon – Wie Jeff Bezos den Handelsriesen entzauberte
ОглавлениеBereits ab Mitte der 1990er-Jahre begannen sich Otto Beisheim, der legendäre Gründer der METRO, und Erwin Conradi, ein herausragender Manager, mit Internetgeschäften und den damit verbundenen Chancen für den Handel zu beschäftigen. Sie sahen im Internet ein großes Potenzial für unternehmerische Aktivitäten im Allgemeinen wie auch für die Geschäftsfelder der METRO im Speziellen, ähnlich wie Mitte der 90er-Jahre einem Reinhard Mohn das Potenzial des Internets für ein Medienunternehmen nicht lange erklärt werden musste.
Obgleich Beisheim dem Internet positiv gegenüberstand und mit der Scout-Gruppe das Zukunftsthema „Classified“ – vergleichbar mit den früheren Kleinanzeigen – erfolgreich besetzte, bestand im Management der METRO AG, deren Vorstandsvorsitz auf Hans-Joachim Körber übergegangen war (1996 als der Sprecher des Vorstands, 2001 als dessen Vorsitzender), eine skeptische Haltung gegenüber der neuen Technologie. Das Beispiel Beisheim zeigt, dass Modernität nicht zwangsläufig etwas mit dem Alter zu tun hat. Wenn Beisheim ein neues internetbasiertes Geschäftsmodell vorstellte, spotteten Teile des METRO-Managements: „Der Alte bringt uns schon wieder so ein Ding an.“
Das METRO-Management sah die Zukunft des Konzerns vor allen Dingen im Stammgeschäft Cash & Carry – dem Modell eines Abholmarkts für Firmen, Freiberufler, Gastronomie etc. – und wollte sich daher vornehmlich auf dessen Internationalisierung konzentrieren. Daneben warf die Beteiligung am stationären Elektronikhandel Media-Saturn zum damaligen Zeitpunkt hohe Gewinne ab.
Anfang 2000 zählte der METRO-Konzern mit einem Umsatz von knapp 47 Milliarden Euro zu den führenden Händlern weltweit. Er wurde in einem Atemzug mit Walmart und Carrefour genannt, seinen damals größten Wettbewerbern. Alles schien ausgelegt auf einen Dreikampf dieser Unternehmen mit amerikanischen, französischen und deutschen Wurzeln. Bis 2005 wuchs der weltweite METRO-Umsatz auf 55 Milliarden Euro. Im Jahr 2010 erreichte er ca. 67 Milliarden bei mehr als 280.000 Mitarbeitern weltweit.5
Die METRO-Welt wirkte zu diesem Zeitpunkt bestens geordnet. Der Fokus auf die Stammgeschäfte und die bewusste Zurückhaltung des Managements gegenüber dem Internet schien sich zu diesem Zeitpunkt noch als die richtige Strategie zu erweisen. Dennoch gab es erste Warnsignale: Die Umsatzentwicklung begann sich erkennbar zu verlangsamen. Wachstum war auf bestehender Fläche nicht mehr ohne größere Anstrengungen zu erwirtschaften.
Die Rückschläge im einstigen „Brot-und-Butter-Geschäft“ Cash & Carry wogen immer schwerer. An der Börse wurde die METRO schließlich zu einem Übernahmekandidaten und erreichte Ende 2019 eine Marktkapitalisierung von nur noch 5,2 Milliarden Euro. Das einst stolze Unternehmen hat heute nach dem Rückzug der Familie Haniel einen neuen Großinvestor: Ein in Deutschland unbekannter tschechischer Unternehmer entscheidet jetzt, wie es mit der METRO weitergeht, die im Ranking der weltweit größten Handelsunternehmen auf die hinteren Plätze gerutscht ist,.
Das METRO-Management hatte viel zu lange an dem Irrglauben festgehalten, das Internet besäße keine Relevanz für ihr Handelsgeschäft. Dieser Fehler wurde vor allem zwischen 2000 und 2010 gemacht. Zu spät wurde die ganze Tragweite dieser Fehleinschätzung erkannt. Zumindest bei Media-Saturn versuchte man, die Versäumnisse durch den Aufbau einer Online-Strategie aufzuholen. Eine strategische Korrektur, die auch dort viel zu spät kam. Völlig überteuert und ohne Verständnis für eCommerce wurden Internetfirmen aufgekauft. Amazon war längst nicht mehr aufzuhalten. Die METRO AG hat, wie zahlreiche andere Unternehmen auch, ihre Zukunft während des verlorenen Jahrzehnts verspielt.
Der SPIEGEL fasste diesen Sachverhalt am 21. Februar 2020 unter der Headline zusammen: „Der Jahrhundertfehler, unter dem Karstadt und METRO bis heute leiden“. Völlig richtig stellt der SPIEGEL hierzu in seinem Beitrag fest: „Vor 20 Jahren platzte die Dot-Com-Blase. Große deutsche Handelskonzerne machten damals ihre Internetshops dicht. Davon haben sie sich nie erholt.“6
Dies wird ganz besonders deutlich, wenn man sich die Entwicklung von Amazon während eben dieses Jahrzehnts vor Augen hält. Amazon wurde 1994 von Jeff Bezos in Seattle gegründet. Der Geschäftsbetrieb in Deutschland begann 1998, zunächst mit dem Versand von Büchern und wenig später von CDs und DVDs. Seit 2003 werden auf der Amazon-Plattform immer neue Shops gestartet, von Garten- über Heimwerkerbedarf bis hin zu Küchenmöbeln, Wein und Beauty-Produkten. Gleichzeitig entwickelte Amazon ab Ende 2000 sein Digitalgeschäft weiter. Amazon Music und Amazon Prime stehen hierfür heute als Beispiel.
Im Jahr 2000 beschäftigte Amazon weltweit noch keine 10.000 Mitarbeiter, 2005 waren es schon 12.000 und im Jahr 2010 über 33.000. Während die METRO seit 2010 beim Umsatz zunächst im Krebsgang abwärts und später im freien Fall unterwegs war, kennt Amazon nur eine Richtung: weit überwiegend organisches und exponentielles Umsatzwachstum. Heute beschäftigt das US-Unternehmen mehr als 840.000 Mitarbeiter, und der Umsatz wuchs von 15,7 Millionen US-Dollar im Jahr 1996 über 34,2 Milliarden 2010 bis auf 280,5 Milliarden 2019. Die Umsatzzahlen für das laufende Jahr 2020, in dem Amazon weltweit als größter Profiteur von Corona gilt, lassen wiederholt einen großen Sprung erwarten. In Deutschland allein betrug der Marktanteil von Amazon am Online-Handel im Jahr 2019 knapp 50 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Konzerns hatte am 4. Februar 2020 bereits 1 Trillion US-Dollar überschritten und liegt am 17. Juni 2020 bei 1,3 Trillionen! Damit ist Amazon um den Faktor 250 wertvoller als METRO. 7
Abbildung 2: Aktienkursentwicklung Amazon und METRO AG im Zeitablauf der letzten 20 Jahre. Schraffierte Fläche: „Goodwill“, der die Einschätzung des zukünftigen Wachstums von Umsatz und Ertragskraft des Geschäftsmodells widerspiegelt.
Nach dem Zusammenbruch des Neuen Marktes im Jahr 2000 hätte die METRO ein Internetunternehmen wie Amazon ohne größere Anstrengungen übernehmen können, zur Not auch feindlich. Die damalige Fehleinschätzung, die wohl auch auf dem Hochmut des Managements beruhte, verhinderte, dass es überhaupt zu derartigen Überlegungen kam. Mit für die weitere Entwicklung des Konzerns dramatischen Folgen.
Amazon wächst weltweit und besitzt Skaleneffekte, die, abgesehen von Alibaba, kein anderes Handelsunternehmen der Welt erreichen kann. Amazon könnte die Übernahme der METRO heute sprichwörtlich aus der Portokasse finanzieren. Es ist sicherlich keine Arroganz von Jeff Bezos, dies nicht zu tun. Amazon steht unter wirtschaftlicher Perspektive mit seinem Geschäftsmodell weltweit für Zukunft und Wachstum, die METRO hingegen für eine untergehende Welt des tradierten Handels.
Allerdings sollte an dieser Stelle auch vermerkt werden, dass Amazon andererseits in kritischen gesellschaftlichen Debatten immer stärker für modernes Ausbeutertum hinsichtlich der Arbeitsbedingungen steht, für Rücksichtslosigkeit, Belastung der Umwelt und für fehlende Moral – unter diesem Blickwinkel also ein Geschäftsmodell betreibt, das Gefahr läuft, in diesem aktuellen Jahrzehnt rapide an Zustimmung zu verlieren!
Leider scheinen deutsche Handelsmanager aus den Fehlern der Vergangenheit bis heute nicht viel gelernt zu haben. Im Mai 2020 gab der Chef der deutschen Otto Group, früher Otto Versand genannt, einer deutschen Wirtschaftszeitung ein ausführliches Interview. Diese Gelegenheit der öffentlichen Aufmerksamkeit nutzte er, um eine aus Sicht des Otto Versands fundamental wichtige Sache klarzustellen: Amazon sei völlig überbewertet, sagte er sinngemäß, Alibaba sei technologisch deutlich weiter.
Was immer auch den Mann zu dieser kühnen Aussage verführt hat, so viel ist jedenfalls klar. Die Otto Group, die 2005 noch größer war als Amazon, ist in den letzten Jahren auf Rang 83 (!) der weltweit größten Handelsunternehmen abgerutscht.
Normalerweise sollte man annehmen, dass sich das Management, das für eine solche, sagen wir einmal „schwierige Entwicklung“ verantwortlich ist, kritisch fragt, was man selbst vielleicht falsch gemacht hat. Nicht so in Deutschland. Hier wird lieber der Gegner schlechtgeredet, der einen in spektakulärer Weise überholt hat.
Unter den weltweit 100 größten Handelsunternehmen rangiert die Schwarz-Gruppe (Lidl) auf Rang 5, Aldi auf Rang 8, EDEKA auf Rang 17, REWE auf Rang 19, METRO auf Rang 26, Ceconomy (Media-Saturn) auf Rang 40 und Otto auf Rang 83. Der deutsche Discount-Handel (Aldi und Lidl) ist damit das erfolgreichste Exportmodell des deutschen Handels. Zwar spielte bislang das Internet im Discount-Bereich keine nennenswerte Rolle; es sind aber Entwicklungstendenzen erkennbar, die eine Übertragung des Discountprinzips auf das Internet wahrscheinlich machen: begrenztes Sortiment, schneller Umschlag, reduzierter Service, niedrige Kalkulationsspannen. Conny hat gerade in ein solches Modell in Mexiko mit dem Namen Jüsto investiert, das vor einigen Monaten mit 60 Millionen US-Dollar eine der höchsten Seed-Bewertungen (Wertansatz bei erster Finanzierung) erreichte, die bislang in Lateinamerika erzielt werden konnten.
Wir können uns bei allem Respekt vor der jeweiligen unternehmerischen Leistung nicht vorstellen, dass die Schwarz-Gruppe – auch wenn sie seit Mai 2020 interessierten deutschen Unternehmen Cloud Services anbietet – oder Aldi, die international vergleichsweise wettbewerbsfähig positioniert sind, als Konsolidierer auf dem Handelsmarkt der Zukunft auftreten werden. Diese Unternehmen haben keinen Zugang zum Kapitalmarkt. Der finanzielle Spielraum reicht zwar aus, um das organische Wachstum, Internationalisierung und Neueröffnungen zu finanzieren, gibt aber keinen Spielraum für größere Akquisitionen in einer zunehmend digitalisierten Handelswelt.