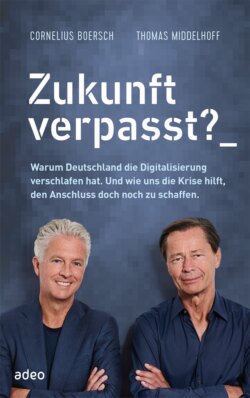Читать книгу Zukunft verpasst? - Thomas Middelhoff - Страница 16
BLICK ZURÜCK: WIE DER ZUSAMMENBRUCH DES NEUEN MARKTES EINE GANZE NATION WIEDER ZU DIGITALEN ANFÄNGERN MACHTE
ОглавлениеSchon einige Zeit vor unserer gemeinsamen Reise nach China haben wir uns mit folgender Frage beschäftigt: Lässt sich ein Zeitpunkt oder ein Ereignis benennen, das nachhaltig negativ auf die beginnende Entwicklung der Digitalisierung in Deutschland gewirkt hat? Schließlich waren wir von Anfang an Augenzeugen und nahe Beobachter dieser Vorgänge, wenn auch in unterschiedlichen Rollen.
Schnell fanden wir auf diese Frage die einzig logisch erscheinende Antwort: Der „Neue Markt“, sein Aufstieg und sein Zusammenbruch war der Auslöser des verlorenen Jahrzehnts für Deutschland und hatte damit einen nachhaltig negativen Einfluss auf die Fortführung der Digitalisierung hierzulande. Die Gründe hierfür sind überraschend vielfältig. Und es ist aus unserer Sicht sehr lehrreich, sich damit auseinanderzusetzen, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein.
Wir waren damals persönlich dabei, als die Gier jegliche Vernunft fortzuspülen begann. Und später, als die Börsen-Party vorbei war, erlebten wir, dass statt ehrlicher Ursachen- und Fehleranalyse der Stab über fast alle digitalen Geschäftsansätze gebrochen wurde. Alles Neue war verdächtig, wohl auch um von eigenem Versagen und eigener Gier abzulenken.
Wir erinnern uns noch sehr genau an den steilen Aufstieg und späteren tiefen Fall des Neuen Marktes. Die maßgeblichen Akteure kennen wir zum Teil persönlich, und wir wissen auch, wer für den nachfolgenden Kehraus verantwortlich ist. Er wurde fast wie ein Glaubenskrieg geführt. Die ehrlichen Befürworter der Digitalisierung, die deren Vorteile für die Wirtschaft und Gesellschaft erkannten, standen den konservativen Bewahrern gegenüber, die technologischen Entwicklungen gegenüber grundsätzlich skeptisch eingestellt sind. Wie so oft in dem Missverständnis, dass in einem Konflikt nur Schwarz und Weiß gesehen werden.
Erinnern wir uns aber zunächst an die frühen Anfänge. Geradezu euphorisiert durch die rasante Entwicklung der US-Technologiebörse NASDAQ wurden in der Bundesrepublik Anfang der 90er-Jahre die Stimmen im Finanzbereich, bei Investoren und in der Wirtschaft immer lauter, die sich dafür einsetzten, auch an der Deutschen Börse ein Wachstumssegment nach dem US-Vorbild einzurichten. Grundsätzlich betrachtet ein hervorragender und richtiger Ansatz, auch aus unserer heutigen Sicht.
1971 gegründet, entwickelte sich die NASDAQ ab Mitte der 90er-Jahre mit beeindruckendem Tempo. Die 1.000-Punkte-Marke wurde am 17. Juli 1995 erreicht, die 2.000-Punkte-Marke am 16. Juli 1998, und am 10. März 2000 beendete die NASDAQ den Handel mit einem Allzeithoch von 5.048,62 Punkten. Das entspricht einer Steigerung seit ihrem Start von 4.948,6 Punkten.
Seit Bestehen der NASDAQ werden dort bis heute die Aktien „echter“ Technologiefirmen eingeführt und gehandelt, unter anderem Microsoft, Amazon, Apple, Facebook oder Google. Am 12. Juni 2020 sind schon zwei dieser fünf Firmen zusammen in ihrer Börsenkapitalisierung größer als der gesamte deutsche Prime Index DAX, MDAX und TecDax zusammen, und Amazon allein ist mehr wert als der gesamte DAX. Zudem sind chinesische und amerikanische Firmen heute deutlich stärker kapitalisiert als deutsche. Nichts verdeutlicht Deutschlands Dilemma mehr als diese Zahlen.
Abbildung 7: Marktkapitalisierung der führenden amerikanischen Technologiekonzerne im Vergleich mit dem DAX.
Neben der New York Stock Exchange (NYSE) wurde die NASDAQ zum führenden Börsenplatz in den USA, an dem heute über 3.000 Unternehmen gelistet sind, überwiegend solche, die dem Technologiesektor zuzurechnen sind.
Die starken Kursgewinne an der NASDAQ eröffneten nicht nur für Anleger attraktive Gewinnchancen, sondern zogen international zunehmend Kapital in Richtung des Finanzplatzes New York ab. Das konnte aus deutscher Sicht nicht im Interesse des Börsenplatzes Frankfurt sein. Die Forderung, einen eigenen Technologiesektor an der Börse nach US-amerikanischem Vorbild einzuführen, als Versuch, eine weitere Kapitalabwanderung zu verhindern (verbunden mit dem damaligen Umstand, dass deutsche Unternehmensgründer anders als in den USA kein ausreichendes Startkapital fanden), wurde ab Mitte der 1990er-Jahre auch von der Politik aufgegriffen und fand sogar den Weg in die Wahlprogramme der Volksparteien.
Euphorie breitete sich aus und erfasste auch uns. Dem Unternehmergeist von Gründern, die bisher oftmals für ihre risikobehafteten Projekte keine Finanzierung erhalten hatten, stand das Interesse der Anleger gegenüber, Technologiewerte zu finden, die hohe Renditen versprachen. Sie suchten in der Heimat nach ähnlichen Renditen, wie die NASDAQ sie bot. Und das Bemühen der Investmentbanker, Berater etc., neue einträgliche Einnahmequellen zu finden, war mindestens so groß wie die Gier der Anleger. Dies sollte sich auf die Entwicklung technologiebasierter digitaler Geschäftsmodelle fatal auswirken.
Warum?
1997 wurde der Neue Markt als ein Segment der Deutschen Börse eingerichtet. Zwar sollte er nach dem Verständnis seiner Gründungsväter als Technologiesektor seinem amerikanischen Pendant entsprechen. Aber schon bei der Namensgebung wurde deutlich, was von den Initiatoren gewollt war: Das Branchenkriterium der an der neuen deutschen Technologiebörse zu handelnden Unternehmen sollte möglichst weit ausgelegt werden, um möglichst viele Unternehmen und Anleger anzusprechen.
So redete man im Zusammenhang mit dem Neuen Markt auch gern von Unternehmen der „New Economy“, wobei allerdings diffus blieb, was man unter diesem Begriff zu verstehen hatte. Den Begriff „Technologieunternehmen“ kann man im Zweifel validieren, unter den Terminus „New Economy“ hingegen konnte so ziemlich alles subsumiert werden.
Die Zielsetzungen, die ursprünglich mit dem Neuen Markt verbunden wurden, waren ohne Frage für die Zukunftssicherung unseres Landes genau die richtigen. Als Konsequenz brachte der Neue Markt in seiner Anfangsphase Unternehmen hervor, die bis heute als bedeutende Technologieunternehmen operieren. Zu ihnen zählen T-Online, Software AG, Evotec, Freenet, Medigen, Mobil.com, Singulus, United Internet etc. Diese Entwicklung war ohne Frage ein Verdienst der Initiatoren des Neuen Marktes, und dieser befand sich zunächst auf einem guten Weg.
Die von Conny gegründete ACG, ein Unternehmen, das auf Chipkarten spezialisiert war, hatte ihren IPO im Juni 1999. Der Peak der Marktkapitalisierung lag bei über 2,0 Milliarden Euro und einem Umsatz von 300 Millionen Euro. So wurde die ACG schnell Mitglied im Premiumsegment des Neuen Markts, DMAX 50. Ob Glück, Fortune oder Intention: Conny verkaufte den Großteil seiner Anteile an der ACG im März 2000, nur wenige Tage vor dem Zusammenbruch des Neuen Marktes. Einen Großteil der Erlöse reinvestierte er bis heute weltweit in über 350 Start-ups. Als Conny feststellte, dass „ACG an der Börse fast genauso hoch bewertet wurde wie Porsche“, gab es für ihn nur einen Erklärungsansatz: „Am Neuen Markt läuft etwas fundamental schief.“
Die Erklärung hierfür war eigentlich denkbar einfach: Neben den Technologiefirmen waren am Neuen Markt später mehr und mehr Unternehmen aufgetreten, die dort zwar ein Listing anstrebten, tatsächlich aber keinen wirklichen Technologiebezug hatten. Vielmehr suchten Unternehmen beispielsweise aus der Film- und TV-Branche durch ein Listing am Neuen Markt nach billigen oder zusätzlichen Finanzierungsquellen. Mit dem an der Börse eingesammelten Geld sollte in diesen Fällen eben nicht die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle vorangetrieben, sondern die Finanzierung gesichert werden für die Übernahme von Filmrechten oder anderen Unternehmen. Die EM-TV AG mag hierfür ebenso als Beispiel stehen, wie Edel Music, Senator oder Kinowelt. Der Neue Markt war von Spekulanten, die eigentlich wenig mit digitaler Technologie zu tun hatten, gekapert worden.
So konnte es geschehen, dass beispielsweise auch die Refugium AG, ein Altenheimbetreiber, über Nacht zu einer „Technologiefirma“ wurde. Sie und andere erreichten nicht nur ihr Listing, sondern Höchstbewertungen an der deutschen Technologiebörse „Neuer Markt“.
Während in den USA an der NASDAQ bis heute ein klarer Technologiebezug im Vordergrund steht, der auch beim Filing für einen IPO detailliert nachzuweisen ist, interessierten sich in Deutschland weder die Banken noch die Anwaltskanzleien, weder die Beratungsunternehmen noch die Börsenaufsicht für die einfache Frage, ob wirklich Technologieunternehmen mit einem tragfähigen Geschäftsmodell an die Börse gebracht werden sollten. Von der Bilanzqualität der einzelnen IPO-Kandidaten ganz zu schweigen. Das Börsenfieber hatte jeden gepackt. Wir erinnern uns an eine Zeit, als die Taxifahrer uns nicht nach dem Zielort unserer Reise fragten, sondern danach, in welche der anstehenden Börsengänge sie als Privatpersonen investieren sollten.
Gier macht bekanntlich dumm. Und viele Teilnehmer des Neuen Marktes verhielten sich aus schierer Gier zunehmend kurzsichtig und dumm: die Anleger, die ohne ausreichende Prüfung bereit waren, viel Geld in Euphorie zu investieren; die Deutsche Börse, die ihren Aufgaben der Prüfung und Regulierung nicht ausreichend nachkam, nur um international im Wettbewerb bestehen zu können; die Unternehmen, die glaubten, mit Fiktion statt Fakten problemlos und dauerhaft Geld einsammeln zu können; die Kriminellen, die ihre Bilanzen fälschten und über Presse- und Ad-hoc-Meldungen das Geld der Investoren lockermachten – und dann verzockten. Und last but not least die Politiker, die sich in dem Gefühl sonnten, mit dem Börsenerfolg der vermeintlichen „New Economy“ internationale Anerkennung und Wählerstimmen zu bekommen.
Sie alle – und auch wir – sind mitverantwortlich für das, was dem vorhersehbaren Crash nach dem Höchststand des Nemax am 10. März 2000 folgte. Der Nemax verlor bis zum 9. Oktober 2002 96 Prozent seines Wertes, was einer Summe von ca. 200 Milliarden Euro entspricht. Auf den Wertverlust folgte ein dramatischer Vertrauensverlust. Und aus heutiger Sicht ist dieser für die zukünftige Wettbewerbskraft unseres Landes eine größere Hypothek als die damalige – in ihrer Konsequenz übertriebene – Wertkorrektur.
Die Öffentlichkeit setzte in Unkenntnis der wirklichen Gründe dieses Börsen-Desasters die „New Economy“ mit Technologie und Digitalisierung gleich. Ab sofort waren neue Technologien suspekt. Die Akteure, die vorher den Neuen Markt gepusht und dort in den guten Tagen viel Geld verdient hatten, drehten sich über Nacht um 180 Grad. Technologie wurde verteufelt und mit Spekulantentum gleichgesetzt, und die am Neuen Markt gelisteten seriösen Technologiefirmen bekamen nach dessen Zusammenbruch durch das Treiben einzelner Scharlatane erhebliche Probleme.
In seinem großartigen Buch The Big Short hat Michael Lewis die Ursache für das Platzen einer ähnlichen Blase im Immobilienbereich gut acht Jahre später beschrieben. Fehler und spekulative Ursachen hat er dort klar herausgearbeitet. Als der Subprime-Hype (verbriefte Hypotheken) zu einem Ende kam, standen dramatische Wertverluste fest, die das weltweite Finanzsystem erschütterten. Der Immobilienbereich erfuhr eine radikale Wertkorrektur, aber im Unterschied zum Neuen Markt waren die Investoren bereit, trotzdem weiter in Immobilien zu investieren. Dagegen war der Finanzmarkt in Deutschland über lange Jahre für digitale Geschäftsmodelle nicht mehr existent, und darüber hinaus wurde der Markt für neue Ideen von Start-up-Gründern trockengelegt.
Statt eine fundierte Ursachenanalyse zu betreiben, suchte man die Schuld an diesem Desaster genau bei jenen Personen, die meist gar keine Verantwortung dafür trugen. Die Gründer echter Internet-Unternehmen waren ab diesem Zeitpunkt gesellschaftlich genauso suspekt wie später nach der Lehman-Pleite auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 der gesamte Berufsstand der Investmentbanker.
Stephan Schambach, der Gründer von Intershop, einem Unterneh-men, das Standardlösungen für eCommerce entwickelte, wäre nach unserer festen Überzeugung heute einer der positiven Leuchttürme, die in Deutschland fehlen – hätte ihn nicht die öffentliche Verfolgung von digitalen Unternehmern, die dem Zusammenbruch des Neuen Marktes folgte, gezwungen, in die USA auszuwandern.
Fazit: Der Neue Markt war von seiner Zielsetzung her grundsätzlich sinnvoll. Deutschland war bis zum Crash des Neuen Marktes einer der Pioniere für digitale Geschäftsmodelle. Zumindest in Europa waren wir damals führend. Die Intention war gut, die Ausführung leider schlecht. Es ging viel zu schnell. Die Prozesse hätten besser reguliert werden müssen. Man stelle sich vor, wo Deutschland heute stehen würde, wenn man nicht nach dem Scheitern des Neuen Marktes rundweg alle Technologien verteufelt hätte. Die Entwicklung der Digitalisierung erfuhr dadurch hierzulande einen Setback, der schwerer wiegt als der nominelle Wertverlust des Neuen Marktes nach seinem Crash. In der Bundesrepublik stand man Digitalisierung und Internet-Geschäftsmodellen fortan skeptisch bis ablehnend gegenüber. Und an diesem Punkt begannen wir, den Anschluss zu verlieren. Denn leider erfolgte auch die Aufarbeitung dieses Desasters mit deutscher Gründlichkeit. Dabei schoss man „etwas“ über das Ziel hinaus.