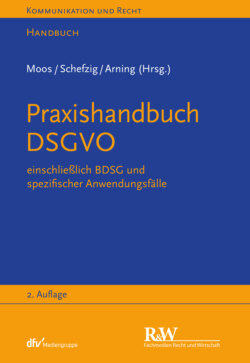Читать книгу Praxishandbuch DSGVO - Tobias Rothkegel - Страница 61
II. Die Grundsätze im Einzelnen 1. Rechtmäßigkeit und Verarbeitung nach Treu und Glauben
Оглавление4
Die Prinzipien der Rechtmäßigkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 1 DSGVO und der Verarbeitung nach Treu und Glauben gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 2 DSGVO prägen die Struktur der DSGVO in besonderem Maße. Wegen des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit bedarf jede Datenverarbeitung einer Rechtsgrundlage i.S.d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 DSGVO.3 Dieser Rechtsgedanke wird „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ genannt – grundsätzlich ist deshalb jede Verarbeitung verboten, soweit nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO (oder einer anderen Rechtsvorschrift) keine Erlaubnis existiert.
5
Zu den häufigsten Rechtfertigungsgründen gehören die Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Erfüllung des Vertragszwecks nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie die Verarbeitung aus Gründen berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.4 In Sonderkonstellationen müssen dabei zusätzliche Rechtmäßigkeitsanforderungen eingehalten werden, etwa die Voraussetzungen an die Rechtmäßigkeit einer (wirksamen) Einwilligung (Art. 4 Nr. 11, Art. 7 DSGVO), die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) und/oder die Übermittlung in Drittländer (Art. 44ff. DSGVO).5
6
Eine genauere Definition des Bedeutungsgehalts der Verarbeitung nach Treu und Glauben gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 2 DSGVO existiert nicht.6 Allerdings lassen sich aus dem inhärenten Fairnessgebot verschiedene für die Praxis relevante Fallgruppen potenzieller Verstöße bilden, die eine Annäherung ermöglichen: Grundsätzlich ist eine „faire“ Datenverarbeitung gegeben, wenn durch den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter keine unzulässige Rechtsausübung zu einem beachtlichen Nachteil des Betroffenen stattfindet.7
Beispiel
Verstöße gegen das Fairnessgebot liegen beispielsweise vor, soweit
– der Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten die durch den Verantwortlichen geweckten Erwartungen des Betroffenen massiv übersteigt – etwa bei heimlichen Verarbeitungen;8
– Wertungen der Europäischen Grundrechtecharta unterminiert werden;
– die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Personen i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO unberücksichtigt bleiben;
– das (allgemeine) Kopplungsverbot nach Art. 7 Abs. 4 DSGVO missachtet wird9 und/oder
– die Abhängigkeit im Beschäftigungsverhältnis unberücksichtigt bleibt.10
Denkbare Anwendungsfälle können sich aus dem Einsatz bzw. der Verknüpfung verschiedener (innovativer) Technologien oder auch aus unvorhersehbaren Zweckänderungen ergeben. Ein aktuelles Beispiel kann etwa die überraschende Nutzung sog. Corona-Listen für polizeiliche Ermittlungszwecke, entgegen dem Wortlaut von Sperrklauseln in einigen Bundesländern sein.11
Insgesamt stellt der Grundsatz von Treu und Glauben eher einen Auffangtatbestand dar, der Konstellationen erfasst, in denen der Betroffene durch eine Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einen erheblichen Nachteil erfährt, der in einem massiven Widerspruch zum Kräftegleichgewicht des Verantwortlichen steht – (auch) unabhängig von einem Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot.12 Dementsprechend wird die Prüfung dieses Grundsatzes in der Praxis eher einen Ausnahmefall bilden.