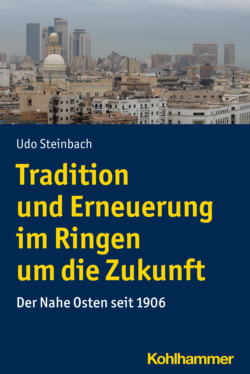Читать книгу Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft - Udo Steinbach - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Persische Wirren
ОглавлениеAuch für Iran5 ist das 18. Jahrhundert eine Epoche des Übergangs. »Persien auf dem Weg in die Neuzeit« hat Hans Robert Roemer seine »Iranische Geschichte von 1350–1750« überschrieben. 1501 hatte sich Isma’il (1487–1524) zum Schah über das Land – mit der Hauptstadt Täbris – erklärt. Er entstammte dem turksprachigen sufischen (d. h. islamisch-mystischen) Orden der Safawiyya6 im aserbaidschanischen Ardabil, der sich im Laufe des 15. Jahrhunderts zunehmend der schiitischen Glaubensrichtung zugewandt hatte. Mit seiner Machtübernahme setzte Isma’il eine umfassende Schiitisierung des Landes ins Werk: Das Bekenntnis zur Zwölfer-Schi’a, dem Hauptstrom unter den Varianten des schiitischen Islams, sollte das bestimmende Merkmal der Identität der Untertanen des safawidischen Reichs werden. (Unterschiedliche Ausprägungen der türkischen Sprachfamilie blieben – von kurzen Perioden abgesehen – bis 1925, dem Ende der Qadscharen-Dynastie, die Sprache der herrschenden Dynastien.)
Mit der Dynastie der schiitischen Safawiden war den Osmanen nicht nur ein politischer Gegner, sondern auch ein religiöses und kulturelles Widerlager erwachsen. Namentlich unter den turkmenischen Nomaden in Ostanatolien hatte die junge Dynastie eine beträchtliche Anhängerschaft. Als die Aufstände und Unruhen dort für die osmanische Herrschaft bedrohlich zu werden begannen, holte Sultan Selim (1512–1520) zum Schlag gegen sie aus. Schah Isma’il eilte der bedrohten Anhängerschaft zu Hilfe. Am 23. August 1514 kam es bei der ostanatolischen Ortschaft Çaldıran zur Schlacht: Sie endete mit einer vernichtenden Niederlage für den iranischen Herrscher. Isma’il überlebte das Desaster und konnte bis zu seinem Tode seine Herrschaft konsolidieren. Als er starb, war Iran in etwa (von Teilen Aserbaidschans und Khorasans abgesehen) in der bis heute gegebenen territorialen Gestalt entstanden. Anders als die neue Staatenwelt des Nahen Ostens, die nach dem Ende des Osmanischen Reichs (1918) wesentlich von den europäischen Mächten vorgezeichnet worden ist, hat Iran eine jahrhundertelange Tradition der Staatlichkeit in den bestehenden Grenzen.
Als Ergebnis der Schlacht von Çaldıran waren die Grenzen auf dem anatolischen Hochland weitgehend abgesteckt. Zugleich aber war damit die Grundlage für eine religiös-»systemische« Rivalität gelegt: Das vom Sultan (Kalifen) regierte Osmanische Reich stand für die sunnitische »Katholizität«, die Herrscher Irans für den schiitischen Legitimitätsanspruch (welcher freilich seit seinen Anfängen im 7. Jahrhundert durch die Geschichte hindurch eher die Rolle des Herausforderers gespielt hatte). In der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hat das kaum eine Rolle gespielt. Erst mit der Gründung der Islamischen Republik Iran (1979) sollte diese religiöse Dichotomie die Politik im Nahen Osten gelegentlich wieder konfessionalistisch einfärben.
Nur einmal kam es in späteren Kriegen zu einer wesentlichen territorialen Verschiebung zwischen den beiden Staaten: 1534 eroberten die Osmanen Bagdad und das Zweistromland bis Basra. Zwar war es den Schiiten Irans gestattet, die Heiligtümer in Kerbela und Nadschaf, den nach Mekka und Medina heiligsten Plätzen ihres Glaubens, zu besuchen. Mit der osmanischen Herrschaft aber begann eine jahrhundertelange Ära der Marginalisierung der Schiiten im Zweistromland. Und auch noch die Briten setzten nach dem Ersten Weltkrieg auf die arabischen Sunniten als staatstragende politische und gesellschaftliche Schicht, obwohl sie im 19. Jahrhundert zu einer religiösen Minderheit geworden waren. Erst nach dem Sturz des Diktators Saddam Husain durch die amerikanische Intervention 2003 sollten die arabischen Schiiten die Macht in Bagdad übernehmen. (Damit wuchs auch wieder der Einfluss des schiitischen Iran im Zweistromland.)
Schah Sultan Husain (reg. 1694–1722) war der letzte Herrscher der Safawiden. Harte steuerliche Belastung namentlich der ländlichen Bevölkerung in Verbindung mit einer rigorosen Durchsetzung der Schi’a nicht zuletzt in den – sunnitischen – afghanischen Teilen des Reichs führten zu verbreiteten Unruhen. Der Todesstoß kam vonseiten des afghanischen Stammes der Ghilzai aus den Gebieten um Kandahar. Unter der Führung von Mir Mahmud eroberten sie 1722 Isfahan, seit Schah Abbas (1587–1629) Hauptstadt des safawidischen Reichs. Schah Sultan Husain wurde abgesetzt. Ein kurzes Interregnum sunnitischer Herrschaft setzte ein.
In der Ära der Safawiden sind weitreichende Weichenstellungen in der Geschichte Irans auf dem Weg in die Neuzeit vorgenommen worden. Die trostlosen Verhältnisse bei deren Untergang dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wichtige Voraussetzungen der Neuzeit Persiens auf sie zurückgehen: so das Persische als Amtssprache (während ein türkisches Idiom die Umgangssprache unter der Herrscherfamilie blieb), die heutigen Staatsgrenzen, das Bekenntnis zur Zwölfer-Schi’a, die bis 1979 bestehende monarchische Staatsform, das architektonische und städtebauliche Gesicht urbaner Zentren, der Zentralismus der staatlichen Verwaltung, die Symbiose der Persisch sprechenden Bevölkerung mit starken Minderheiten nichtpersischer, vor allem türkischer Zunge sowie das Bündnis zwischen der schiitischen Geistlichkeit und den Basarkaufleuten.
Tatsächlich ist die Zwölfer-Schi’a7 unter Schah Isma’il, dem Begründer der safawidischen Dynastie, zur Staatsreligion Irans gemacht worden. Damit war der Grundstein für den starken Einfluss gelegt, den die schiitischen Theologen in der Folgezeit, namentlich auch im 19. Jahrhundert (und dann wieder im Gefolge der Machtübernahme Ayatollah Khomeinis in der Islamischen Republik, S. 445) ausüben sollten. Seit dem 13. Jahrhundert lag die Kernfunktion ihres Wirkens in der Befähigung zum idschtihad, d. h. in der selbstständigen Rechtfindung auf dem Weg rationaler Auslegung des Korans und der Prophetenüberlieferungen. (Der Titel eines zum idschtihad befähigten Geistlichen ist der diesem Begriff verwandte mudschtahid.) Der 12. Imam – als der noch verborgene Souverän – würde eines Tages als Erlöser (mahdi) eine endgültig gerechte und legitime Ordnung auf Erden errichten. Aber in der Zeit seiner Abwesenheit würde es eben an den Theologen sein, den Gläubigen in ihrem persönlichen wie öffentlichen Leben die rechte Leitung zu vermitteln. Solange die Safawiden selbst ihre Macht aus einer unmittelbar göttlichen Legitimation ableiteten, waren die Herrscher die höchste irdische Autorität. Unter Abbas I. hat die Macht der Safawiden als gottgesandtes Königtum ihren Höhepunkt erfahren. Mit seinem Tode setzte eine lange Phase der Schwäche der Herrscher ein; daraus resultierte die Stärkung des Einflusses der Geistlichkeit auf deren Entscheidungen. Unter den Qadscharen (1796–1925) sollten daraus zeitweilig politische Konflikte zwischen Teilen des Klerus und den Herrschern erwachsen.
Wie im Osmanischen Reich hatten sich auch in Persien seit dem Ende des 16. Jahrhunderts die kulturellen Kontakte zu Europa intensiviert. So erfahren wir von Gesandtschaften Ludwigs XIV. und Peters des Großen im Jahre 1708 und 1715. Auch Persien seinerseits entsandte diplomatische Missionen u. a. nach Frankreich. Mochten diese Unternehmungen auch in erster Linie Handelsinteressen entspringen, so hatten sie doch zugleich eine Bedeutung für die kulturelle, vor allem für die künstlerische Entwicklung des Landes. Mit ihnen kamen abendländische ästhetische Ideen nach Persien, auch Künstler und Handwerker. In der Malerei ist dies besonders augenfällig.
1722 endete die safawidische Ära. Die Herrschaft afghanischer Stämme, die ihr ein Ende bereitet hatten, sollte indessen nicht von langer Dauer sein. Nadir Khan, 1688 in der nordöstlichen Provinz Khorasan geboren, wurde der neue starke Mann in Iran. Ein militärischer Abenteurer – in heutiger Terminologie ein warlord (er hatte in den mächtigen Stamm der Afschar eingeheiratet) –, gab er zunächst vor, im Namen eines safawidischen Thronanwärters zu kämpfen – so nannte er sich zunächst Tahmasp quli Khan (»Sklave des [safawidischen] Tahmasp«). Auf diese Weise gelang es ihm, eine starke Streitmacht gegen die Invasoren zu mobilisieren. 1729 wurden die Afghanen aus Isfahan vertrieben. Osmanische Versuche, Teile Aserbaidschans zu besetzen, wurden zurückgeschlagen. 1736 gab Nadir den Vorwand auf, für die safawidische Sache zu kämpfen, und ließ sich selbst zum Schah ausrufen; Nadir Khan stieg zu Nadir Schah auf.
Nadirs Herrschaft war kriegerisch geprägt. In unablässigen Feldzügen eroberte er umfangreiche Gebiete in Afghanistan und im Nordwesten Indiens. Mit den militärischen Anstrengungen freilich gingen keine Bemühungen einher, die administrativen und finanzpolitischen Grundlagen für eine neue Staatsbildung zu schaffen. Die Ausgaben für seine riesige Armee wurden mit Einnahmen gedeckt, die aus dem Volk gepresst wurden. Willkürherrschaft und exzessive Besteuerung führten schließlich zu Unruhe unter der Bevölkerung. 1747 wurde er ermordet; damit war der rasche Zerfall seines Erbes eingeleitet.
Auch die folgende Herrschaft war nur von kurzer Dauer. Aus den Machtkämpfen ging 1758 Karim Khan Zand als Herrscher hervor – nach über siebenhundertjähriger turk- oder mongolischstämmiger Herrschaft zum ersten Mal wieder ein Herrscher persischer Herkunft. Karim Khan machte Schiraz zu seiner Hauptstadt. Auch er gab vor, für einen safawidischen Prätendenten zu kämpfen. So bezeichnete er sich auch nicht als Schah, sondern lediglich als wakil (»Stellvertreter«; auch wakil ar-ra’aya, Vertreter des Volkes). Nach den unruhigen und wirtschaftlich ruinösen Jahren der Herrschaft Nadirs konzentrierte er sich auf die materielle Entwicklung des Landes. Eine maßvolle Besteuerung und die Förderung der Landwirtschaft führten zu einer spürbaren Hebung des Lebensstandards der Untertanen. Unter seiner Herrschaft kam es auch zu weiteren Kontakten mit europäischen Handelsmächten, namentlich den Niederlanden und England. Mit seinem Tod 1779 endete die kurze friedliche Epoche: Unter seinen Brüdern und Verwandten brachen Machtkämpfe aus.
Karim Khan Zand freilich war es nicht erspart geblieben, seine Herrschaft gegen innere und äußere Gegner behaupten zu müssen. Unter ihnen waren die turksprachigen Qadscharen, deren Siedlungsgebiete sich in Mazandaran im Nordosten Persiens befanden. Aus den Kämpfen um die Nachfolge Karim Khans ging Agha Muhammad Khan Qadschar als Sieger hervor. Er wurde der Gründer einer Dynastie, mit deren Namen der Eintritt Persiens in die Neuzeit verbunden ist. Nach einem Jahrhundert von Zerfall, gefolgt von kurzlebiger Neugründung der zentralen Staatsmacht begründete Muhammad Khan 1796 eine Dynastie von beachtlicher Dauerhaftigkeit. Unter ihr sollte ein tiefgreifender Wandel von Staat und Gesellschaft einsetzen.