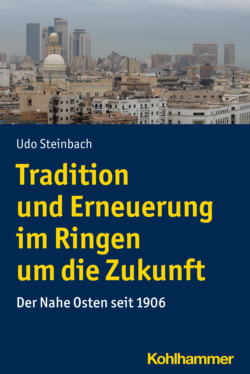Читать книгу Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft - Udo Steinbach - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Irans Weg aus dem Mittelalter
ОглавлениеAls sich Agha Muhammad Khan Qadschar 1796 zum Schah von Persien krönte, war dies das Ergebnis langer Kämpfe ( S. 26). Bereits sein Vater, Muhammad Hasan Khan, hatte – Jahrzehnte zuvor – Anspruch auf die Herrschaft erhoben. Dem turkmenischen Klan der Qoyunlu angehörend, hatte er von seinem Stammsitz in Astarabad aus, im heutigen Gurgan im Nordwesten Persiens, Nadir Schah herausgefordert. Dabei hatte er den Kürzeren gezogen und war aus Astarabad vertrieben worden. Bemühungen, nach Nadir Schahs Ermordung (1747) seine Herrschaft zurückzugewinnen, stießen auf den Widerstand Adil Schahs, eines Neffen des Ermordeten. Während Muhammad Hasan Khan der Verfolgung entkommen konnte, fiel sein ältester Sohn, Muhammad (geb. 1742), Adil Schah in die Hände. Um Muhammad – nach der Praxis seiner Zeit – für die Ausübung der Macht auf immer zu disqualifizieren, ließ Adil ihn im Alter von etwa sechs Jahren kastrieren: von daher sein Beiname »Agha« (Eunuch). Mit dem Tod Adil Schahs (1748) kehrte Agha Muhammad zu seinem Vater zurück und teilte während des folgenden Jahrzehnts dessen abenteuerliches Leben. Denn wie dieser sich zuvor gegen Nadir gewandt hatte, so kämpfte er nunmehr mit Karim Khan Zand um die Macht. Wieder unterlag er. Mit seinem Tod (1759) geriet sein Sohn, »Agha« Muhammad Khan, an den Hof der Zand in Schiraz. Dort hielt ihn Karim Khan während der nächsten zwei Jahrzehnte in einer – freilich sehr generös und respektvoll ausgeübten – Geiselhaft. So hatte er ausreichend Zeit, die politischen Umstände seiner Zeit zu studieren.
Mit dem Tod des Schahs im März 1779 entwich Agha Muhammad Khan, nunmehr 37-jährig, von Schiraz nach Mazandaran, seine Heimat. Planmäßig baute er in den folgenden Jahren seine Herrschaft aus. Bis 1785 festigte er seine Machtbasis im Norden und Nordwesten des Landes. Sein stärkster Gegner war dabei Ali Murad Khan Zand. Danach stieß er nach Zentralpersien, das Kernland der Zand, vor. Mit der grausamen Ermordung Lutf Ali Khan Zands, des Nachfolgers Karim Khans, der ihm durch Verrat in die Hände gefallen war, im November 1794 war er Herr über die Provinzen Fars und Kerman. Damit beherrschte er nunmehr in etwa jene Gebiete, die Teile des Reichs von Karim Khan Zand gewesen waren. Sein Ehrgeiz aber trieb ihn weiter: Es galt, das Reich der Safawiden wieder zu erneuern. Im Sommer 1795 drang er auf dem Weg nach Georgien in den Kaukasus ein. Im September fiel Tiflis; die Stadt wurde geplündert und verwüstet. 15 000 Georgier, zumeist Frauen und Kinder, wurden als Sklaven nach Persien deportiert.
Bislang hatte Agha Muhammad sich geweigert, den Titel des »Schah« anzunehmen – und tatsächlich fehlte ihm noch Khorasan, der Nordosten Persiens mit dem Zentrum Maschhad, um seine safawidischen Träume zu erfüllen. Auf dem Feldzug dorthin, im Winterlager in der Mughan Steppe, gab er dem Drängen seiner engsten Gefolgsleute nach und vollzog die Krönung im März 1796 – 60 Jahre, nachdem Nadir Khan diesen Schritt am gleichen Ort getan hatte. Indem er sich mit dem Schwert von Schah Isma’il I., dem Begründer der safawidischen Dynastie, umgürtete, machte er sichtbar, dass er seine Legitimation zu herrschen aus eben dieser Tradition ableiten würde. Mit der Einnahme von Maschhad im Mai 1796, das er – aus Respekt vor dem Heiligtum des Imam Reza – zu Fuß betrat, endete die Unterwerfung Irans. Agha Muhammad sollte die Erfüllung seines Lebenswerks nicht lange überleben. Denn am 16. Juni 1797 wurde er in Schuscha im Gebiet des heutigen Berg-Karabach ermordet, Opfer eines Anschlags zweier Diener, denen er, obgleich bereits zum Tode verurteilt, einen Tag Aufschub bis zu ihrer Hinrichtung gewährt hatte. Auch seine letzte Ruhestätte hatte Bezug zu den Safawiden: Der Leichnam wurde nach Nadschaf gebracht und dort am Heiligtum von Imam Ali in der Nähe von Schah Abbas I. bestattet.
Agha Muhammad Schah Qadschar gründete eine Dynastie, die immerhin bis 1925 überleben sollte. Unter ihrer Herrschaft vollzog sich der Übergang Persiens vom Mittelalter in die Neuzeit. 1786 hatte er Teheran, eine kleine Stadt von zwischen 15 000 und 30 000 Einwohnern, in der Nähe von Ray, dem antiken Raghes, gelegen, zu seiner Hauptstadt gemacht. Ihre Lage im Norden des Landes nahe den Siedlungsgebieten seines Stammes, sicherte ihm dessen Rückhalt. Die zivile Verwaltung des Staatsgebiets freilich blieb unter Agha Muhammad Schah rudimentär. Persönliche Hingabe und Loyalität ihm gegenüber waren die wichtigsten Kriterien bei der Besetzung von Schlüsselpositionen. Seinem Selbstverständnis als Schahanschah (»König der Könige«) gemäß sah er sich als die Quelle von Gerechtigkeit und als Beschützer der Armen. Das Land war weithin befriedet, die Gouverneure und Statthalter des Herrschers waren zu Mäßigung im Umgang mit den Untertanen angehalten; Verfehlungen freilich konnten auf das härteste bestraft werden.
Im Kern war das Leben Agha Muhammad Khans dasjenige eines Mannes gewesen, der aus dem Sattel regiert hatte. Nicht wirklich charismatisch, war er hartnäckig bei der Durchsetzung seiner Ziele. Zwar verstand er auch, politische Allianzen zu schmieden und den Treibsand der Loyalität der Stämme in die von ihm gewollte Richtung zu wenden – diesbezüglich hatte er in seinem zwanzigjährigen Aufenthalt am Hofe der Zand viel lernen können. Aber sein Heer war das wirkungsvollste und verlässlichste Instrument auf dem Weg der Neugründung Persiens. Von dem Zeitpunkt, da er den Hof der Zand verließ, bis zu seinem Tod hat er es unablässig im Einsatz gehalten. Was er an administrativer Weitsicht vermissen ließ, machte die Grausamkeit wett, mit der er unterlegene Feinde heimsuchte und für die er weithin berüchtigt war. Biographen schreiben sie auch der Tatsache seiner Kastration zu: Diese habe eine besonders brutale Rachsucht in ihm entstehen lassen.
Seiner körperlichen Verstümmelung als »Agha« geschuldet, hatte Muhammad Schah keine eigenen Kinder. Seit langem hatte er deshalb seinen Lieblingsneffen, Fath Ali Khan, als Nachfolger designiert. Ein kurzes Ringen um die Macht mit potentiellen Prätendenten war bald beendet. Bereits im August 1797 ritt Fath Ali Khan (geb. 1772) in Teheran ein, wo er sich am 21. März 1798 zum Schah krönte. Der Ehrgeiz Agha Muhammad Schahs, die Qadscharen auf dem Thron der Safawiden zu verankern, hatte sich damit erfüllt – auch wenn er sich nicht alle Gebiete, die Teile des safawidischen Reichs gewesen waren, hatte untertan machen können. Das Zweistromland verblieb bei den Osmanen und die östliche Region des iranischen Hochlandes wurde Teil des in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstehenden afghanischen Staates.
Die Ausgangssituation der Herrschaft Fath Ali Schahs war eine andere als die seines osmanischen Zeitgenossen Selim III. (1789–1807) und dessen Nachfolgers Mahmud II. (1808–1839). Die Familie Osman herrschte seit Jahrhunderten über ein Großreich, ihre Legitimation stand nicht prinzipiell infrage. In ihrer Außenpolitik hatte sich die osmanische Zentralgewalt die diplomatischen Gepflogenheiten zu Eigen gemacht, wie sie auch im Verkehr der europäischen Mächte untereinander üblich geworden waren. Aber das Großreich war im 18. Jahrhundert unter Druck geraten und musste zunehmend um seinen territorialen Bestand ringen.
Der neue Herrscher in Teheran sah sich elementareren Herausforderungen gegenüber. Sein Onkel hatte das Staatsgebiet mit großer Gewalt zusammengefügt. Die Machtausübung im Zentrum des Staates und in den Provinzen war in höchstem Maße durch ihn und seine führenden Gefolgsleute personalisiert. Den Qadscharen fehlte also die jahrhundertealte Legitimation der Geschichte. Zugleich war die Ausgangssituation umso schwieriger, als sich Fath Ali Schah von Beginn an dem Andringen europäischer Mächte ausgesetzt sah, die an der persischen Landbrücke zwischen Vorderem Orient und dem südasiatischen Subkontinent geopolitisches und wirtschaftliches Interesse zu nehmen begannen. Persien geriet zwischen die Mühlsteine europäischen Vormachtstrebens: Das waren zu Beginn der Herrschaft Fath Ali Schahs Frankreich und England; sehr bald aber schied Frankreich aus dem Ringen aus und Russland trat an seine Stelle.
Während Staat und Gesellschaft im Osmanischen Reich (und in Ägypten) im Verlauf des 19. Jahrhunderts durch Reformen tiefgreifend verändert wurden, sollte der Prozess der Modernisierung in Persien schleppend und oberflächlicher verlaufen. Die Ausübung der Macht durch den Schah stand auf tönernen Füßen. Bereits bei der Regelung der Nachfolge Fath Ali Schahs im Jahr 1834 war die Hand Russlands unübersehbar. Und spätestens von diesem Zeitpunkt an sollten Russland und England über nahezu ein Jahrhundert um politischen und wirtschaftlichen Einfluss in Persien ringen. Beide Seiten waren am Erhalt der Dynastie interessiert: Sie war der Garant, zu verhindern, dass Persien vollständig unter die Kontrolle der einen oder anderen Macht fallen würde. Ohne diese »stabilisierende« Rivalität wäre das Schicksal der Dynastie möglicherweise früher besiegelt gewesen – und Russlands Einfluss hätte sich bis zum Persischen Golf ausgedehnt. Dem musste England mit Blick auf seine Interessen dort und insbesondere auf seine Besitzungen in Indien entschieden entgegentreten.
Seit langem hatten die Zaren ihren begehrlichen Blick auf den Kaukasus geworfen. Unter Katharina II. hatte das Zarenreich seine aktive Expansionspolitik im Kaukasus wieder aufgenommen; dabei war dem christlichen Georgien eine besondere Rolle zugefallen. Die Schwächung der persischen Zentralgewalt im Gefolge der Ermordung Agha Muhammad Schahs im südlichen Kaukasus hatte dem Einfluss Russlands insbesondere in Georgien Tür und Tor geöffnet. 1801 war es zum Protektorat erklärt und dem Zarenreich eingegliedert worden. In seinem Bemühen, das von seinem Onkel eben erst eroberte Land zurückzugewinnen, setzte Fath Ali Schah auf die europäischen Mächte. Der russisch-französisch-englische Machtpoker über die Landverbindung nach Indien schien ihm geeignet, Verbündete zu gewinnen, indem er die Mächte gegeneinander ausspielte. 1800 schickte London eine Delegation nach Teheran, um den Schah für sich zu gewinnen. 1801 kam ein Vertrag zustande, der weitgehende Handelsprivilegien umfasste. Solange freilich Napoleon gleichermaßen eine Bedrohung für England und Russland darstellte, war London nicht bereit, Teheran in einem militärischen Vorgehen gegen Russland im Kaukasus zu unterstützen. So kam Napoleon zum Zug. Nach seinem Scheitern in Ägypten hoffte er, die Briten in ihren Besitzungen in Indien treffen zu können. Im Mai 1805 traf eine französische Delegation in Iran ein, um für ein Bündnis zu werben. Zu einem solchen kam es tatsächlich zwei Jahre später im ostpreußischen Finckenstein: Frankreich signalisierte seine Unterstützung bei der Rückgewinnung Georgiens, im Gegenzug würde der Schah alle Briten aus Persien ausweisen und – vor allem in der Armee – durch Franzosen ersetzen. Der Abschluss des Friedens von Tilsit zwischen Napoleon und dem Zaren bereits am 7. Juli 1807 dämpfte den französischen Enthusiasmus, Teheran in Georgien gegen Russland zu unterstützen. Aus dem fortgesetzten Schaukelspiel ging schließlich England als Sieger hervor. Die Niederlage Napoleons gegen Russland schließlich (1812) warf Frankreich endgültig aus der Rivalität der Mächte um Persien. Künftig sollte diese zwischen Russland und England ausgetragen werden. Der geistige und zivilisatorische Einfluss Frankreichs, nicht zuletzt in Gestalt französischer Berater in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens, und die französische Sprache sollten aber – zumindest unter der Elite – weiterwirken.
Im Schaukelspiel zwischen den europäischen Mächten erscheint Iran eher als passiver denn als aktiver Spieler. Der Schah verfügte nicht über eine militärische Streitmacht, die ihn ebenbürtig an die Seite der anderen drei hätte treten lassen. Gleichwohl suchte er seit 1804, militärisch seine Ziele gegenüber Russland in Georgien zu erreichen. Solange Russland auf dem europäischen Kriegsschauplatz gebunden war, konnte der Zar seine militärischen Potentiale im Kaukasus nicht voll zur Wirkung bringen. Die Kämpfe zogen sich mit wechselnden Erfolgen hin. Nach dem Frieden von Tilsit (1807) bot der Zar dem Schah zwar Unterstützung gegen die Osmanen an, stellte Georgien aber nicht zur Disposition. 1810 erklärte Fath Ali Schah den Krieg zu einem »heiligen Krieg«. Zwar waren die Russen zahlenmäßig unterlegen, aber ihr Vorsprung in Strategie und Kriegstechnik zwang Iran im Oktober 1813 zur Kapitulation. In Gulistan unterzeichneten beide Seiten einen für den Verlierer erniedrigenden Friedensvertrag: Persien verlor alle Gebiete im Kaukasus nördlich des Flusses Kura, d. h. Derbent, Baku und Schirvan. Zugleich erhielt Russland das ausschließliche Recht, eine Kriegsflotte auf dem Kaspischen Meer zu unterhalten. Artikel 4 des Vertrages sicherte Russland eine Mitbestimmung bei der Designation des Kronprinzen zu. Verhängnisvoll für die politische und wirtschaftliche Entwicklung Irans sollten sich die Bestimmungen auswirken, die die wirtschaftlichen Beziehungen betrafen. Dabei handelte es sich um Vereinbarungen, die im Falle des Osmanischen Reichs – beginnend 1569 mit Frankreich und in der Folge fortgesetzt mit anderen europäischen Mächten – als »Kapitulationen« in die Geschichte eingegangen sind. Russen wurde das Recht eingeräumt, in Iran Eigentum zu erwerben und im Handel nur einen einzigen Wertzoll von fünf Prozent zu entrichten. Zwar waren ähnliche Vorteile bereits früher England vergeben worden, der Vertrag von Gulistan aber enthielt weiterreichende Konzessionen in der Außenhandelspolitik, als das vorher jemals der Fall gewesen war. Namentlich die Befreiung von Binnenzöllen, die russische Kaufleute innerhalb Persiens genossen, räumte ihnen gegenüber den einheimischen Kaufleuten, die nach wie vor diese Abgaben zu entrichten hatten, handfeste Vorteile ein.
Der Krieg hatte die Schwäche des Landes offenbart. Diese freilich lag nicht nur im militärischen Bereich; vielmehr war die militärische Schwäche Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse und der allgemeinen Unterentwicklung des Landes. Auch wenn sich der Herrscher als »König der Könige« (schahanschah) bezeichnete, war seine tatsächliche Macht beschränkt. Der die politische Loyalität der Untertanen grundlegend bestimmende Tatbestand war die tribale Gliederung der Gesellschaft. Die Stämme und Stammesverbände – so etwa die Turkmenen im Nordosten, die Qaschqai in der zentralen Provinz Fars, die Schahsevan in Aserbaidschan, die Kurden im Westen, die Lur sprechenden Bakhtiaris und die Luren zwischen den Kurden und Qashqai, die Araber im Südwesten, die Belutschen im Südosten – sie alle waren machtvolle gesellschaftliche und politische Verbände. Halbautonom in ihrem Status, verfügten sie zugleich über beträchtliche militärische Stärke, die jeweils von Fall zu Fall für die Interessen und Pläne der Zentralgewalt gewonnen werden musste. Unter einer Bevölkerung von fünf bis sechs Millionen Menschen waren etwa ein Zehntel Nomaden. Vor diesem Hintergrund erklärt sich das grundlegende Dilemma des Herrschers: Auf der einen Seite war er das Zentrum staatlicher Machtausübung, beständig bemüht, seine Stellung als »König der Könige« zu rechtfertigen und propagandistisch zu erhöhen. Auf der anderen fehlten ihm die Machtmittel, dies durch herrschaftliches Handeln im Gesamtinteresse des Staates in Erscheinung treten zu lassen. Militärisch relativ schwach, reichte sein herrscherlicher Arm in Teilen des 19. Jahrhunderts kaum über die Tore Teherans hinaus. So musste der Schah also indirekte Wege der Machtausübung beschreiten: oppositionelle Kräfte spalten, politische Rivalitäten schüren, Vergünstigungen anbieten und »Gäste«, sprich Geiseln machtvoller Stämme und Familien, am Hof halten.
Die Schwäche der Zentralgewalt und das Fehlen leistungsfähiger staatlicher Institutionen machten sich nicht zuletzt bei den Staatseinnahmen bemerkbar. Hohe Ämter – so auch die Gouverneursposten – wurden meistbietend versteigert. Das veranlasste die Amtsinhaber, aus ihren Posten in kürzester Zeit herauszuholen, was herauszuholen war. An einer langfristigen Entwicklungsperspektive der Staatsfinanzen bestand kein Interesse, galt es doch, für die nächste »Versteigerung« finanziell aussichtsreich vorgesorgt zu haben. Ein Großteil der Staatsdomänen musste in Form von Lehen als Gegenleistung für militärische Unterstützung vergeben werden. Diese aber wurden zum Teil erblich und genossen Steuerbefreiung. In der langen Periode ihrer Herrschaft haben die qadscharischen Herrscher – im Gegensatz zu den Osmanen über weite Epochen – keinen ernsthaften Versuch unternommen, Wege zu beschreiten, die kontinuierlich und langfristig auf eine Steigerung des allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstands ausgerichtet gewesen wären. So blieb auch die Modernisierung insgesamt, d. h. die Anpassung von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und geistigem Leben an die Herausforderungen, die sich aus dem Zusammenstoß mit europäischen Nationen ergaben, Stückwerk. Häufig war sie das Werk von einzelnen Persönlichkeiten. Fielen diese beim Herrscher aus politischen oder persönlichen Gründen in Ungnade, erlosch die Dynamik der Erneuerung.
Die Aufwendungen Fath Ali Schahs (und seiner Nachfolger) für Hofhaltung und Herrschaftsstil standen in krassem Gegensatz zu dem Mangel an Entschlossenheit, Staat und Gesellschaft auf ein neues Fundament zu stellen. Der »König der Könige« war bemüht, den konkurrierenden Herrscher in Konstantinopel – ja »nur« ein Sultan – in den Schatten zu stellen. Hatten frühere Herrscher über Persien Isfahan und Schiraz geschmückt, so entstanden nunmehr aufwendige Bauten in Teheran. Zugleich sollten Theologen, Dichter und Schriftsteller das Zentrum der Macht zum »Musenhof« machen (an dem der Herrscher auch selbst dichterischen Ehrgeiz entfaltete). Zur Bekundung seines religiösen Eifers wurden Mittel für die goldenen Kuppeln der Gräber der schiitischen Imame – so in Qum und Maschhad – aufgebracht. Die – erfolglosen – militärischen Unternehmungen zur Rückgewinnung verlorener Territorien bedeuteten eine anhaltende Belastung des Staatshaushalts. Unsummen schließlich verschlang der persönliche Lebensstil Fath Ali Schahs: Legendär geworden ist sein Harem. Alles in allem soll er tausend Frauen umfasst haben, denen noch die Eunuchen hinzuzufügen sind. Von seinen zahlreichen Kindern haben ihn 60 männliche und 55 weibliche Nachkommen überlebt.
Zu Ansätzen einer Modernisierung von Verwaltung und Militär kam es in Täbris, der Hauptstadt Aserbaidschans. Dort herrschte als Gouverneur Abbas Mirza (1789–1833), ein Sohn Fath Ali Schahs. Er war von seinem Vater mit der Kriegsführung gegen Russland betraut. Auf die Niederlage von Gulistan sollte eine zweite folgen. 1825 hatte Russland Teile des heutigen Armenien besetzt. 1826 entschloss sich Abbas Mirza zum Krieg, der 1827 mit der Besetzung von Täbris durch russische Truppen endete. Der Friede von Turkmentschai (1828) war für Persien nicht weniger folgenschwer als sein Vorgänger in Gulistan. Nicht nur verlor das Land alle Gebiete nördlich des Aras, der nunmehr zur Grenze zwischen dem Zarenreich und Persien wurde. Persien musste hohe Reparationszahlungen leisten und Russland die umfassende extraterritoriale Jurisdiktion über russische Staatsbürger einräumen. Die mit Russland getroffenen Vereinbarungen wurden später auf andere europäische Mächte, namentlich England, ausgedehnt. Immerhin weckten die in den Kriegen gemachten Erfahrungen in Abbas Mirza ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reformen. Wie die Reformsultane in Konstantinopel begann er mit dem Heerwesen. Französische, englische und russische Ausbilder wurden ins Land geholt; umgekehrt wurden Perser zur Ausbildung ins Ausland geschickt. Mit der Produktion von Kanonen wurde ein erster Schritt in Richtung auf eine Industrialisierung gemacht. Die Verkehrsinfrastruktur wurde verbessert, erste Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltung unternommen. Mit dem Tod von Abbas Mirza 1833 freilich verlosch das zarte Flämmchen erster Reformen bis auf Weiteres wieder. In seinen Bemühungen hatten ihm zwei außerordentliche Persönlichkeiten zur Seite gestanden: die »Großwesire« (sadr-e a’zam) Vater Isa (gest. 1822) und dessen Sohn Abu l-Qasim Farahani Qa’im Maqam. Dessen Ende sollte nicht untypisch sein für das Schicksal einer Reihe von herausragenden Persönlichkeiten – sowohl vor, insbesondere aber nach ihm. Fath Ali Schah starb 1834, ein Jahr nach seinem für den Thron designierten Sohn Abbas Mirza. Nachdem es Abu l-Qasim Farahani gelungen war, im Schlangennest der Prätendenten den Sohn seines prinzlichen Dienstherrn als Muhammad Schah zum Nachfolger zu machen, fiel er einer Palastintrige zum Opfer: 1835 ließ ihn der neue Herrscher auf Anraten seines Beraters und Günstlings Mirza Aqasi erdrosseln.
Überzeugt, dass Herat im Nordwesten Afghanistans leichter zurückzugewinnen sein würde als Georgien, hatte Abbas Mirza 1833 einen Angriff auf die Stadt begonnen. Dabei stieß er freilich auf den Widerstand Englands, das seinerseits dabei war, Afghanistan seiner Kontrolle zu unterwerfen. Mit dem Tod seines Vaters (1833) und seines Großvaters (1834) übernahm Muhammad Schah (reg. 1834–1848) dieses schwierige Erbe. Die Armee und die Finanzen waren erschöpft. Nachdem bei der Regelung der Nachfolge Fath Ali Schahs auch England und Russland ihre Hände im Spiel gehabt hatten, musste die Belagerung Herats abgebrochen werden. Damit wuchs der Einfluss Englands nachhaltig an. In den Jahren 1836 bis 1841 schlossen London und Teheran Verträge ab, die England alle Vorrechte einräumten, die vorher bereits Russland innehatte. Die Meistbegünstigungsklausel, die im Vertrag mit England von 1841 enthalten war, sollte dann in späteren Abkommen Persiens auf andere fremde Mächte ausgedehnt werden.
Ein Vorfall vom Februar 1829 lässt schlaglichtartig deutlich werden, wie hoch einerseits die Abhängigkeit von Russland bereits war, wie erniedrigend andererseits diese auch im Volk empfunden wurde. Zur Umsetzung der Bestimmungen des Vertrages von Turkmentschai, namentlich der Zahlung von Reparationen und der Entlassung von Kriegsgefangenen, schickte der Zar Alexander Gribojedow (geb. 1795), Diplomat zugleich aber auch bekannter Schriftsteller, nach Teheran. Dessen arrogantes Auftreten war als solches bereits geeignet, bei seinen persischen Gesprächspartnern Unmut zu erregen. Dieser steigerte sich zum Volkszorn, als er Damen georgischer und armenischer Herkunft aus dem Harem des Großwesirs, die zum Islam übergetreten waren, in der russischen Vertretung Aufnahme bot. Die Mullas schürten das Gerücht, Gribojedow bekehre zwangsweise Muslime zum Christentum. Damit mobilisierten sie einen Mob, der schließlich in die russische Vertretung eindrang und bis auf einen das gesamte Personal – einschließlich Gribojedow – umbrachte. Ein halbes Jahr später, am 24. August, ließ der Zar in St. Petersburg eine persische Delegation zur Audienz vor. In ihr nahm er nicht nur die Entschuldigung des Schahs für den »Gribojedow-Vorfall«, sondern auch – zur Sühnung – üppige Geschenke an: eine Belastung mehr für eine Staatskasse, die ohnehin leer war.
Ansonsten war die Herrschaft Muhammad Schahs eher durch Stillstand gekennzeichnet. Nach der Ermordung Abu l-Qasim Farahanis auf Veranlassung Mirza Aqasis verliefen die folgenden Jahre im Wesentlichen friedlich. Mirza Aqasi war ein Anhänger des sufischen Islams, der Schah stand unter seinem Einfluss. Er ließ die Gräber bedeutender sufischer Dichter und Denker restaurieren; das geistige Klima öffnete sich für europäische Ideen. Die Stellung des offiziellen schiitischen Klerus war geschwächt.
Gerade im religiösen Raum aber vollzogen sich Entwicklungen von großer Tragweite. Sie gingen von der messianischen Babi-Bewegung aus, die sich später in veränderter Form als Baha’itum weit über die Grenzen Persiens hinaus ausbreiten sollte. Der Begründer der Bewegung, Seyyid Ali Muhammad, wurde 1819 als Sohn eines Kaufmanns in Schiraz geboren. Unter dem Einfluss einer Lehre innerhalb der Zwölfer-Schi’a, die verkündete, dass es immer einen Mann auf der Welt gegeben habe, der in Verbindung mit dem verborgenen zwölften Imam stand und so dessen Willen kundtun konnte, erklärte sich Seyyid Ali Muhammad 1844 selbst zu diesem »Tor« (bab) zum verborgenen Imam. Später ließ er durchblicken, dass er der Imam selbst sei, dessen eschatologische Wiederkunft die Schiiten erwarteten. Er verurteilte das Unrecht, das durch traditionelle Herrschaft und westliche Einmischung verursacht worden war. Zu seinen Forderungen gehörten soziale Gleichheit, die Besserstellung der Frauen, die Senkung der Steuern und die Milderung der Strafen. Diese fortschrittliche, von messianischem Eifer getragene religiöse Botschaft gewann in vielen Gegenden Persiens eine starke Anhängerschaft. Es kam zu vereinzelten offenen Revolten, die niedergeschlagen wurden. 1850 wurde der Bab in Täbris öffentlich hingerichtet. Auf ein Attentat seiner Anhänger gegen den neuen Schah Nasir ad-Din 1852 regierte dieser mit grausamer Verfolgung. Die Babis spalteten sich: Die Mehrheit folgte Mirza Husain Ali Nuri, später Baha’ullah (»Glanz Gottes«; 1817–1892) genannt, einem frühen Anhänger des Bab; eine Minderheit seinem Halbbruder Mirza Yahya Nuri, später als Subh-e Azal (»Morgen der Ewigkeit«; 1830–1912) bekannt. Ersterer gab der Bewegung, die heute als Baha’i-Religion eine weltweite Anhängerschaft hat, ihren Namen.
Für die Niederschlagung der Babi-Bewegung hatte der Schah die Rückendeckung des schiitischen theologischen Establishments, war doch durch die neue Lehre dessen Stellung herausgefordert. Nasir ad-Din Schah (1848–1896) teilte nicht die sufischen Neigungen seines Vaters. In dem Prozess gegen den Bab hatte er selbst den Vorsitz inne. Anders als sein Vater suchte er die Legitimation seitens der Theologen. Das lag schließlich in der Logik der geschichtlichen Entwicklung. Denn auch wenn sich der Machtanspruch, der Stil der Ausübung der Herrschaft und die territorialen Ansprüche der qadscharischen Herrscher an den Safawiden orientierten, konnten – anders als eben diese – der Gründer der Dynastie und seine Nachfahren (bis 1925) keine religiöse Legitimation für sich reklamieren. Mit dem Titel des »Großkönigs« (schahanschah) knüpften sie an die uralte, vorislamische Tradition des persischen Königtums an. Eine Absicherung gegenüber dem schiitischen Klerus war jedoch zur Stabilisierung ihrer Herrschaft unerlässlich, bestand doch die Gefahr, dass sich eine Opposition gegen die Dynastie – wie eben im Falle des Bab – religiöser Argumentation hätte bedienen können. Die ulama ihrerseits waren zu einer begrenzten Zusammenarbeit mit der Dynastie bereit, auch wenn tief eingewurzeltes Misstrauen der Institution der Monarchie gegenüber fortbestand. Mit einer allzu großen Nähe wollten sich viele nicht »verunreinigen«. Eine Parallele mit der Doktrin der »zwei Schwerter«, mit der mittelalterliche Staatstheoretiker das Verhältnis von Kaiser und Papst zu erfassen suchten, liegt durchaus nahe.
Seit dem 14. Jahrhundert war der hohen Geistlichkeit ein besonderer Stellenwert für die Auslegung der schiitischen Lehre zugewachsen. Nach einem langen Studium der religiösen Texte waren die Theologen schließlich zum idschtihad befähigt, d. h. zur selbstständigen Rechtsfindung aufgrund rationaler Abwägungen. Damit waren sie mudschtahids und berufen, den Gläubigen in allen Fragen des individuellen, aber auch öffentlichen Lebens eine Weisung zu erteilen, die aus den Grundsätzen der islamischen Religion schöpfte. Unter den Qadscharen schließlich bildete sich der Klerus aus, der in der Staatstheorie Khomeinis später eine buchstäblich staatstragende Rolle spielen sollte. Zwar gab es noch nicht die Institutionalisierung der Stellung des »vorzüglichsten Gottesgelehrten«, der selbst berufen sein würde, an die Spitze eines islamischen Staatswesens zu treten ( S. 445). Aber eine Hierarchisierung geistlicher Ränge wurde durchaus Praxis. Der Ehrentitel eines ayatollah (»Zeichen Gottes«) war bereits zuvor in Gebrauch gekommen. Seit dem 19. Jahrhundert haben sich dann einzelne prominente mudschtahids aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Popularität den Rang allgemein anerkannter Autoritäten erworben. Sie wurden zu »Instanzen der Nachahmung« (mardscha at-taqlid), d. h. ihr Vorbild wurde weithin verbindlich, ihre Entscheidungen waren allgemein gefragt und wurden akzeptiert – weit über den lokalen oder regionalen Rahmen hinaus, in dem die Autorität eines mudschtahid gewöhnlich ihr Betätigungsfeld fand. Im Prinzip war (und ist bis heute) im Chor der mudschtahids Vielfalt angelegt, können doch die Auslegungen der religiösen Quellen durch die dazu Befähigten sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Dogma der Unfehlbarkeit gibt es nicht. Auch verfällt die Gültigkeit der Entscheidungen mit dem Tod des mudschtahid: Geltung haben nur die Entscheidungen der lebenden Geistlichen.
Der Beginn der Herrschaft Nasir ad-Din Schahs stand im Zeichen von Reformen. Ihr Motor war sein Wesir (sadr-e a’zam, »Ministerpräsident«) Mirza Taqi Khan Amir Kabir (1807–1852). Aus kleinen Verhältnissen stammend, war er dem jüngeren Qa’im Maqam durch seine Intelligenz aufgefallen; dieser hatte ihm eine hervorragende Ausbildung angedeihen lassen. Ein Aufenthalt in Russland hatte ihn mit europäischem Geist in Militärwesen, Verwaltung, Gesellschaft und Kultur in Berührung gebracht. Im Verlauf eines vierjährigen Aufenthalts in der Türkei (1843–1847) wurde er Zeuge der Neuerungen in den Bereichen des Rechts, der Finanzen, der Verwaltung und des Militärs im Gefolge des 1839 von Sultan Abdülmecit proklamierten Edikts von Gülhane ( S. 53). Sie inspirierten ihn zu einem umfassenden Reformwerk, das er mit Antritt der Herrschaft Nasir ad-Din Schahs ins Werk setzte. Wie auch bei seinen Vorgängern galt sein Hauptinteresse zunächst der Reform des Militärs: Er organisierte die Armee nach westlichem Muster und verstärkte Ausbildung und Schulung. Um die angespannte finanzielle Lage des Staates zu verbessern, verringerte er die Zahl der Sinekuren und ersetzte eine Reihe von Lehen durch bescheidene Renten. Er rief die erste offizielle Zeitung ins Leben, die Waqayi-e ittifaqiyye (»Die Chronik der Ereignisse«). Weitere Reformen betrafen das Rechtswesen, einen besseren Schutz religiöser Minderheiten und die Landwirtschaft. Erste Schritte zur Industrialisierung wurden unternommen. Seine wichtigste und nachhaltigste Maßnahme aber war die Gründung der ersten Lehrstätte für höhere Bildung, die Dar al-Funun (»Haus der Techniken«) 1851 in Teheran. Auch hier standen Disziplinen im Vordergrund, die das Militärwesen berührten: Im weiteren Sinne gehörten dazu Medizin, Ingenieurwesen, Fremdsprachen und Musik. Große Teile des Lehrkörpers wurden aus Europa rekrutiert – neben England und Russland auch aus Frankreich. Auf diese Weise wurde die Dar al-Funun für die kommenden Jahrzehnte ein Tor der Modernisierung und des wachsenden kulturellen Einflusses Europas.
Naturgemäß stießen die Reformen auf den Widerstand jener, deren Privilegien davon negativ berührt waren. Solange der Kampf gegen die Babis angesagt war – Mirza Taqi Khan selbst war ein unerbittlicher Gegner der Bewegung –, war kein Raum, Unzufriedenheit und Opposition an den Tag zu legen. Mit der Unterdrückung der Bewegung aber formierte sich der Widerstand gegen den Wesir: Angeführt von der Königin Mutter kam es zu einer Palastintrige. Schließlich ließ sich der Schah überzeugen, dieser Emporkömmling verfolge noch höhere Ziele, ja wolle sich selbst auf den Thron setzen. Zunächst wurde Mirza Taqi Khan nach Kaschan ausgewiesen. Am 10. Januar 1852 wurde er dort ermordet: Man schnitt ihm die Adern der Gliedmaßen auf und ließ ihn verbluten – mit einem Knebel im Mund, um ihn am Schreien zu hindern.
In kürzester Zeit waren breite Impulse der Modernisierung angestoßen worden. Mit der frühen Ermordung ihres Urhebers aber kehrte erst einmal wieder Stagnation zurück. Einige der Reformen wurden zurückgenommen und unter der Leitung seines Wesirs Mirza Agha Khan Nuri ließ sich der Schah einmal mehr auf ein afghanisches Abenteuer ein. Der Umstand, dass Englands Kräfte im Krimkrieg gegen Russland gebunden waren, schien die Möglichkeit zu eröffnen, nun doch noch die Eroberung von Herat ins Werk zu setzen. In diesem Bestreben wurde er von Russland unterstützt. Das Kalkül erwies sich als falsch. Britische Truppen landeten in Buschehr und zwangen den Schah, das Vorhaben abzubrechen. Im Rahmen des Friedensvertrages von Paris (1856), der den Krimkrieg beendete, wurden auch die britisch-persischen Beziehungen geregelt: Der Schah musste seinen Anspruch auf Herat und das westliche Afghanistan ein für alle Mal aufgeben; für eine Reihe von Jahren geriet der persische Hof unter den vorherrschend englischen Einfluss. Der russische Vorstoß in Zentralasien führte im Norden zum Verlust persisch- und turksprachiger Gebiete, die in der Vergangenheit Teil des safawidischen Reichs gewesen waren.
Mit dem für Persien erniedrigenden Ausgang der Auseinandersetzung um Herat entließ der Schah 1858 seinen Großwesir. In der Folge experimentierte er mit diversen Formen der Regierungsbeteiligung – erst einem Kabinett mit mehreren Ministern, später einer Art von beratender Versammlung. Sein vorrangiges Interesse dabei bestand darin sicherzustellen, dass alle Fäden des Regierens bei ihm zusammenliefen. Konservative und eher für Reformen offene Kräfte wurden gegeneinander ausgespielt. Unter letzteren war Mirza Malkom Khan eine der schillerndsten und bemerkenswertesten Persönlichkeiten: 1833 in eine armenisch-christliche Familie geboren, erhielt er in Paris seine Ausbildung. Nach seiner Rückkehr nach Persien (1852) konvertierte er zum Islam und unterrichtete zunächst an der Dar al-funun. 1858 begründete er eine Art Freimaurerloge (faramuschkhane, »Haus des Vergessens«). Zunächst vom Schah darin unterstützt, musste er nach dessen Sinneswandel 1862 ins Exil gehen. Später begnadigt, kehrte er zurück und nahm in den folgenden Jahrzehnten unterschiedliche Posten in Regierung und Verwaltung sowie im diplomatischen Dienst wahr. In seiner Zeit als Botschafter in London (1872–1888) gab er die Zeitschrift Qanun (»Das Gesetz«) heraus. Diese und andere Veröffentlichungen sollten ihn zu einem der Väter der Verfassungsrevolution werden lassen, die er als Botschafter in Rom (bis zu seinem Tod 1908) miterleben sollte.
In eine neue Phase trat die Herrschaft Nasir ad-Din Schahs in den sechziger Jahren. Nicht zuletzt angeregt durch Malkom Khan und seinen Großwesir Mirza Husain Khan, zeigte der Schah offenes Interesse für die Verhältnisse in Europa. Dies schlug sich in drei Reisen nieder, die er 1873, 1878 und 1889 unternahm. Zugleich trieben ihn die ständigen Finanznöte (die durch die erheblichen Aufwendungen für die Reisen verschärft wurden) dazu, sich Geld aus dem Ausland zu verschaffen. Das geschah durch Kredite sowie den Verkauf von Konzessionen an Teilen der persischen Wirtschaft an ausländische Geschäftsleute. Wieder kamen die Impulse von einer starken Persönlichkeit außerhalb des Hofes. Mirza Husain Khan Muschir ad-Daula war 1871 als Großwesir berufen worden. Er stand mit Reformern seiner Zeit in Russland und im Osmanischen Reich in Verbindung. In seiner Zeit als Botschafter in Tiflis hatte er Fath Ali Akhundov ( S. 133) und in Konstantinopel Malkom Khan getroffen.
Seine Reisen führten Nasir ad-Din Schah nach Russland, Polen, Preußen, Frankreich, die Schweiz, Italien, Österreich (1873 besuchte er in Wien die Weltausstellung) und in das Osmanische Reich. Er hat darüber ein Tagebuch verfasst, das zwar in Teilen auf skurrile Weise erkennen lässt, wie weit der zivilisatorische und kulturelle Abstand zwischen Persien und Europa war, zugleich aber offenbart es ein lebendiges Interesse des Herrschers an den europäischen Errungenschaften. Auch erwies sich der Schah als begeisterter Fotograph und hat als solcher eine reiche Ausbeute hinterlassen.
Den Auftakt der Konzessionen bildete um 1860 die Konzession an England zum Bau eines Telegraphennetzes. Das lag durchaus im beiderseitigen Interesse: Für England sollte der Telegraph zu einem wichtigen Strang der Kommunikation innerhalb des Empires, zwischen Südasien und London werden. Der Schah sah darin ein Instrument, über die Ereignisse und Zustände innerhalb Persiens kontinuierlich informiert zu werden; die autokratisch zentralistische Machtausübung konnte auf diese Weise weiter gefestigt werden. Die Konzessionen an den britischen Staatsangehörigen Baron Julius de Reuter waren wesentlich weitreichender: Sie gewährten dem Konzessionär nicht nur Exklusivrechte zum Bau von Eisen- und Straßenbahnen, sondern sie räumten ihm überdies besondere Rechte für den Betrieb fast aller Bergwerke, den Bau von Bewässerungsanlagen, die Gründung einer Nationalbank, der Imperial Bank of Persia, sowie für zahlreiche industrielle und landwirtschaftliche Betriebe ein – und das alles gegen Entrichtung relativ geringer Summen und bei bescheidener Gewinnbeteiligung des persischen Staates. Diese Politik schlug jedoch fehl. Nicht nur stieß sie auf den Widerstand Russlands; bei der Rückkehr von seiner ersten Europareise sah sich der Schah vielmehr einer Koalition patriotischer und antienglischer Beamter sowie der ulama gegenüber. Sie zwang ihn, Mirza Husain Khan zu entlassen und die Konzessionen an Reuter zu widerrufen. Als Antwort darauf instrumentalisierte die britische Regierung das Scheitern der Konzession mit dem Ziel, die Vergabe von Konzessionen an russische und andere ausländische Gesellschaften zu blockieren. 1879 erhielt gleichwohl eine russische Gesellschaft eine bedeutende Konzession für Fischereirechte im Kaspischen Meer. Und auch England sicherte sich in den folgenden Jahren durch weitere Konzessionen die Beteiligung an der Ausbeutung persischer Ressourcen.
Nicht zuletzt aufgrund seiner militärischen Schwäche war der Schah kaum in der Lage, sich den regionalen und lokalen Machthabern im Reich gegenüber als Zentralgewalt zu behaupten. 1879 stellte er einen nach russischem Vorbild organisierten Verband (»Kosakenbrigade«) auf. Dieser gab ihm zwar eine kleine verlässliche Streitkraft an die Hand. Da er aber von russischen Offizieren befehligt wurde, bedeutete er zugleich eine weitere Stärkung des russischen Einflusses im Land.
Parallel zu der wachsenden politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit von äußeren Mächten hatten sich seit Mitte des Jahrhunderts nachhaltige innere gesellschaftliche Veränderungen vollzogen. Die Intensivierung der Handelsbeziehungen mit Europa hatte zwar die Nachfrage nach persischen Handwerksprodukten, namentlich Teppichen, anwachsen lassen. Davon aber hatten weniger die Erzeuger als die lokalen und westlichen Zwischenhändler profitiert. Zugleich bedrohte die Überflutung des persischen Marktes mit billigen europäischen Importgütern lokale Wirtschaftszweige, so etwa die handwerklich produzierenden Textilbetriebe, in ihrer Existenz. Die europäische Nachfrage nach persischen Agrarprodukten wie Baumwolle, Obst, Nüsse und Opium steigerte die Rendite von Investitionen in der Landwirtschaft. Als Folge davon begannen sowohl traditionelle Grundbesitzer als auch Angehörige der städtischen Mittelklasse und wohlhabendere Dorfbewohner, landwirtschaftliche Nutzflächen aufzukaufen. Auch vor dem Hintergrund der sich im internationalen Handel auftuenden Gewinnchancen steigerten sich der Druck und die Lasten, die die Bauern zu tragen hatten. Zug um Zug verlor die Bevölkerung auf dem Land und in den Dörfern überkommene Rechte und ihre Lebensgrundlage, war sie doch häufig nicht mehr in der Lage, ihre Schulden und sonstigen Verpflichtungen zu bedienen. Verschärft durch anhaltende Wasserknappheit und Missernten, führten die Veränderungen in der Struktur von Landwirtschaft und Handel zu Lasten der Bauern und der städtischen Unterschichten 1870/71 zu einer dramatischen Hungersnot. Schätzungen zufolge starb etwa ein Zehntel der Bevölkerung.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Babi-Bewegung als mehr denn nur eine religiöse Erneuerungsbewegung dar: Sie hatte zugleich eine gesellschaftliche und politische Dimension. Sie artikulierte den Protest jener Schichten, die Opfer der skizzierten Veränderungen waren: der Kaufleute, die auf dem von billigen europäischen Produkten überschwemmten Markt nicht mehr mithalten konnten, und der ländlichen Bevölkerung, die sich von der Öffnung der landwirtschaftlichen Produktion für den europäischen Markt marginalisiert sah. Aber auch in jenen Teilen der persischen Gesellschaft, die eine Modernisierung anstrebten, welche sich aber angesichts der politischen Machtverhältnisse nicht oder nur allzu zögerlich durchsetzen ließ, fand die aus der Protestbewegung des Bab hervorgehende Religion des Baha’ullah (Bahaismus) ihre Anhänger.
Im »Tabakprotest« von 1890 bis 1892 vereinigen sich brennpunktartig die für die politische, wirtschaftliche und geistig-kulturelle Lage Persiens signifikanten Fäden. Im März 1890 räumte der Schah einem britischen Staatsbürger ein Monopol für Anbau, Verkauf und Export des gesamten persischen Tabaks ein. Nach monatelanger Geheimhaltung begann die Zeitung Akhtar (»Der Stern«) – heute würde man sagen: die Presse – die Angelegenheit ans Licht zu bringen. Die Proteste zogen breite Kreise; in ihnen spielte Dschamal ad-Din al-Afghani, ein religiös-politischer Aktivist von dem noch zu sprechen sein wird ( S. 91), eine zentrale Rolle. Zugleich trat die schiitische Geistlichkeit auf den Plan. In einem Schreiben an den Schah protestierte Ayatollah Hadschi Mirza Muhammad Hasan Schirazi, ein im irakischen Samarra residierender hoch angesehener mudschtahid und mardscha’-e taqlid, gegen den Ausverkauf Persiens an die Europäer. Höhepunkt des Widerstands wurde eine ihm zugeschriebene religiöse Rechtsentscheidung (fatwa). Im Herbst 1891 befindet er: »Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen! Ab heute wird der Genuss von Tabak in all seinen Formen als ein Krieg gegen den Imam der Zeit betrachtet …«. Die Folge der fatwa ist ein weithin im Lande befolgter Boykott des Genusses von Tabak. Im Januar 1892 widerruft der Schah die Konzession. Erst jetzt erklärt Mirza Schirazi die Geltung der fatwa für beendet und am 26. Januar 1892 wird das Rauchen wieder gestattet. Der Wille des Schahs war an einer breiten Allianz des Volkes, der Geistlichkeit und der führenden Köpfe der liberalen Bewegung gescheitert. Die Folgen waren nicht nur eine weitere Erosion des Ansehens des Herrschers. Die Affäre brachte vielmehr dem Land eine dramatische Auslandsschuld ein, da die Tabakgesellschaft die exorbitante Entschädigungssumme von 500 000 Pfund forderte.
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag seiner Regentschaft (nach islamischer Zeitrechnung) wurde Nasir ad-Din Schah nach dem Besuch des hoch verehrten Mausoleums von Schah Abd ol-Azim (Abd al-Azim) im Süden Teherans am 1. Mai 1896 ermordet. Der Täter, ein enger Vertrauter Dschamal ad-Din al-Afghanis, stammte aus dem Babi-Milieu. In seinen Motiven mischte sich persönliche Rache für Haft und Folter mit sozialem Protest gegen die Lebensbedingungen der unteren Schichten.
Der Nachfolger, Muzaffar ad-Din Schah, entsprach nicht der Präferenz des Ermordeten; er wurde im Einvernehmen von England und Russland auf den Thron gehoben. Zum allgemeinen Entwicklungsstand des Landes vermerkt der britische Orientalist Edward G. Browne, der 1887/88 Persien bereist hat, er habe »almost the last of what may fairly be called medieval Persia« gesehen.14 Zehn Jahre nach seiner Krönung sollte sich Schah Muzaffar ad-Din revolutionären Forderungen nach der Beschränkung seiner Herrschaft durch eine Verfassung und durch den Willen eines gewählten Parlaments gegenübersehen.