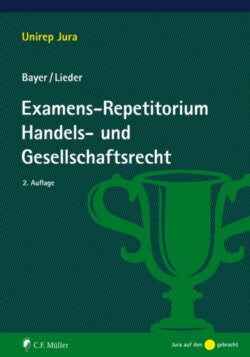Читать книгу Examens-Repetitorium Handels- und Gesellschaftsrecht - Walter Bayer - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Rechtsfolgen
Оглавление89
aa) Die eintragungspflichtige Tatsache kann „von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war“, dem gutgläubigen Dritten „nicht entgegengesetzt werden“. Dies bedeutet: Der Anmeldepflichtige (Unternehmen, Einzelkaufmann, Gesellschafter) – einschließlich seiner Rechtsnachfolger – kann sich gegenüber dem redlichen Dritten nicht auf die Wirkung der eintragungspflichtigen Tatsache berufen, d.h. die Änderung der Rechtslage nicht geltend machen.
90
bb) Der Dritte kann, muss aber nicht die Rechtsfolge des § 15 I HGB für sich nutzen. Er hat vielmehr ein Wahlrecht und kann sich daher auch unter Verzicht auf die Rechtsscheinwirkung für die der Wirklichkeit entsprechende geänderte Rechtslage entscheiden, wenn er dies für günstiger erachtet.[54]
91
cc) Im Schrifttum teilweise auf heftige Kritik gestoßen ist indes die Auffassung des BGH, wonach im Falle, dass die nicht eingetragene Tatsache dem Dritten teils zum Vorteil und teils zum Nachteil gereicht, der Dritte sein Wahlrecht im Sinne einer Meistbegünstigung ausüben dürfe (sog. „Rosinentheorie“).
92
Fall 9[55]
soll die Problematik verdeutlichen:[56] In der A+B-KG ist für die beiden Komplementäre A und B Gesamtvertretung vereinbart, was auch ordnungsgemäß eingetragen und bekanntgemacht wird. Nachdem A, ohne dass dies zum Handelsregister angemeldet wurde, aus der KG ausgeschieden ist, schließt B mit X einen Kaufvertrag. Kann X hierfür den A in Anspruch nehmen?
93
Nimmt man an, dass X sich zwischen der Registerlage und der wahren Rechtslage entscheiden muss, dann wäre in beiden Alternativen ein Anspruch gegen A nicht begründet: Nach der Registerlage hätte B allein die KG nicht verpflichten können, so dass auch keine Gesellschaftsverbindlichkeit begründet worden wäre. Stützt sich X hingegen auf die wirkliche Rechtslage, dann ist zwar ein Anspruch gegen die KG entstanden, doch würde A als ausgeschiedener Gesellschafter für die nach seinem Ausscheiden neu begründete Verbindlichkeit nicht mehr haften.[57]
94
Der BGH und ein Teil der Lehre gehen die Problematik indes anders an:[58] Zunächst wird – wie in der gutachterlichen Klausurlösung – untersucht, ob eine Verbindlichkeit der KG vorliegt; dies ist (nach der wirklichen Rechtslage) unzweifelhaft der Fall, weil nach dem Ausscheiden von A nunmehr der einzige Komplementär B allein zur Vertretung der KG berechtigt ist. Die (noch im Handelsregister eingetragene) Regelung zur Gesamtvertretung ist obsolet geworden und hindert B nicht daran, die KG allein zu vertreten. Da § 15 I HGB nur den Dritten, nicht aber den Anmeldepflichtigen schützen soll, kann sich A auf die fehlerhafte Registereintragung nicht berufen. Für diese KG-Verbindlichkeit haften sowohl A als auch B gem. §§ 128, 161 II HGB persönlich. A kann sich gem. § 15 I HGB gegenüber X nicht darauf berufen, dass er – nach seinem Ausscheiden – kein Gesellschafter mehr ist. Der Anspruch von X gegen A ist daher begründet.[59]
95
Von der Gegenauffassung wird diese Lösung indes als „vordergründig und positivistisch“ zurückgewiesen und als „Rosinentheorie“ diskreditiert. § 15 I HGB wolle den Dritten nur vor Nachteilen aus der unterlassenen Eintragung und Bekanntmachung schützen, ihn aber nicht besser stellen, als er nach der Registerlage stehen würde.[60] Dieser Einwand ist jedoch verfehlt, weil er auf einer Missdeutung des § 15 I HGB beruht. Es ist dogmatisch unzutreffend, den Sachverhalt entweder unter Zugrundelegung der Registerlage oder unter Zugrundelegung der wahren Rechtslage komplett durchzuprüfen. § 15 I HGB darf vielmehr nur bei der tatbestandlichen Voraussetzung ins Spiel gebracht werden, wo das Unterlassen der Eintragung und Bekanntmachung einer eintragungspflichtigen Tatsache zuungunsten des Dritten von der wirklichen Rechtslage abweicht. Dies ist im Beispiel nur im Hinblick auf das Ausscheiden des A der Fall. Die übrige Falllösung richtet sich hingegen allein nach der wirklichen Rechtslage.[61]
96
dd) Bestätigt wird dieses Ergebnis durch ein weiteres „Lehrstück zu § 15 I HGB“[62], das die Problematik der Geschäftsunfähigkeit eines Stellvertreters zum Gegenstand hat.
97
Fall 10:
G ist als Geschäftsführer der D-GmbH in das Handelsregister eingetragen; die Eintragung wurde ordnungsgemäß bekanntgemacht. K ist Inhaber eines von G für die GmbH akzeptierten Wechsels, der nicht bezahlt wurde. Der bei seiner Bestellung gesunde G war später im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wechsels unerkannt geisteskrank.
98
In Betracht kommt ein Anspruch aus Art. 28 I WG. Danach muss der Bezogene – hier: die D-GmbH – den Wechsel bei Ausfall bezahlen, wenn sie ihn wirksam angenommen hat. Dies setzt voraus, dass G im fraglichen Zeitpunkt tatsächlich Geschäftsführer der G war. Indes ist das Geschäftsführeramt des G mit dem Eintritt der (unerkannten) Geisteskrankheit erloschen. Denn zum GmbH-Geschäftsführer kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person bestellt werden (§ 6 II 1 GmbHG).[63] Verliert ein Geschäftsführer nachträglich die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit, so enden automatisch sein Geschäftsführeramt und seine (organschaftliche) Vertretungsbefugnis.[64] Diesen Mangel kann die D-GmbH dem gutgläubigen K jedoch gem. § 15 I HGB nicht entgegenhalten, da die Beendigung des Geschäftsführeramtes und damit die fehlende Vertretungsbefugnis gem. § 39 I GmbHG zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden gewesen wäre.[65] Dass die Beendigung des Geschäftsführeramtes seinen Grund in der fehlenden Geschäftsfähigkeit des G hatte, erklärt der BGH für unerheblich. Zu Recht: Für den Schutz des Dritten im Rahmen des § 15 I HGB ist es ohne Bedeutung, warum die (eintragungspflichtige) Tatsache nicht eingetragen oder bekanntgemacht wurde (Rn. 84).
99
Mit Hilfe von § 15 I HGB wurde indes allein die Tatsache der unrichtigen Geschäftsführerbestellung und damit der Mangel der Vertretungsbefugnis beseitigt, nicht jedoch die Geschäftsunfähigkeit des G als solche. Daher führt die Anwendung des § 15 I HGB auch nicht zu dem Ergebnis, dass die Erklärungen des vermeintlichen Geschäftsführers – entgegen der §§ 105 ff. BGB – als wirksam anzusehen sind. G hat somit zwar mit (unterstellter) Vertretungsbefugnis gehandelt; seine als Vertreter abgegebene Erklärung war jedoch gem. § 105 I BGB nichtig (arg e § 165 BGB).[66] Allerdings kommt eine Haftung der (übrigen) Gesellschafter nach allgemeinen Rechtsscheingrundsätzen[67] in Betracht, wenn sie die Geschäftsunfähigkeit schuldhaft nicht erkannt und deshalb keine Konsequenzen gezogen haben.[68]
100
Merke:
Der Mangel der Geschäftsunfähigkeit kann generell nicht mit Hilfe des § 15 I HGB überwunden werden, da das Erlöschen der Geschäftsfähigkeit keine Tatsache darstellt, die in das Handelsregister einzutragen ist.[69]
101
Daher nochmals:[70] § 15 I HGB führt nicht dazu, dass ein bestimmter Fiktivsachverhalt zugunsten des gutgläubigen Dritten als wahr unterstellt wird – hier: die den Fortbestand der Vertretungsbefugnis gewährleistende Geschäftsfähigkeit des G. Der Schutz der Vorschrift beschränkt sich vielmehr darauf, dass die eintragungspflichtige Tatsache der Beendigung des Geschäftsführeramtes (§§ 6 II 1, 39 I GmbHG) nicht als Einwand geltend gemacht werden kann. Im Übrigen wird der weiteren Falllösung jedoch die wirkliche Rechtslage zugrunde gelegt – hier: die Abgabe einer Willenserklärung vom vermeintlich vertretungsbefugten Geschäftsführer, die jedoch gem. § 105 I BGB nichtig ist.