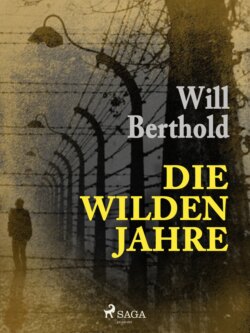Читать книгу Die wilden Jahre - Will Berthold - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII
ОглавлениеDie Mauer zwischen den beiden Freunden war neun Jahre hoch, und so standen sie links und rechts von ihr, in ihrem Schatten geduckt, und versuchten, sie flinkhändig einzureißen. Doch leicht machte es ihnen die Trennwand nicht, und so tauschten sie Banalitäten, leerten Gläser, versicherten sich gegenseitig, wie gut sie aussähen, miteinander sprechend, ohne sich etwas zu sagen.
»Wir fahren zu mir«, sagte Felix schließlich.
Er lief so rasch durch das weiträumige Gebäude der Militärregierung, daß Martin wiederholt hinter ihm zurückblieb; es sah aus, als schäme sich der amerikanische Captain seines deutschen Begleiters, aber Felix wollte zunächst nur Martins Fragen zuvorkommen und auch verhindern, daß er selbst fragte.
Er hatte es schwerer als Martin, der auf die Begegnung eingestellt war. Der Freund war für Felix ein feierliches fernes Denkmal gewesen, vor dem die Erinnerung mit schwindendem Aufwand paradierte. Jetzt stand Martin vor ihm, robust, gesund, beweisend, wie sehr er lebte.
Sie saßen nebeneinander im offenen Wagen. Der Fahrtwind blies den Alkohol aus den Köpfen, den Firnis, mit dem sie die Verlegenheit überzogen hatten. Es war später Nachmittag, Büroschluß, aber die Straßen waren fast ohne Verkehr. Dennoch sah Felix hartnäckig nach vorn, als sei er ein schlechter Fahrer, der pedantisch auf den Verkehr achten müsse; er wollte Zeit gewinnen.
Martin schaute ihn von der Seite an, betrachtete das straffe Gesicht seines Freundes. Er sah die hohe zerklüftete Stirn, er bemerkte das vertraute Wetterleuchten. Er ist älter geworden und reifer, dachte er, geprägt von dem Jahrzehnt, das zwischen uns liegt. Neun Jahre genau: so lange haben die alten Griechen Troja berannt; so viele Leben hat uns die Zeit gestohlen.
»Ich weiß mehr von dir, als du denkst«, sagte Felix. »Ich bin auf deine Militärakte gestoßen, nur …«
Er bog von der Hauptstraße ab, wählte links eine Abkürzung, sah weit vor sich eine Frau in der Mitte der Fahrbahn, die zuerst nach vorn, dann zurück wollte und jetzt unschlüssig stehenblieb; obwohl er leicht an ihr vorbeigekommen wäre, hielt er an.
»… nur wußte ich nicht«, sprach er weiter, »daß dieses Urteil nicht vollstreckt wurde.« Seine Stimme hallte unnatürlich wie in einem leeren Raum. Es kam daher, daß er die Worte einzeln abwog, bevor er sie aussprach, und dadurch den Ton verzog, ihnen den Fluß nahm. »Und so habe ich auch gar keinen Versuch gemacht, dich zu finden.«
Der Wagen stand an der Kreuzung. Obwohl sie frei war, hielt Felix in übertriebener Vorsicht. Nach jeder Seite sichernd, wirkte er unsicher; er achtete auf alles, außer auf den wiedergefundenen Freund.
»Zu dumm«, sagte er, sprach rasch, als sollten seine Worte seine Gedanken überrunden, »es wäre für mich natürlich eine Kleinigkeit gewesen, dich aus diesem verdammten Camp in Reims herauszuholen. Schade um die verlorene Zeit.«
»Ein Jahr mehr oder weniger macht nicht mehr viel aus«, entgegnete Martin, »und auf eins kannst du dich verlassen: Ich werde diese gestohlene Zeit wieder hereinbringen – jeden Tag und jede Stunde!«
Der Wagen hatte den Stadtrand erreicht. Dicke, satte Wolken drohten am Himmel. Die Wälder, Wiesen und Hügel waren von einem finsteren flimmernden Blau.
»Erinnerst du dich an Rothauch?« fragte Martin.
»Ungern.«
»Ich traf ihn zufällig, und er sagte mir, wo ich dich finden kann.«
»Er war bei einer SS-Einheit, die im Osten Polen und Juden …« Felix brach ab.
»Warum stellt ihr ihn nicht vor Gericht?« fragte Martin.
Der Captain antwortete stumm mit der gleichen resignierenden Geste, die Martin schon wiederholt an ihm bemerkt hatte, und sie mochte vielleicht heißen: Was geht es mich an? Oder: Es gibt zu wenig Ankläger. Oder: zu viele Schuldige.
»Nun muß ich leider zur Sache kommen«, sagte Martin. Er mißdeutete das Verhalten des Freundes. »Mein Vater war damals in der Kristallnacht in Frankfurt schuld daran, daß …«
»Das weiß ich«, unterbrach ihn Felix. Es hörte sich an, als spräche er mit vollem Mund.
»Und«, fuhr Martin fort, bestrebt, es rasch hinter sich zu bringen, »er wurde in Landsberg …«
»Auch das weiß ich«, sagte Felix und sah sich um wie gehetzt. »Bitte«, setzte er hinzu, bemerkte die Tankstelle am Wegrand und lief sie an wie ein Versteck. »Wollen wir nicht später …?«
Der Tankwart trug einen schmutzigen Overall und bettelte um eine Zigarette.
Es gingen nicht einmal zwölf Liter in den Tank. Der Mann betrachtete den Captain verwundert, denn er konnte nicht wissen, daß Felix gar nicht auftanken, sondern nur ausweichen wollte.
Endlich erreichten sie die Villa, die Felix bewohnte. Wieder ging der junge Captain so zielstrebig durch den Vorgarten, als wollte er Martin entfliehen; er eilte über den Flur zum Schrank und ergriff, sichtlich erleichtert, eine Whiskyflasche, nahm zwei Gläser, schenkte ein, drehte sich zu Martin um, reichte ihm, an den Augen des Freundes vorbeispähend, ein Glas und sagte:
»Cheerio!«
»Auf uns«, erwiderte Martin und ging im Raum umher, blieb vor Schränken, Truhen und Klubsesseln stehen, die er interessiert betrachtete. Er wollte Felix die Zeit lassen, die er brauchte, und ging deshalb das Mobiliar durch: genormte Stücke von auffälliger, aufdringlicher Schlichtheit, die wohl den Besitzer trotz sichtbaren Reichtums als einen Mann von spartanischer Lebensführung ausweisen sollten. Martin wunderte sich; diese Einrichtung paßte nicht zu Felix.
»Es ist nicht mein Geschmack«, erklärte der Freund, »es ist auch nicht mein Haus. Sein Besitzer braucht es nicht, weil er in einer Baracke wohnt, ein Nazirichter namens Link, und mein Gastspiel in Deutschland ist hoffentlich so kurz, daß sich Anschaffungen nicht lohnen.« Er trank sein Glas aus, Martin flüchtig zuprostend, und füllte sofort nach.
»Du trinkst viel?« fragte Martin.
»Zuviel – und du?«
»Das richtet sich nach der Gelegenheit«, antwortete Martin.
Er ging auf eine Klubgarnitur zu, zog den Freund hinter sich her, drückte ihn in einen Sessel und sagte:
»So, und nun sprechen wir miteinander und stellen diese Sache ein für allemal klar.« Er wartete, bis ihn Felix ansah. »Einverstanden?« Einer Antwort zuvorkommend, setzte er hinzu: »Mein Vater hat also damals in Frankfurt …«
»Du brauchst mir nichts zu erklären« erwiderte Felix. »Ich weiß alles. Seit Jahren. Ich habe es schon Wochen danach erfahren, in Amerika. Und ich kam mit dem Vorsatz – du verstehst mich doch? –, ihn, deinen Vater, für die Tat an meinem Vater, dafür also …«
Felix blickte auf den Boden.
Martin merkte, daß er, statt den alten Ritt anzuklagen, sich selbst verteidigte. »Er hat es nicht anders verdient«, sagte er mit fester Stimme, »und ich verstehe nicht, wie du …«
»Es mag sein, daß er sein Ende verdient hat.« Felix stand auf, kehrte dem Freund den Rücken, holte den Behälter mit Eis, trug ihn zurück, schüttelte die Würfel; es hörte sich an, als schlügen im plötzlichen Frost Zähne aufeinander. »Hör mir gut zu, Martin, ich wollte dieses Gespräch verschieben, aber es hat keinen Zweck, ihm auszuweichen; es wäre nur feige und dumm, und du mußt erfahren – gerade du …«
Felix stellte den Eisbehälter ab. Er sah Martin an. Seine Pupillen glänzten.
»Ich habe deinen Vater gesucht, gejagt und gestellt. Ich – ich habe das Urteil von Dachau erwirkt.«
»Nun, und?« fragte Martin.
»Er war nicht schuldig.«
»Was sagst du da?«
»Nicht in dieser Sache«, antwortete Felix.
»In welcher Sache?«
»Wegen der man ihn hängte.«
»Macht das einen Unterschied?« fragte Martin schroff. »Ich bin ein Realist – mich interessiert, ob ein Mensch schuldig ist oder nicht. Der Text des Urteils ist mir gleichgültig. Es scheint mir unwichtig, ob mein Vater«, er biß auf das Wort wie auf einen Stein, »gehängt wurde, weil er Polen und Russen in das KZ einweisen ließ – oder wegen des Mordes an deinem Vater –, einer mußte ihn anklagen und einer das Urteil sprechen.«
»Du willst mich nicht verstehen«, sagte Felix, »ich habe …«
»Ich bin mit dem Vorsatz aus dem Krieg zurückgekommen«, unterbrach ihn Martin, »Männern seines Schlages heimzuzahlen, was sie an mir, an dir, an deinem Vater, an unserer Generation verbrochen haben –. Ich hätte ihn selbst – wie hast du doch gesagt, Felix? – gesucht, gejagt und gestellt.«
»Du weißt noch nicht alles«, sagte Felix. Er sprach langsam und bedächtig, als reihe er die Buchstaben wie Perlen auf eine Schnur, falsche Perlen, Glasperlen, Plunder. »Du weißt nicht, wie ich das Urteil erwirkt habe.«
»Und?« fragte Martin und spürte Unbehagen, weil ihn Felix so unverwandt und aggressiv musterte, daß sich die Blicke des Freundes wie zwei spitze Nadeln in sein Gesicht zu bohren schienen.
»Ich habe Zeugen erpreßt und bestochen. Ich habe sie zum Meineid gedrängt – und …«
Die Schnur riß. Die Perlen fielen zu Boden. Sie rollten unter die Kommoden und Tische.
»Also los«, Martins Stimme stieß an die Zähne, »erzähl deinen Roman. Mach es rasch – und laß endlich den dummen Schnaps stehen!«
Felix sprach langsam, eindringlich. Zwischendurch betrachtete er den Freund, wie damals an der Universität, als er ihm immer und immer wieder vorschlug, den Verkehr mit ihm aufzugeben, und dabei in Martins Gesicht nach verhohlener Zustimmung suchte. Die verblaßte Erinnerung stand wieder vor ihm, nahm Farbe an, Kontur, Jahre waren weggewischt, die Mauer übersprungen, auch wenn Felix das noch nicht wußte und erst nach und nach begriff, daß sein Freund ein Freund geblieben war und bleiben würde.
Während Felix sprach, brach draußen das Gewitter los, tobte der Wind gegen die Hauswand, prasselten dicke Tropfen an die Fensterscheiben, hinter denen sich die drückende Schwüle verschanzt hatte.
Immer wieder sah Felix zu Martin, verstand nicht seinen Gleichmut: Sosehr ihn seine Haltung beruhigte, so wenig konnte er sie begreifen. Sie schien ihm so unnatürlich, daß sie ihn fast störte.
»So habe ich also«, schloß Felix, »planmäßig und vorsätzlich einen in diesem Fall Unschuldigen …«
»Es reicht!« schnitt ihm Martin das Wort ab und stand auf. Er sah, wie der Freund wieder nach der Flasche griff, nahm sie ihm weg, knallte sie auf den Tisch.
»Jetzt bin ich an der Reihe. Hör mir gut zu, denn ich möchte nie mehr darüber sprechen: Der Mann, um den es geht, ist mir fremd, obwohl ich sein Sohn bin.«
Martin sprach ruhig, gezielt, abgehackt: »Schon als er mir die Mutter nahm, mochte ich ihn nicht; als er deinem Vater die Fabrik abpreßte, verachtete ich ihn. Ich habe ihn gehaßt, als mir im Krieg Dreck und Kugeln um den Kopf flogen, als ich den ersten Toten eingrub und die ersten zerfetzten Därme sah.« Grimmig fuhr er fort: »Als ich im Lazarett verwundet unter der Sauerstoffmaske lag und nach drei Tagen zum Bewußtsein kam, sah ich keine Schwester, hörte keinen Arzt, achtete ich nicht auf die Diagnose: ihn sah ich, fahlgelb, betrunken und randalierend in dieser Mostrichuniform. So sah ich ihn im Kriegsgefangenen-Camp, auf der Fahrt hierher. Wegen dieses Bildes habe ich mich auf die Heimkehr gefreut. Wir – wir sind Zwillingsbrüder des Hasses, mein Lieber …«
Martin blickte nach draußen, als betrachte er die schwefelgelben Blitze, denen der Donner in weiter Entfernung folgte.
»Zurück zur Sache: Wenn wegen dieses Urteils einer mit dir hadern kann, dann bin ich es. Du hast mich um die Abrechnung gebracht. Du hast mir den Wahn vieler Jahre genommen. Verstehst du das? Einem Toten gegenüber habe ich keinen Haß mehr. Er ist mir so fremd wie Millionen andere, die in diesem Krieg umgekommen sind, schuldig und unschuldig, einer neben dem anderen.«
Felix sah zu Martin auf, ungläubig, betroffen, gebannt, fasziniert.
»Im übrigen schaue ich nicht mehr nach hinten«, erklärte Martin, »sondern nach vorn. Mein Vater ist tot, und mit ihm ist unser Problem gestorben, und ich möchte nie mehr über diese Sache sprechen. Haben wir uns verstanden?«
Felix lächelte dünn. Die Falten in seinem Gesicht wirkten wie die ersten Sprünge auf einer Eisfläche.
»Es geht auch gar nicht um unsere Väter«, fuhr Martin fort, »sondern um uns. Allenfalls ist die Frage zu klären, ob ein Captain der amerikanischen Armee und ein Entlassener der deutschen Wehrmacht Freunde sein können. Kapiert?«
Martin riß die Fenster auf.
Von draußen strömte saubere, vom Regen gewaschene Luft in den Raum und nahm ihm die brackige Schwüle. Die Sonne brach durch die abziehenden Wolken. Der Tag wurde wieder licht; die Bäume im Garten glänzten im neuen Grün.
Die beiden Freunde standen nebeneinander und betrachteten schweigend den Regenbogen in seinen phantastischen Farben, der wie eine Traumbrücke war, die sie tragen würde. Ihre Gesichter waren entspannt, ihre Hände ruhig.
Das Gewitter hatte den Tag gesäubert.