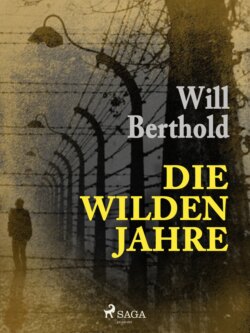Читать книгу Die wilden Jahre - Will Berthold - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIII
ОглавлениеDurch nichts ließ Martin in den nächsten Wochen erkennen, daß er am Anfang einer Karriere stand, die von der Boulevardpresse später als »ein märchenhafter Aufstieg ohne Beispiel« gefeiert werden sollte.
Er gewöhnte sich an die wortreichen Tiraden der Frau Brenner, seiner Quartiergeberin; sie plädierte stets für ihren Mann, einen städtischen Oberinspektor, der fristlos aus dem Dienst entlassen worden war. Ihr Mann, so führte sie aus, hätte unter der braunen Bewegung gelitten und wäre seiner Familie zuliebe 1937 in die Partei eingetreten, lediglich, um Beiträge zu entrichten. Sei das ein Grund, ihn aus dem Amt zu entfernen?
Martin verneinte.
Es waren Gespräche, die an jeder Straßenecke, an jedem Schalter, auf jeder Anklagebank zu hören waren. Überall beteuerten Menschen ihre politische Unschuld, auf ihr schweres Schicksal verweisend; und das Tragische war, daß viele von ihnen recht hatten. Im Netz einer oberflächlichen, summarischen Säuberung blieben vorwiegend die kleinen Fische hängen, denn die Hechte lagen auf Grund oder Untergrund.
Martin war nach Frankfurt zurückgekehrt, um seine Übersiedlung nach München vorzubereiten, wo ihm Felix eine Wohnung beschaffen wollte. Das gesamte Vermögen des alten Ritt unterstand der Property Control, der amerikanischen Vermögensverwaltung. Über einen befreundeten US-Major wollte Felix versuchen, zunächst wenigstens das persönliche Eigentum des Freundes freizubekommen.
Bis dahin saß Martin untätig in Frankfurt herum, warf Rothauch, den lästigen Mitschüler, der Bescheinigungen für sein Spruchkammerverfahren sammelte, hinaus, schlief unter dem Bild Erwins, des Gefallenen, das mit Wachsblumen geschmückt war und ihm zulächelte. Erwin und Martin wurden Kameraden des Zufalls.
Das Leben der Familie Brenner war streng geordnet. Zuerst kam der Kirchenbesuch. Der Oberinspektor war auch während des Dritten Reiches zur Kirche gegangen, aber was er damals verstohlen getan hatte, demonstrierte er jetzt.
Nicht nur er. Auch andere, die früher dem Gottesdienst ferngeblieben waren, betonten jetzt ihr Christentum. Die Kirchentüren öffneten sich weit wie Scheunentore, in die die Ernte eingefahren wurde: mancherlei Fallobst war darunter, das bald von beflissenen Winzern zum Most der Macht vergoren werden sollte.
Dieser Andrang verbitterte den städtischen Oberinspektor Brenner, weil die großzügigen Atteste, die recht bereitwillig ausgestellt wurden, die Bescheinigungen der Leute entwerteten, die, wie er, zur Religion gestanden hatten, zu deren Wesen es freilich wiederum gehörte, zu verzeihen.
Den zweiten Rang nach dem Umgang mit der Kirche nahmen Brenners tägliche Gänge zu Verwandten, Bekannten, Untergebenen und Vorgesetzten ein, die ihm seine anständige Vergangenheit schriftlich bestätigen sollten.
Zu dieser Zeit sammelten die Frauen Kleinholz und die Männer Persilscheine wie dieser Oberinspektor, der dicke Leitzordner damit füllte, da er annahm, vor der Spruchkammer wöge ein Kilogramm Papier schwerer als die einfache Wahrheit.
An dritter Stelle des Alltags stand der Schulbesuch Guidos, der in die fünfte Klasse des Gymnasiums ging, frech und frisch, und zudem der Krösus der Familie war. Er hatte damit begonnen, deutsche Orden an amerikanische Souvenirjäger zu verkaufen, hatte daran auf dem Umweg über Zigaretten ein Fahrrad und einen Fußball verdient und den Schwarzhandel mit den Ehrenzeichen aufgegeben, als er merkte, daß er durch das im übrigen lästige Klavierspiel genausogut verdienen konnte. Er mußte täglich unter Aufsicht seiner Mutter eine Stunde üben, und wenn sie den Raum verließ, stellte er zwecks Abkürzung der lästigen Etüden die Uhr vor, weshalb bei Brenners immer die Stunde vorauseilte, obwohl sie doch sonst notorisch hinter der Zeit blieben.
Guido hatte im amerikanischen Soldatensender einige Modeschlager aufgefischt und konnte sie jetzt ganz leidlich klimpern, wozu ihn Anny, die zweite Untermieterin der Familie, ermunterte, die hauptberuflich im Dienst der deutsch-amerikanischen Verständigung stand, was die bürgerliche Moral der Familie Brenner häufig durch amerikanische Konserven belastete.
Anny, nach der Entnazifizierung des Hausherrn der wichtigste Gesprächsstoff der Familie und willkommene Abwechslung Martins, sah aus wie ein verblaßter Rauschgoldengel, der dringend renoviert werden mußte. Sie hatte kurze blonde Haare und ein kaum stillbares Verlangen nach Männern, dem sich Martin bislang mit Erfolg entzogen hatte, nicht aus Gründen der Moral oder um Frau Brenner gefällig zu sein, sondern weil er es nicht verstand, wie es ein Mann mit einem verblaßten Rauschgoldengel haben konnte. Aber die Burschen aus Übersee kamen in Scharen, und Anny mußte ihnen erst beibringen, mit ihrem Jeep am Hinterausgang des Hauses vorzufahren, weniger weil sie sich vor den Nachbarn genierte, sondern weil die GIs aus Texas und Alabama dicke Pakete mitbrachten, die zeitweilig in der Badewanne der Brenners eingelagert werden mußten.
Dann machte es sich Anny, wie sie sagte, gemütlich, und Guido, der Sechzehnjährige, mußte sich an das Klavier setzen und You belong to my heart oder No can’t do herunterklimpern, obwohl Anny ziemlich viel mit sich tun ließ. Wenn aber Guido, dessen Musikalität mit Zigaretten und Schokolade honoriert wurde, Don’t fence me in spielte, schossen dem Rauschgoldengel die Tränen aus den Augen, denn Anny war eingesperrt gewesen, in einem Arbeitslager, wegen geselligen Umtriebs mit ausländischen Arbeitern, welches Delikt freilich mehr nymphomanisch als politisch bedingt gewesen war.
Jedenfalls brachte sie einen gewaltigen Nachholbedarf mit; es führte häufig zu Schwierigkeiten im Parteienverkehr, wenn der eine Uniformierte in den Schrank kriechen mußte, während der andere seine Liebe gestand, der Dritte sich im Badezimmer aufhielt und ein Vierter schon im Anmarsch war. Zuletzt gewannen die olivgrünen Soldaten meist einträchtig, aber geschlagen, wieder das Freie.
Dann jeweils begannen die Gewissensfragen der Frau Brenner, die einerseits ihre »politische« Untermieterin fürchtete und deshalb Geschenke nicht zurückweisen wollte, andererseits zu anständig war, um sich an dem Treiben »einer solchen« zu bereichern. Aber was hieß schon bereichern, wenn die ganze Familie Hunger hatte und auch der andere, anständige, wenn auch ebenfalls politische Untermieter Martin Ritt als alleinstehender Junggeselle einmal etwas Warmes im Magen haben sollte? Zumal sich seine Quartiergeberin längst überlegte, wie sie ihn in den Feldzug zur Rehabilitierung ihres Mannes einspannen könnte, was immerhin schwierig war, da der Verfolgte den Belasteten erst seit ein paar Wochen kannte.
Aber die resolute Frau sagte sich, daß, wo ein Wille, ein Weg sei; und so saß Martin notgedrungen am Familientisch und aß das mittels Zwiebeln und Petersilie veredelte Cornedbeef aus der Büchse, dazu geröstete Kartoffeln und grünen Salat, auf dem Guido lustlos herumkaute.
»Nun iß!« sagte Frau Brenner zu ihrem Jüngsten. Sie sah zu dem Zimmer, in dem Anny vermutlich wieder nicht allein schlief, verzog den Mund und sagte: »Die ist noch nicht aufgestanden. Noch immer nicht.« Sie wandte sich an Martin, der froh war, beim Thema Nummer zwei zu sein. »Sie mag ja Schweres durchgemacht haben«, fuhr Frau Brenner fort, die Stimme dämpfend, »aber das geht doch wohl zu weit – meinen Sie nicht auch, Herr Ritt?«
Der gewesene Oberinspektor sprach wenig. Er litt. Um seinen Beruf zu erhalten, war er in die Partei eingetreten; nun hatte er ihn deswegen verloren – das begriff er nicht.
»Es geht mir ja nur …« Frau Brenner betrachtete Guido. »Es kommen ja einmal wieder normale Zeiten und dann …«
»Und dann?« fragte der Junge ungezogen mit vollem Mund. »Sagt ihr dann wieder, daß ihr gezwungen wart, mitzumachen?«
»Guido!« verwies ihn die Mutter und wandte sich wieder an Martin: »Gewiß, wir haben den Krieg verloren – aber muß ich so etwas in meiner Wohnung dulden, selbst wenn mein Mann bei der Partei war?«
»Ich glaube nicht«, erwiderte Martin ernsthaft.
»Dann verbiet ihr doch, daß sie es mit den Amis treibt!« rief Guido laut.
»Pst!« erwiderte Frau Brenner. »Und drück dich nicht so gewöhnlich aus! Da sehen Sie es, Herr Ritt, wie das abfärbt, wie …«
»Wie was abfärbt?« fragte der Junge. »Das Cornedbeef? Das Fett? Warum redet ihr von Moral und freßt doch das Zeug? Wo ist denn das Fleisch her? Womit hast du die Soße gemacht?«
«Guido, ich bitte dich!« sagte der stille Oberinspektor scharf.
»Entschuldigen Sie«, wandte sich seine Frau an Martin.
»Habt ihr nicht erlebt«, fuhr der Junge fort, »wie weit ihr mit euren Schwindeleien gekommen seid? Und jetzt schwindelt ihr schon wieder!«
Er stand auf, warf die Serviette auf den Tisch:
»Warum sprichst du mit ihr? Warum gibst du ihr die Hand? Warum wirfst du ihr den Plunder nicht vor die Füße? Warum wohl?« Guido beugte sich zornig zu seiner Mutter hinab: »Weil du satt werden willst. Ich auch. Dann laßt aber gefälligst das dumme Gefasel von Moral und so!«
Der Junge warf die Tür hinter sich zu.
Seine Mutter weinte.
»Es tut mir leid, Herr Ritt«, klagte sie zwischen Tränen, während ihr Mann sich lautlos schämte, »aber Sie sehen ja, wie die Kinder in dieser Zeit verwildern.«
»Es wird schon alles werden«, sagte Martin und folgte Guido.
Draußen schloß er mit dem Jungen Freundschaft und träumte davon, daß die heranwachsende Generation aus lauter wilden, respektlosen Guidos bestehen möge.
Am nächsten Tag fuhr ein Jeep vor, der nicht am Hinterausgang hielt, sondern auf der Straßenseite. Ein dicklicher GI keuchte die Treppe herauf und fragte sich nach Martin durch. Er hatte Befehl, ihn in das Hauptquartier der Frankfurter Militärregierung zu schaffen, das im beschlagnahmten Hochhaus der IG-Farben lag, deren Direktoren zur gleichen Zeit vom Nürnberger Militärtribunal abgeurteilt wurden.
»Es tut mir leid«, begrüßte ihn ein Major mit einem Pferdeschädel, der schriftdeutsch mit leicht schwäbischer Klangfarbe sprach, »einem Freund von Captain Lessing hätte ich gern geholfen, aber ich komme selbst nicht durch das Gestrüpp der verdammten Bürokratie.« Er bot Martin eine Zigarette an. »Es kann noch Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis ich aus dem Vermögen Ihres – Ihres Vaters …«
»Ich habe nicht die Absicht«, unterbrach ihn Martin, »etwas aus dem Vermögen meines – meines Vaters an mich zu nehmen.«
»Nonsens«, knurrte der Pferdekopf, »mit Ressentiments kommen Sie nicht weiter, Mr. Ritt.« Er sah seinen Rauchringen nach, die wie kleine Schlingen aussahen. »Wir haben eine Möglichkeit gefunden, Ihnen wenigstens unter der Hand zu helfen.«
Die Waldhütte, die der alte Ritt während des Zusammenbruchs als Zuflucht benutzt hatte, diente jetzt einem Colonel als Jagdhaus. Der Offizier war damit einverstanden, daß Martin sich dort holte, was er für brauchbar hielt, und ließ ihm den Schlüssel überreichen. Der Major von der Property Control lieh ihm Jeep und Fahrer für den ganzen Tag.
Eine Stunde später stand Martin mit zwiespältigen Regungen vor der Jagdhütte. Sie lag in einer Waldlichtung, die von der Sonne verwöhnt wurde, an leicht erhöhter Stelle, von Mischwald umsäumt.
Das Schloß war eingerostet, der Schlüssel brach ab. Der dicke Amerikaner fluchte, riß den morschen Holzladen auf, schwang sich auf den Sims, trat mit dem Gummistiefel die Scheibe ein, setzte das Käppi nach hinten, grinste und sagte:
»All right – go in!«
Spinnweben streiften Martins Gesicht. Verbrauchte Luft schlug ihm entgegen. Er kam sich, als er das zwecklose Asyl seines Vaters betrat, wie ein Grabräuber vor. Er riß die anderen Fenster auf. Das Licht fiel auf eine dicke Staubschicht, mit der die Zeit den Raum gepudert hatte. Langsam vertrieb der Luftzug den Geruch von Holz, Nässe und Fäulnis.
Martin wollte nicht an seinen Vater denken, aber er spürte unwillkürlich die Angst und die Einsamkeit, die der alte Mann erlebt haben mußte. Er hat, so dachte Martin, gefehlt und gebüßt – mehr gebüßt als andere, die unbehelligt blieben –, und diese glatte Rechnung erlaubt es mir, mich mit ihm auszusöhnen.
Martin sah sich um und spürte beim ersten persönlichen Kontakt, den er seit vielen langen Jahren mit der Welt seines Vaters hatte, Mitleid.
Er schüttelte es ab und begann, die Schränke und Truhen zu durchsuchen. Er fand Anzüge, deren Hosen und Ärmel ihm zu kurz und deren Jacken ihm zu weit waren. Gutes Material, das man ändern konnte, aber Martin faßte die Kleidungsstücke mit spitzen Fingern an. Zwischen den Socken stieß er auf das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz und steckte es lächelnd für Guido ein, der für dieses seltene Ehrenzeichen mindestens hundert Zigaretten herausschlagen würde.
Die Ausbeute war schmal. Martin hatte es nicht anders erwartet. Er war auch nur gekommen, weil Felix es vorgeschlagen hatte. Er war Überlebender und wollte nicht mehr nach hinten sehen.
Auch das Bücherregal versprach wenig. Brehms Tierleben hielt sich noch aufrecht; die Germanischem Heldensagen waren schräg abgerutscht, und Grimms Volk ohne Raum lag mit dem Gesicht im Staub, umrahmt von Kriminalromanen.
Hinter der Badezimmertür hing ein schwarzes Nylonnegligé, das vermutlich der Gefährtin des derzeitigen Hausherrn gehörte. Martin ging weiter in den Keller, stieß auf leere Wein-und Kognakflaschen, auf weggeworfene Schuhe mit defekten Absätzen und ein Radiogerät, Marke Volksempfänger, das bei der letzten Party in Stücke gegangen war.
Schließlich ging die Rechnung dieses Tages auf: Martin hatte keinen Nachlaß erwartet und auch keinen vorgefunden. Er nahm zwei getragene Anzüge unter den Arm und pfiff vor sich hin, wollte durch die Tür, merkte, daß er den Weg durch das Fenster nehmen mußte, und stieß an einen Stuhl, der gegen die holzverkleidete Wand polterte. Er setzte das Kleiderbündel ab, und während er den Stuhl aufhob, sah er zum zweitenmal den Riß über einer Ausbuchtung der Holzvertäfelung, betrachtete ihn genau und erfaßte, daß in einem Hohlraum etwas versteckt war.
Er nahm ein Streichholz, leuchtete hinein und sah ein Bündel Akten. Bevor er sie durchsah, wußte er schon, daß er auf das Fluchtgepäck seines Vaters gestoßen war.
Er fand im ersten Ordner einen ganzen Block Reisemarken, die ungültig waren. Ein dickes Bündel Geldscheine fiel zu Boden, Papiermark, die noch zählte. Er schob sie so achtlos in die Tasche wie das Ehrenzeichen, schaute in den zweiten Ordner und stieß auf geballten Unrat des braunen Systems: Intrigen, Verleumdungen, Verdächtigungen; Momentaufnahmen aus dem Dritten Reich, der Gemeinschaft von Erpressern und Erpreßten.
Als er diesen Abfall auf den Müllhaufen werfen wollte, stieß er auf den Namen Kahn.
Er kannte vier Kahns, und am besten von ihnen Lydia, die Tochter, eine dunkelhaarige, hochbeinige Zwanzigjährige mit schelmischen Augen und einer kecken Figur, das Gegenteil ihres Zwillingsbruders Jakob, der verschlossen und ernst wie sein Vater war und seine Jugend vergessen hatte.
Martin sah Lydia vor sich, im Weiß des plissierten Tennisrocks, das ihre Beine noch gebräunter wirken ließ. Sie flirtete lebhaft herum, ohne sich festzulegen. Ihre großen dunklen Augen mußten viel Trauriges ansehen, aber sie blieben lustig bis zuletzt. Lydia machte in schwerer Zeit ihren Eltern das Leben leichter und einigen ihrer Hasser die Verfolgung schwerer. Sie lächelte die Braunhemden sorglos an, lachte sie aus, und liebte es – wenigstens in der ersten Zeit –, die Augen singender Kolonnen auf sich zu ziehen, obwohl der Vorbeimarsch auf der anderen Seite abgenommen wurde.
Lydia leugnete die Gegenwart, verlachte die Zeit und spielte mit Martin Tennis, solange man sie noch auf den Platz ließ. Sie glich ihrer Mutter und hatte wenig vom Vater, einem Ingenieur, der auf ein halbes Dutzend Erfindungen Patente besaß; diese waren seine Einlage der Werke Lessing & Kahn, die sich mit Metallveredelung befaßten.
Lessing, der Vater von Felix, war der Kopf des Unternehmens; Kahn, sein Teilhaber, die Hand, deren Geschick auch während der wirtschaftlichen Depression der dreißiger Jahre der Fabrik die Vollbeschäftigung bewahrt hatte. Dann kam die Rüstung – allerdings unter neuer Leitung.
Unvermittelt schwand vor Martin das Bild eines lustig flatternden Tennisrocks. Die Buchstaben kreiselten wie Insektenschwärme. Der Schriftwechsel in seiner Hand wog schwer: Aus den vergilbten Blättern schlug ihm Blutgeruch entgegen. Er zwang sich zum Lesen, versuchte, die pedantisch nach Daten geordnete, durch Briefe und unterschriebene Notizen belegte Ungeheuerlichkeit zu begreifen.
4. März 1941:
Frederic Panetzky, Inhaber einer Import-Export-Firma in Zürich, Talstraße, läßt durch Kurier unter Berufung auf die alte Geschäftsverbindung Friedrich Wilhelm Ritt einen vertraulichen Brief überreichen, in dem er anfragt, ob die vierköpfige Familie Kahn noch am Leben sei und ob eine Möglichkeit bestünde, ihr zur Auswanderung zu verhelfen. »Ich bin ermächtigt«, heißt es, »in einem solchen Fall im Namen amerikanischer Verwandter der Kahns, die in Philadelphia, Pennsylvania, leben, ein lukratives Angebot (in Dollars) zu machen. Die Summe, deren genaue Höhe noch auszuhandeln ist und die zur Begleichung der Unkosten usw. dienen soll, würde bei einer Zürcher Privatbank hinterlegt und nach dem Eintreffen der Auswanderer in der Schweiz ohne jede Nachfrage und auch ohne jedes Risiko an mich zwecks Weiterleitung ausgehändigt.«
5. März 1941:
Friedrich Wilhelm Ritt erkundigt sich bei einem alten Korpsbruder, z. Zt. Abteilungsleiter im Reichssicherheitshauptamt, Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, ob ihm ein Frederic Panetzky, Zürich, usw. bekannt sei.
6. März 1941:
Gaufachschaftsleiter Egon Silbermann teilt »dem alten Kameraden Ritt« auf Anfrage mit, daß die Juden Kahn, Vater, Mutter, Sohn und Tochter zur Zeit in einem Arbeitslager auf ihren Transport in den Osten warteten, der spätestens in einigen Wochen erfolge. »Zwar habe ich seit meiner Rückkehr von der Frontbewährung mit diesen SD-Aktionen nichts mehr zu tun, aber ich könnte immerhin aufgrund alter Beziehungen unter Umständen eingreifen. Wenn Du mir also rechtzeitig mitteilst, was mit diesen Juden geschehen soll, werde ich versuchen, Deine Wünsche entsprechend berücksichtigen zu lassen.«
7. März 1941:
Sturmbannführer K. vom RSHA teilt Friedrich Wilhelm Ritt »streng vertraulich« mit, daß es sich bei Fritz Panetzky um einen Rein-Arier handle, der zur Zeit der k. u. k. Monarchie in Lemberg geboren wurde, es aber 1918 abgelehnt habe, Pole zu werden. »Später schlug sich der Mann als Staatenloser nach Deutschland durch und stellte ein Gesuch auf Einbürgerung. Bei der Überprüfung dieses Antrages kam er mit einer Dienststelle in Berührung, die ich im Reichsinteresse selbst Dir gegenüber nicht näher benennen kann. Panetzky übersiedelte dann nach Zürich, und gründete dort eine Firma; er hat sich offensichtlich bei vielen Aufträgen sehr bewährt. Obwohl er vom Endsieg des Führers überzeugt ist, würde ich ihm mit einer gewissen Vorsicht begegnen.«
9. März 1941:
Aktennotiz über eine Auslandsreise in die Schweiz:
»Sodann teilte ich Panetzky bei einer persönlichen Unterredung mit, daß ich mich für die Auswanderung der mir persönlich bekannten Familie Kahn verwenden würde, falls Pg. Silbermann von der Gauleitung keine Bedenken äußere und das Reich die für seinen Schicksalskampf so nötigen Devisen erhielte. Ich schlug vor, daß die amerikanischen Verwandten der Juden pro Kopf der Auswanderer fünfundzwanzigtausend Dollar, insgesamt also hunderttausend Dollar, hinterlegen sollten, die später auf noch festzulegende Weise der Deutschen Reichsbank …«
2. April 1941:
Panetzky läßt in einem Brief aus Zürich wissen, daß die amerikanischen Verwandten der Kahns mit der Abwicklung »der Sache« zwar grundsätzlich einverstanden seien, aber angeblich hunderttausend Dollar nicht aufbringen könnten und die Hälfte dieser Summe vorschlügen, die sofort überwiesen würde. »Trotzdem erscheint mir dieser Betrag zu gering, zumal ich weiß, daß es sich bei den Verwandten um steinreiche Leute handelt. Um die Aktion selbst nicht durch ein langes Gefeilsche zu gefährden, schlage ich vor, einen der vier Juden – möglichst nicht die Mutter, da es sich bei ihr um die direkte Verwandte der Amerikaner handelt – mit dem nächsten Transport nach dem Osten zu verschicken. Ich bin ganz sicher, daß dann das Geld, und zwar die volle Summe, sofort auf den Tisch kommen wird, wenn man den Leuten in Übersee glaubhaft klarmacht, (vielleicht durch einen Abschiedsbrief oder dergleichen), in welcher Gefahr jüdische Parasiten heutzutage in Deutschland schweben.«
3. April 1941:
Handschriftliche Notiz von Friedrich Wilhelm Ritt: »Ich kann die von Panetzky vorgeschlagene Maßnahme nicht gutheißen und distanziere mich hiermit von dem ganzen Auswandererplan. Selbst wenn ich bedenke, daß es sich bei den Kahns um Menschen handelt, die zu den natürlichen Feinden unseres Volkes gehören, möchte ich doch aus rein menschlichen Gründen eine solche Härte …«
4. April 1941:
»Lieber Kamerad Ritt, … ich bin absolut mit Dir einer Meinung, daß wir uns an Panetzkys Plan in Sachen Kahn nicht beteiligen können. Selbst wenn es mir gelänge, meine rein humanen Argumente auszuschalten, könnte ich schon aus technischen Gründen bei einem solchen Vorhaben gar nicht mitwirken. Als Leiter der Rechtsabteilung beim Gauleiter habe ich mit den Judentransporten glücklicherweise nichts zu tun. Stets zu Deinen Diensten! Dein Egon Silbermann.«
Martin war auf der vorletzten Seite der Akte, die wohl ebenso ein Alibi für Menschenhändler wie eine Kapitalanlage für die Zukunft sein sollte. Und schon bevor er umblätterte, wußte er, wie es weitergehen würde.
Seine Augen brannten. Er sah nach draußen, wunderte sich, daß es nicht regnete, sondern die Sonne schien. Er wandte sich wieder der Vergangenheit zu: dem Vater als Lieferanten, Panetzky als Zwischenhändler, Silbermann als Prokuristen – und den Kahns als Handelsware, deren Preis durch Verminderung des Angebots von vier auf drei hochgehalten werden sollte.
Es war still im Raum. Martin hörte seinen eigenen Atem. Wer, fragte er sich, wer? Der alte Kahn, der nur für seine Firma und seine Familie gelebt hatte? Jakob, der Sohn, der niemals jung gewesen war? Lydia, das lustige Tennismädchen?
Wer von den vier hatte für das Lösegeld der anderen drei sterben müssen, für den Tausch: Geld gegen Blut?
Während Martin das Blatt wendete, schienen Bälle gegen seinen Kopf zu fliegen, harte, schnelle weiße Tennisbälle: Schmetterbälle, Flugbälle, Matchbälle. Aufschlag – Treffer. Vorhand – Treffer. Rückhand – Treffer. Treffer. Treffer …
Martin zog den Kopf tief in die Schultern und las:
2. Juni 1941:
Panetzky teilt dem Reichstagsabgeordneten Ritt der Ordnung halber mit, daß die Affäre Kahn erledigt sei. Vater, Mutter und Tochter wären inzwischen nach Portugal weitergefahren, um von dort per Schiff nach Amerika zu reisen. »Trotz aller Beziehungen hat es sich leider nicht verhindern lassen, daß der Sohn Jakob nach Polen geschafft wurde; über sein weiteres Schicksal ist nichts bekanntgeworden. Zwar erreichte auf sehr dubiosen Schleichwegen ein Abschiedsbrief seine Verwandten in Philadelphia; es handelte sich dabei jedoch vermutlich um eine Fälschung.
Die volle Summe wurde rechtzeitig hinterlegt und steht nach Abzug meiner Provision in Höhe eines Drittels zwecks weiterer Veranlassung zur Verfügung.
Sicherheitshalber darf ich noch einmal dringend auf unsere Vereinbarung hinweisen, daß alle Unterlagen dieser Sache schon im Reichsinteresse zu vernichten sind.«
Also Jakob, dachte Martin, stand auf, schloß die Akte, sah das Kleiderbündel, das er sich zurechtgelegt hatte, fegte es mit der Hand vom Tisch. Er wollte das Jagdhaus verlassen, dachte dann an den US-Colonel, seinen unbekannten Gastgeber, hängte die Anzüge wieder in den Schrank, warf die Hemden hinterher, stieg durch das Fenster und schloß die Läden.
Der rundliche Fahrer schlief im Jeep. Er hatte die Beine auf das Steuerrad gelegt und den Kopf auf die Knie gestützt. Sein Gesicht träumte auf einer üppigen Badeschönheit der Stars and Stripes. Der Mann hörte Martin kommen, fuhr benommen hoch, lächelte leer und stand auf.
»Can I help you?« fragte er mit schläfriger Stimme.
»Thank you.« Martin winkte ab.
Der GI sah, daß Martin nichts in der Hand hielt als einen Schnellhefter, und fragte:
»That’s all?«
»Das ist alles.«
Sie rollten nach Frankfurt zurück. Vor dem IG-Farben-Hochhaus setzte ihn der Fahrer ab. Martin bedankte sich. Der Soldat grüßte flüchtig. Martin griff mechanisch in die Tasche, stieß auf das Geldbündel, reichte es dem GI, der verwundert und beleidigt den Kopf schüttelte.
Martin schleuderte das Geld in den Jeep und ging mit raschen Schritten in das Haus.
»Nuts!« rief ihm der Fahrer nach, tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn und sammelte die Papierscheine ein.
Der Major mit dem schmalen klugen Pferdekopf hatte Martin schon erwartet, stand auf und begrüßte ihn lebhaft.
»Felix hat angerufen«, sagte er, »es ist alles okay, er schickt Ihnen morgen einen Wagen, und Sie können sofort nach München übersiedeln.«
»Danke«, antwortete Martin zerstreut.
»Haben Sie – da draußen – etwas Brauchbares für sich gefunden?«
»Ja.«
Der US-Major merkte, daß Martin nicht sprechen wollte, und griff zu dem Mittel, mit dem man im Jahre 1947 alle deutsch-amerikanischen Verlegenheiten überbrücken konnte: er bot ihm eine Zigarette an.
Sie rauchten schweigend.
Auf dem Gang pfiff einer einen Gassenhauer. Ein paar Soldaten schienen Football zu spielen, polterten gegen die Türen. Mädchen lachten und schäkerten in einem buntsprachigen Kauderwelsch. Es ging auf Dienstschluß zu, und die Menschen in dem weiträumigen Gebäude freuten sich auf ihre Freizeit.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?« fragte der Pferdekopf.
Martin zögerte, dachte nach: es war keine Zeit zu verlieren.
»Vielleicht«, antwortete er gedehnt. »In dieser Stadt – bei der früheren Gauleitung – gab es einen Nazi namens Silbermann …«
»Vorname?« fragte der Major und griff nach einem Zettel.
»Egon.«
»Gut«, entgegnete der Offizier, »wenn der Bursche nicht aufgehängt wurde oder inzwischen untergetaucht ist, werden wir ihn gleich haben.«
Er drückte auf einen Klingelknopf, übergab der Sekretärin den Zettel, klopfte Martin auf die Schulter und setzte hinzu: »Und bis dahin nehmen wir einen Drink …«
Sie gingen in die kleine Offiziersbar im Haus und tranken Whisky. Der Major, der Martins düstere Stimmung aus eigenen Erlebnissen kannte, stellte keine Fragen.
Schon nach dem dritten Glas wurde der Offizier an das Telefon gerufen, und noch während des Gesprächs drehte er sich zu Martin um und sagte: »Wir haben ihn.«
Er warf dem Kellner Script-Dollars auf die Theke und zog Martin vom Hocker.
Die Sekretärin hatte bereits die Unterlagen auf den Schreibtisch des Majors gelegt; er überflog sie.
»Was wollen Sie von dem Mann?« fragte er betont leicht.
»Eine Auskunft.«
»Er ist interniert«, sagte das Pferdegesicht. »Es liegt einiges gegen ihn vor. Er geht übrigens bald in deutschen Gewahrsam über.«
»Kann ich ihn sprechen?« fragte Martin.
»Sicher«, erwiderte der Offizier, »aber das ist wieder eine so umständliche Sache.« Er las weiter. Seine Lippen öffneten sich zu einem Riß des Spotts. »Übrigens«, fuhr er fort, »ist Silbermann mit einer Fuhre anderer Nazis für den Weltkongreß der Moral Rearmament ausersehen.«
»Moralische Aufrüstung? Was ist das?« fragte Martin.
»Eine Mischung von guter Absicht und schlechtem Geschmack«, antwortete der Major. Er lächelte mit geschlossenen Lippen. »Mit dem Hauptsitz in Caux.«
»Ihr sperrt ein ganzes Volk ein«, entgegnete Martin leise, »und laßt Nazis in die Schweiz reisen?«
»Nicht etwa nur Nazis«, erwiderte das Pferdegesicht und griff nach seinem Lineal, »die Militärregierung unterstützt alles, was-der deutschen Umerziehung dienlich sein könnte.« Er grinste breit. »Auch das.«
»Gilt das auch für mich?« fragte Martin.
Der Offizier betrachtete ihn gelassen, schob das Lineal weg. »Haben Sie es nötig?«
»Wer nicht?«
Der Pferdekopf sah verblüfft zu Martin, nickte dann:
»Alle Achtung, Ritt, Sie schalten rasch.« Er legte die Beine auf den Tisch, lehnte sich zurück. »Es ist kein Vergnügen: Sammelpaß, Sammeltransport, bescheidenes Essen, niedere Arbeiten und fromme Reden … Wenn Sie das wollen?«
»Ich will«, antwortete Martin.
Der Major ging auf sein Vorzimmer zu, riß die Tür weit auf.
»Stell fest, Margot, ob in Caux noch ein Platz für einen dringenden Fall frei ist. Wenn nicht, streiche einen Mann von der Liste und trag den Namen Ritt ein. Sollte es Schwierigkeiten geben …«Er schloß die Tür und betrachtete Martin mit forschendem Blick.
»Machen Sie sich ein paar schöne Tage in der Schweiz«, sagte er ruhig, »aber lassen Sie von diesem Silbermann für uns noch etwas übrig.« Er deutete auf das Dossier auf seinem Schreibtisch. »Könnte sein, daß wir ihn noch …«
Stehend und stumm tranken sie lauwarmen Whisky auf die seltsame Reise.