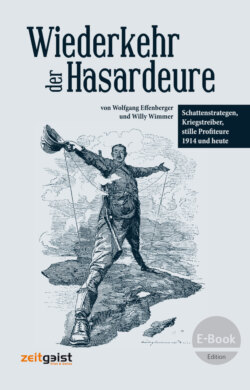Читать книгу Wiederkehr der Hasardeure - Willy Wimmer - Страница 11
Einführung
ОглавлениеIn den gewitterschwülen Juli- und Augusttagen des Jahres 1914 ging die Friedensordnung in Europa unter, im Kriegsverlauf zerbrachen die Strukturen der bürgerlichen Vorkriegsgesellschaft, und zwar sowohl bei den Verlierern als auch den Gewinnern. Auslöser war das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo – der Hauptstadt des zu Österreich-Ungarn gehörenden Kronlandes Bosnien-Herzegowina.
Wer stand wirklich hinter dem Attentat? Was sollte es bewirken, und wer wollte davon profitieren? Laut dem jugoslawischen Historiker Vladimir Dedijer4 wurden damals nicht weniger als sieben Staaten und vier politische Gruppen der Urheberschaft beschuldigt, darunter die Regierungen bzw. Geheimdienste von Serbien, Russland, Ungarn, Österreich, Deutschland, Frankreich und England sowie Juden, Freimaurer und Anarchisten. Mit Resignation muss man feststellen, dass nach einem Jahrhundert die Hintergründe noch immer nicht offengelegt wurden. Das Interesse an den Ursachen hält sich indes – aus welchen Gründen auch immer – trotz des Jubiläumswirbels in Grenzen.
In den deutschen Medien steht immer wieder die Person Wilhelms II. im Zentrum des öffentlichen Interesses, dem von vielerlei Seiten die Schuld am Ausbruch des Krieges zugeschoben wird, und es gibt wenig Widerspruch. Wie konnte sich diese Sicht derartig zementieren? Bereits ein Jahr nach Kriegsausbruch kam in London das Buch »J’accuse« des im Schweizer Exil lebenden Deutschen Richard Grelling heraus. Er spricht vom »Hohenzollernschen Eroberungskrieg« und klagt den Kaiser an. Der Hamburger Historiker Fritz Fischer (1908–1999) führt mit seinem 1961 erschienenen Werk »Griff nach der Weltmacht« die These von der deutschen Alleinschuld bis an sein Lebensende konsequent fort, gefolgt von Schülern, die seinen Ansichten folgen. Daneben gibt es auch Geschichtsforscher, welche auf andere Kriegsbeteiligte als nicht weniger Schuldige verweisen. Mit der bei vielen deutschen Historikern typischen Verbissenheit wird so in der Nachbetrachtung des Ersten Weltkriegs um Kriegsschuld versus Kriegsunschuld gefochten.
Im Vorwort hält Fischer fest, dass sein Buch weder Anklage noch Verteidigung sei. »Beides ist nicht Aufgabe des Historikers.«5 Dieser habe Tatsachen festzustellen, sie in den Zusammenhang von Ursachen und Folgen einzuordnen und die Vorstellungen, Zielsetzungen und Entschlüsse einzelner Personen als Faktoren der politischen Willensbildung zu »verstehen«, ohne zu zensieren oder zu entschuldigen. Auch sollte der Historiker vermeiden, vereinfachend und damit entstellend für eine später als verhängnisvoll erkannte Entwicklung einen »Sündenbock« an den Pranger zu stellen.
Der von den anderen Großmächten Europas als so bedrohlich empfundene »Griff nach der Weltmacht« Deutschlands war vornehmlich eine Geschichte des Scheiterns. Dem Kaiserreich war es nicht gelungen, die Zusammenschlüsse der Ententemächte 1904 und 1907 zu verhindern. Bei allen kolonialen und internationalen Streitigkeiten, ob in Samoa, Marokko, Westafrika, Südamerika oder am Persischen Golf, gingen die Diplomaten Wilhelms II. als Verlierer vom Platze. Nur in der bosnischen Annexionskrise konnte sich Berlin erfolgreich für die Interessen Wiens einsetzen – was sich indes als Pyrrhus-Sieg herausstellen sollte. Inzwischen gilt Fischers These, Deutschland habe im Juli 1914 den Weltkrieg entfesselt, weil es nach »Weltherrschaft« strebte, als wissenschaftlich abgetan. Fischers Verdienst bleibt jedoch, die Diskussion über den Ursprung des Krieges grundsätzlich angeregt zu haben. Ohne diese Debatte wäre auch das vorliegende Buch vermutlich nicht geschrieben worden. Es soll helfen, Fischers einseitigen Blick auf das Kaiserreich mittels eines Rundblicks auf die anderen Akteure zu ergänzen. Der Krieg war das Ergebnis eines irrsinnigen imperialen Zeitalters, in dem vor allem um neue Märkte gerungen wurde. Und hinter der Entscheidung standen keineswegs die Völker der beteiligten Länder – nein, es waren jeweils nur eine Handvoll Männer: Hasardeure, die aus Gier und Machtbesessenheit an der Stellschraube zum Krieg gedreht hatten. Nicht anders als heute auch.
Das vorliegende Werk beleuchtet die Parallelen von 1914 zu 2014 und zeigt, wie auf den Anschlag von Sarajevo und den von New York (9/11), der mit seiner Symbolkraft durchaus vergleichbar ist, reagiert wurde und noch heute reagiert wird. 1914 bestand das politische Ziel der Attentäter in der Destabilisierung Österreich-Ungarns und der Eroberung von dessen südöstlichen Provinzen – ein Ziel, das bekanntlich 1918 verwirklicht wurde und zur Gründung des mittlerweile blutig zerbrochenen Jugoslawiens führte. Und 2014? Welche Motive verfolgen kriegstreiberische Eliten heute? Auch darauf versucht das Buch, Antworten zu geben.
In allen Parlamenten und Ministerien gab es Personen, die noch in letzter Minute den Frieden retten wollten, aber eben auch Vertreter, die im Krieg die einzige Lösung sahen, und wieder andere, denen es nur um ihre ganz eigenen Interessen ging. Eine kurzsichtige Kriegsschulddiskussion verhindert den Blick auf die tiefer liegenden Gründe sowie die komplexe Entwicklungsgeschichte. Hier reicht es nicht aus, die diplomatische Geschichte Europas von 1870 an zu bewerten. Marksteine in der Entwicklung auf den August 1914 hin dürften ebenso in der Französischen Revolution samt den Eroberungskriegen Napoleons wie auch in den verheerenden Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges liegen – geschichtliche Traumata, abgespeichert im kollektiven Gedächtnis. Vielleicht gehen manche Grundprobleme sogar auf die Zeit Karls des Großen zurück. Als exemplarisch ist auch die Geschichte des Kosovo anzusehen, die untrennbar verbunden ist mit der historischen Schlacht auf dem Amselfeld am 28. Juni 1389. Derartige nationale, transgenerationale Geschichtstraumata können beweint oder politisch ausgebeutet werden. Im letzteren Fall werden sie zum explosiven Gemisch, wenn sie nationalistisch unterfüttert und von der Presse instrumentalisiert werden. Dazu kommen die Probleme des industriellen Wandels und der Verstädterung. Ferner sind zu berücksichtigen: die Übervölkerung, die Versorgung, der Welthandel, die Rohstoffe, die Kolonien, das internationale Kapital und letztlich die alles überlagernden geopolitischen Interessen.
Heute wird peinlich darauf geachtet, den in Versailles zweifellos diktierten Vertrag als Friedensvertrag zu bezeichnen. Obwohl die deutsche Delegation zu den langwierigen mündlichen Verhandlungen über den Vertragsinhalt nicht zugelassen war, musste sie am 28. Juni 1919 – exakt fünf Jahre nach dem Terroranschlag in Sarajevo – nach ultimativer Aufforderung den vorgelegten Vertrag unterzeichnen. Nachdem im Weigerungsfall mit dem Einmarsch von Truppen gedroht wurde, unterzeichneten die Deutschen unter Protest. Auch nach damaligem Rechtsverständnis war ein Vertrag, der durch Drohung zustande gekommen war, nichtig.
Im Vergleich zu Versailles war der 1648 in Münster und Osnabrück geschlossene »Westfälische Frieden« geradezu nobel. Hier haben die ehemaligen Kriegsgegner nämlich gemeinsam die Bedingungen für den Frieden ausgehandelt. An dieser Stelle muss auch auf die Friedensverhandlungen von 1814 und 1815 hingewiesen werden, bei denen dem Vertreter des völlig besiegten Frankreichs ein Mitspracherecht auf Augenhöhe eingeräumt wurde. Die Friedensbedingungen waren dann auch für Frankreich sehr milde. Die Siegermächte hatten das zukünftige machtpolitische Gleichgewicht als Verhandlungsziel vor Augen und nicht, wie ca. 100 Jahre später, die Demütigung, Verleumdung, Ausbeutung, Verelendung, Ausgrenzung und völlige Niederwerfung des besiegten Volkes. Die Strategie der Sieger von 1918 war dumm und gefährlich. Sie bürdete der jungen deutschen Demokratie eine lebensgefährliche Hypothek auf und düngte den Acker, auf dem der Ungeist heranwuchs, der zum Zweiten Weltkrieg führen sollte.
Nun ist zu hoffen, dass sich nach hundert Jahren auch in Deutschland eine komplexere Sicht auf diese katastrophale Zeitenwende einstellt. Es geht nicht darum, Kriegsschuld oder -unschuld zu beweisen. Vielmehr kommt es darauf an, gemeinsam zu untersuchen, wie es zu diesem verheerenden Krieg kommen konnte. Nur dann wird man ähnliche Entwicklungen in unserer Zeit besser erkennen und hoffentlich verhindern können.
Zurück zu Kaiser Wilhelm II. und der Schwierigkeit, sich von seiner Person ein objektives Bild zu machen. Sein Hang zu großem Pomp und militärischem Prunk sowie sein forsches und schillerndes Auftreten brachten dem Monarchen von seinen besorgten wie auch konsternierten Zeitgenossen zu Recht Kritik ein, die häufig bis zur Verleumdung gesteigert wurde. Doch schon vor 50 Jahren forderte der englische Bismarck-Biograf Ian F. D. Morrow6, Wilhelm II. so darzustellen, wie »er sich dem heutigen, verständnisvolleren, besser informierten Historiker offenbart«.7 Dieser Appell wird bis heute weitgehend überhört. Es ist zu hoffen, dass er jetzt endlich ernst genommen wird. Auch dazu möchte das Buch beitragen. Es wagt den Versuch, die Epoche Wilhelms II. aus der damaligen Zeit heraus verstehend zu schildern.
Zweifelsohne gehörte Wilhelm II. schon vor 1914 zu den Schicksalsfiguren der deutschen Geschichte. Aber spiegelte seine Persönlichkeit nicht die Chancen und die Hoffnungen des englischen und des deutschen Volkes wider? Hätte nicht der Lieblingsenkel der britischen Queen Victoria zum Glücksfall für die Engländer und für die Deutschen werden können? So war er als Kind und Jugendlicher häufig gern gesehener Gast nicht nur im Windsorpalast, sondern auch im schottischen Schloss der Queen.
Queen Victoria ließ sich von ihrer Tochter Victoria Adelaide über die Erziehung ihres ersten Enkels immer auf dem Laufenden halten. Die Zuneigung des Kaisers zu seiner Großmutter und das eher schwierige Verhältnis zu seiner Mutter, der »Engländerin«, der am Berliner Hof mit großem Misstrauen begegnet wurde, und dem ebenfalls ungeliebten Onkel Edward, dem späteren englischen König, ließen wohl in Wilhelm II. jene oft beschriebene Hassliebe entstehen, die seine Beziehung zu England nach dem Tode Victorias prägen sollte. Trotz aller familiären Querelen fühlte sich der Hohenzoller mit englischen Vorfahren als Freund der Briten.
An der Mittelmeerküste Nordafrikas rivalisierte England mit Frankreich. Bismarck konnte sich auf eine kontinentale Politik beschränken und kam somit England nicht in die Quere. Zudem war England auch wirtschaftlich ein Koloss, das soeben gegründete zweite Deutsche Reich hingegen ein Zwerg. Doch Deutschlands Volkswirtschaft wuchs rasant und begann um die Jahrhundertwende die britische zu überflügeln. Das Deutsche Reich wurde nun zum Konkurrenten, der dem British Empire im Welthandel ständig wachsende Marktanteile abnahm, und als solcher als Bedrohung für den eigenen Wohlstand empfunden. Die britischen Imperialisten reagierten darauf in altbewährter Manier, nämlich durch Bildung einer Allianz mit dem Ziel, den Rivalen bei passender Gelegenheit zu erledigen.
Wilhelm II. als Vierjähriger mit seinem Vater Friedrich Wilhelm auf Schloss Balmoral, Schottland (1863). Rechts: Wilhelm II. als 24-Jähriger in schottischer Tracht. Das Foto signierte er mit »I bide my time« (Ich warte, bis meine Zeit kommt) (© Abb. 1)
Soweit einige Schlaglichter auf die machtpolitische Konstellation vor dem Krieg, die zeigen sollen, wie hochkomplex die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen miteinander verwoben waren. Ziel dieses Buches soll sein, die verwickelte Situation gegenseitiger Konkurrenzverhältnisse und Interessenlagen transparent zu machen. In diesem Zusammenhang muss die These eines »zweiten Dreißigjährigen Kriegs« (Charles de Gaulle 19418 und Winston Churchill 1944 und 19489) neu diskutiert und der Frage nachgegangen werden, ob Wilhelm II. eine Kollision hätte verhindern können.
Den Beginn des Buches bildet eine kurze Rekapitulation der europäischen Machtkämpfe seit der Reformation, die zu den verhängnisvollen Konstellationen Ende des 19. Jahrhunderts führten, woraufhin sich die Rivalitäten zuspitzten. Zum Verständnis der historischen Wurzeln ist diese Rückblende unverzichtbar. Der Dreißigjährige Krieg und die koloniale Eroberung Nordamerikas sind dabei besonders wichtig. Anschließend nähert sich die Betrachtung dem Brennpunkt Balkan, der zum Auslöser des Ersten Weltkriegs wurde. Der Grund aber lag nicht in Serbien, sondern im Spiel der Macht- und Profitinteressen, von einigen wenigen Hasardeuren hinter den Kulissen skrupellos gespielt – oft ohne Wissen der offiziellen Machthaber. So kam es trotz des allgemeinen Friedenswillens zum Countdown in die Katastrophe. Exemplarisch sowohl für die Hybris der Strategen als auch für das Leiden des einzelnen Soldaten steht die folgende Schilderung des »Handstreichs gegen Lüttich« Anfang August 1914. Nach einer Bewertung der Motive und Folgen des »Großen Kriegs« folgt schließlich die Analyse der Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika. Deren Aufstieg zur einzigen Weltmacht ist untrennbar mit dem Ersten Weltkrieg verbunden und nimmt daher in dem Buch größeren Raum ein. Amerikas Eintritt hat den Sieg der Entente erst ermöglicht und damit auch das Ergebnis von Versailles.
Die Ungerechtigkeiten des Vertrags von Versailles waren eine der wesentlichen Ursachen für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Danach konnten die USA ihren Brückenkopf Europa mit dem Zentrum in der neu geschaffenen Bundesrepublik Deutschland weiter ausbauen. So zieht sich die Linie der erfolgreichen Strategie der USA über den Kalten Krieg und den Zusammenbruch der Sowjetunion bis in die Gegenwart, in der, wie Willy Wimmer zeigt, die Bruchlinien des Ersten Weltkriegs erneut aufreißen. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch die Nahost-Expertin Karin Kneissl. Für sie tobt im Nahen Osten immer noch der Erste Weltkrieg.10 Resigniert stellt sie fest: »Es sind unglaublich viele Feiglinge am Werk; es fehlen die Denker mit Rückgrat.«11 Paralysiert stehen sie als Gefangene der eigenen Geschichte vor den Problemen der Gegenwart. Doch nur wer die Vergangenheit reflektiert, kann die Konflikte der Gegenwart lösen und ein Fundament für eine friedlichere Zukunft schaffen.
Neben dem Krisenherd in Nahost hat sich die Ukraine in den Fokus geschoben. Auch hier liegen die Ursachen weit zurück. Schon Bismarck strebte als wichtigstes geopolitisches Ziel die Trennung der Ukraine von Russland an. Heute konstruiert die Publizistik hemmungslos Feindbilder. »Da haben Medien in ganz Europa durch ihre nationale Perspektive wesentlich zur Kriegsdynamik beigetragen«12, urteilt der Medienwissenschaftler Jürgen Grimm. Dasselbe war im Vorfeld des Ersten Weltkriegs zu beobachten. Als Protest an der Ukraine-Berichterstattung der Leitmedien entzündete sich eine Gegenbewegung im Internet und in unabhängigen Zeitschriften mit beachtlichen Beiträgen von Willy Wimmer.