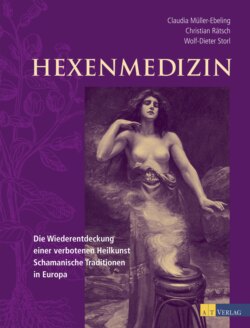Читать книгу Hexenmedizin - Wolf-Dieter Storl - Страница 7
ОглавлениеNachdem die Gletscher geschmolzen waren, wurden die eiszeitlichen Tundren, auf denen die riesigen Herden von Büffeln, Rentieren, Wollnashörnern und Mammuts grasten, allmählich von Bäumen besiedelt. Die Herden starben aus oder wanderten zum Teil nach Sibirien ab. Mit ihnen zogen die letzten nomadischen Großwildjäger. Es war, was unsere geographischen Breiten betrifft, das Ende der Alten Steinzeit.
Paläolithische Höhlenzeichnung eines Mammuts.
Der Wald zog die kleinen Jägergruppen, die zurückblieben, in seinen Bann. Sie stellten nun dem scheuen Wild nach, das sich in kleinen Rudeln tief im Wald versteckte -den Rehen, Hirschen, Wildschweinen – und auch den mürrischen Einzelgängern, dem Bär, dem Dachs und dem Elch im Sumpf. Diese Art zu jagen war mühsamer, kostete mehr Zeit und brachte weniger ein. Und im gleichen Maß, in dem die Jagdbeute geringer wurde, nahm die Bedeutung des pflanzlichen Sammelguts zu. Da innerhalb der natürlichen Arbeitsteilung der Naturvölker das Sammeln von Wurzeln, Obst, Rinden, Larven und Vogeleiern vor allem dem weiblichen Geschlecht zufiel, gewann das Tun der Frauen an Gewicht. Während das erbeutete Wild nach strengen Regeln gemeinschaftlich geteilt wurde, behielten die Frauen ihre tägliche Ausbeute für ihre Familien. So ist es noch heute bei den Jägern und Sammlern: Die Männer machen Politik; sie sichern Freundschaften und bewahren sich Verbündete für den Notfall, indem sie Fleisch verteilen und – wenn die Beute groß ist – Feste veranstalten. Die Frauen dagegen kümmern sich um die alltäglichen Aspekte des Überlebens.
An Orten, wo das Sammeln erträglich war, ließ man sich für längere Zeit nieder. Seeufer waren als Lagerplätze beliebt, denn dort fand man neben den stärkehaltigen Wurzeln des Rohrkolbens, des Sumpfziests, der Seebinse, des Pfeilkrauts oder der Wassernuß noch Entenflott (Wasserlinse, Lemna) für die Suppe, saftige Schilfschößlinge, die nahrhaften Samen der Schwade oder des flutenden Süßgrases (Glyceria), dazu diverse Muscheln, Mollusken und kleinere Amphibien.
Neben dem Herstellen von kleinen Pfeilen, mit denen man Vögel und Kleingetier erlegen konnte, dem Bauen von Reusen, dem Knüpfen von Netzen und dem Fertigen von Harpunen und Angelhaken verbrachten die Männer wahrscheinlich die meiste Zeit – ähnlich den heutigen Wildbeutern – mit Faulenzen und mit der Kommunikation mit den vielen Geistern, die Wald, Fels und Wasser beleben. Urgeschichtler nennen die Zeit, in der unsere Vorfahren so lebten, das Mesolithikum oder die Mittlere Steinzeit.
Diese Menschen zogen in weiten Kreisen mit den Jahreszeiten zu verschiedenen ergiebigen Jagd- und Sammelgründen. Sie bezogen dabei immer wieder die gleichen Lagerplätze. Dort wuchsen häufig viele ihrer Lieblingspflanzen. Verschüttete Samenkörner und die weggeworfenen Schalen von Knollen fanden dort, wo die Konkurrenzvegetation niedergetrampelt und der Boden mit Asche, Kot, Urin und Abfällen gedüngt war, eine geeignete Nische. Der Schritt zur Domestikation war daher ein kleiner. Im Nahen Osten begannen damals einige Wildbeuter, absichtlich den Boden aufzuritzen und die Grassamen, die sie vorher gesammelt hatten, in kleine Gehege auszusäen. Auch junge Tiere wurden angepflockt oder eingezäunt und so allmählich gezähmt. So wurden Wildbeutergruppen seßhaft. Sie bauten sich feste Häuser mit Stallungen für die gefangenen Tiere.
Jäger und Sammler besitzen wenig. Ihr Besitz ist immateriell. Es sind Visionen, Märchen, Lieder, Zaubersprüche, Jagdmagie und Heilkenntnisse. Sie leben von der Hand in den Mund, im Hier und Jetzt: Wer will schon ständig schwere Lasten mit sich herumschleppen? Nun aber machte es Sinn, große Krüge und Behälter aus Lehm zu töpfern. Getreide und andere Vorräte konnten darin aufbewahrt und Bier gebraut werden. Bier – versetzt mit bewußtseinsverändernden Kräutern – wurde nun zum Sakralgetränk, mit dem die Schicksalsmächte, die Sonne, die Erd- und Vegetationsgottheiten gefeiert wurden. (RÄTSCH 1996: 50) Urgeschichtler bezeichnen diesen Kulturwandel, der die ersten seßhaften Dörfer entstehen ließ, als »neolithische Revolution«.
Wilde Männer beflügelten die Phantasie des Mittelalters und sind bis heute weltweit ein Faszinosum. Dieser Holzschnitt ist das Titelbild eines Buches, das die Geschichte vom Wilden Mann und der Frau Venus erzählt. Der riesenhaft dargestellte und am ganzen Körper behaarte Wilde Mann trägt ein kleines Abbild der »Frau Venus« im Arm. Die nackte Gestalt im Strahlenkranz erinnert auffallend an die Jungfrau Maria in der Mandorla. In diesem Falle repräsentiert sie die Verführung zur Sünde, denn mit ihrem Blick fordert sie den jungen Ritter auf, ihr zu folgen. Ihn erwartet allerdings das »Gefängnis der Liebe«, wo er als Gefangener der Frau Venus höllischen Martern unterworfen wird. Der Wilde Mann dient als Wärter im »Gefängnis der Liebe«. (Holzschnitt aus DIEGO DE SAN PEDRO, Carcel de Amor, 1493)
Jungsteinzeitliche (neolithische) Dorfsiedlungen verbreiteten sich von Kleinasien aus immer weiter die Donau und deren Nebenflüsse hinauf. Gegen Ende des 5. Jahrtausends hatten die als »Bandkeramiker« bekannten Pioniere die Flußtäler Mitteleuropas besiedelt, bauten Emmer und Gerste, Einkorn, Erbsen, Pferdebohnen und Flachs an und errichteten inmitten der gebrandrodeten Fläche zwanzig bis dreissig Meter lange Gemeinschaftshäuser mit reckteckigem Grundriß für ihre matrilinearen Großfamilien. Wenn dann nach einem oder zwei Jahrzehnten die Bodennährstoffe ausgelaugt waren und die Felder und Weiden ihre Fruchtbarkeit verloren hatten, zogen diese ersten Bauern weiter. Erneut schwendeten sie den nächsten Flecken des immensen Urwalds, fällten die Baumriesen mit Feuer und geschliffenen Steinäxten, besäten erneut den aufgerissenen Boden und gaben den Rindern, Ziegen und Schafen neue Weideflächen.
Die neolithischen Siedlungen waren winzige Inseln im grünen Blättermeer. Noch Jahrtausende später, im frühen Mittelalter, war die Baumdecke in Europa so dicht, daß ein Eichhörnchen von Dänemark bis Südspanien von Baum zu Baum hätte springen können, ohne den Boden auch nur einmal berühren zu müssen.
An den Rändern dieser Kulturinseln, an der Übergangszone zwischen dem bewirtschafteten Land und dem Urwald entstand ein Randbiotop. Dorniges Gestrüpp – Brombeeren, Wildrosen, Schlehen, Stachelbeeren, Weißdorn, Kreuzdorn, Berberitze, Sanddorn – und schnellwachsende Heckengehölze – Eberesche, Faulbaum, Hasel, Holunder – fanden dort eine geeignete ökologische Nische. Diese natürliche Hecke gewann für die jungsteinzeitlichen Bauern praktische Bedeutung: Für das streunende Weidevieh war es ein effektiver Zaun. Um so mehr die Wiederkäuer daran knabberten, um so dichter wurde die Dornenbarriere, bis sie ein natürliches Gehege bildete. Zudem konnten Pfosten, Stecken und Ruten herausgeschnitten werden, Flechtwerk für die Wände, die dann mit Lehm verdichtet wurden, und weiteres Material für Korbwerk. In der Hecke fand man nahrhafte Vogeleier, saftige Beeren und schmackhafte Nüsse. Auch die wirksamsten aller Heilkräuter wuchsen in diesem Randbiotop.
Vor allem aber gab die dichte, dornige Hecke Schutz. Sie hinderte das Eindringen reißender Wölfe und Bären sowie gefräßiger, auf die wachsende Feldfrucht erpichter Rehe. Wahrscheinlich entmutigte es auch die »wilden Menschen« – die in Fellen gekleideten letzten Wildbeuter –, die noch in den Wäldern umherstreiften und denen man es zutraute, die Kinder zu stehlen. (Noch im Mittelalter wurden solche »wilde Leute« von den Rittern gejagt und zur Strecke gebracht.)
Bis heute symbolisieren die dornigen Heckengewächse, vor allem der Weißdorn und die Wildrose, den geschützten, ungestörten Schlaf. Das Märchen spricht von der Dornröschenhecke, und manche Bäuerin steckt dem Säugling noch immer einen Schlafkunz (Rosenapfel, Schlafrose) unter das Bettchen, damit es ruhig und tief schläft. Bei den Schlafkunzen handelt es sich um die moosartigen rundlichen Auswüchse an den Zweigen der Hundsrose, die durch den Stich der Rosengallwespe verursacht werden.
Für die jungsteinzeitlichen Siedler war die Hecke aber nicht nur eine physische Grenze zwischen dem kultivierten Land und der Wildnis, sondern ebenso eine metaphysische Grenze. Hinter dem Gehege hausten nicht nur wilde Menschen und Raubtiere, sondern hier fing auch das Reich der Gespenster, Trolle, Kobolde und Waldunholde an, hier begegnete man den verführerisch schönen, aber verschlagenen Elfen. Hier trieben noch die alten Gottheiten der paläolithischen Vergangenheit ihr Wesen.
Die archaischen Jäger und Sammler waren eins mit dem Wald, sie lebten im Einklang mit den Waldgeistern. Den neolithischen Hackbauern dagegen war die Baumwildnis nicht mehr ganz geheuer, sie war eher unheimlich.1
Die paläolithische Göttin der Höhle, die Hüterin der Tiere und Totenseelen, wurde im Neolithikum immer mehr zur fruchtbaren Erdmutter. Wie schon den altsteinzeitlichen Jägern erschien die Göttin den Hackbauern in der Vision und schickte ihnen Träume. Sie wußten auch, daß die Göttin hören konnte, fühlen und leiden. Die Fruchtbarkeit der Scholle hing von ihrer Gunst ab. Die Landwirtschaft entwickelte sich in der ständigen Zwiesprache mit ihr. Pflügen und Ackern galten als Liebesakt, der sie schwängerte, waren Kultus. (Das Wort Kultivieren bedeutet im ursprünglichen Sinn nichts anderes als Gottesdienst, Verehrung, Hingabe, Pflege.)
Aber trotz Kult und Ritual kommt Unbehagen auf. Ein ungutes Gewissen bemächtigt sich der ersten Bauern. Sie haben sich am Wald vergangen, haben ihn gebrandschatzt und die Erdscholle aufgerissen. Die Erdgöttin wird zur Klagemutter. Sie klagt über die zahllosen Kinder, die sie gebar und die der Sichel, der Axt und dem Spaten zum Opfer fallen. Die Ursprungsmythen der Pflanzer und Ackerbauern setzen immer den gewaltsamen Tod, den Mord, das Opfer eines göttlichen Wesens zu Anbeginn der landwirtschaftlichen Lebensweise voraus. Das allgegenwärtige Gefühl der Dankbarkeit und Geborgenheit, welches einfache Jäger und Sammler dem Wald gegenüber zum Ausdruck bringen, wich Schuldgefühlen, die mit zunehmend aufwendigeren Opfern, zuletzt mit grausamen, kultisch institutionalisierten Menschenopfern, Kopfjägerei und Kannibalismus gesühnt werden mußten.2 Folglich brachte die neolithische Revolution – so der große Religionsforscher Mircea Eliade – auch eine Umwertung der Werte, eine »religiöse Revolution« (ELIADE 1993: 45). Auch die christliche Vorstellung vom Opfertod des unschuldigen Gottessohnes, von der Mater dolorosa, die ihn beweint und ihn im Schoß birgt, hat ihre Wurzeln – den Mythos der seßhaften neolithischen Bauern. Weniger der Schamane, der mit den Wald- und Tiergeistern reden kann, als vielmehr der Priester, der den Ritualkalender beherrscht und nach dem Stand der Gestirne die Zeiten des Säens und Erntens, die Darbringung und Art der Opfer bestimmt, führte nun die Gemeinschaft.
Die einheitliche Welt der Primitiven teilte sich also allmählich in zwei Bereiche: in die des befriedeten Kulturlandes einerseits und in die der Wildnis da draußen hinter der Hecke andererseits, zwischen den zahmen Nutztieren und den gefährlichen wilden Tieren, zwischen freundlichen Haus- und Hofgeistern und jenen Waldgeistern, vor denen man sich in acht nehmen muß. Und so dämmerte das Zeitalter, an das sich die Menschen als das »goldene« erinnern: Im Schweiße seines Angesichts lernte der Mensch sein Brot zu essen.3
Die große paläolithische Göttin: oben die aus Elfenbein geschnitzte »Venus von Brassempouy«, unten die »Venus von Willendorf« aus Kalkstein.