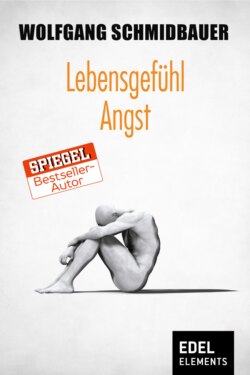Читать книгу Lebensgefühl Angst - Wolfgang Schmidbauer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Entwicklungsgeschichte der Angst
ОглавлениеWir wissen nicht, ob die Maus vor der Katze Angst hat oder der Spatz vor dem Falken. Aber ihr Verhalten erinnert uns an unseren eigenen Ur-Wunsch, unseren Abstand zu potentiell bedrohlichen Dingen, Ereignissen und Organismen selbst zu bestimmen und ihn nur vorsichtig so zu verkürzen, dass uns Zeit und Raum für unseren Rückzug bleiben.
Die Angst ist in der Evolution aus einem oft lebensrettenden Fluchtimpuls entstanden. Insofern ist uns die Angstbereitschaft angeboren, vielleicht sogar mit spezifischen Inhalten: Fremdenangst, Höhenangst, Angst, auf Hartes zu beißen. Aber genetische Theorien über seelische Merkmale sagen beim Menschen nichts über eine Ursache, sondern nur etwas über eine Bedingung. Der Mensch erlebt Aufträge seiner Gene an sein Ich. Er kann zu ihnen Stellung nehmen und verarbeitet sie höchst unterschiedlich, je nachdem, welche Einflüsse auf ihn gewirkt haben.
Der Prozess dieser seelischen Verarbeitung genetischer Traditionen ist seinerseits genetisch fundiert. Er hängt mit unserer Evolution zu Sprache und Bewusstsein zusammen. Zum Überleben half es einem intelligenten Abkömmling des Stammes der Säugetiere, dass die ängstliche Erregung, welche den Organismus körperlich und geistig auf die Flucht vorbereitet und diese einleiten hilft, ein höchst unangenehmer Zustand ist.
Es wird erzählt, dass im mittelalterlichen Handwerk der Meister dem Lehrling eine schallende Ohrfeige gab, wenn er ihm eine Einzelheit mitgeteilt hatte, die sozusagen zum Kernwissen der Kunst gehörte. So gepeinigt, sollte sich der Novize genauer erinnern.
Wir ersparen unseren Schülern solchen Nachdruck und wollen auch, dass er uns von Seiten unserer Lehrer erspart wird. Aber die Lehrmeister der Evolution sind nicht so zimperlich; sie haben uns reichlich mit Schmerz- und Angstbereitschaften ausgestattet, damit wir uns unser Überlebensrepertoire genügend zu Herzen nehmen.
Viele höhere Tiere haben vor allem Angst, was sie nicht kennen, und meiden Nähe zu allem, was sie nicht beherrschen können, auch zu Artgenossen. Da zu ihrer Fortpflanzung körperlicher Austausch notwendig ist, haben sie Balzrituale entwickelt, um diese Vermeidung zu überwinden. Diese Angst vor dem Artgenossen fehlt in der Beziehung zum Nachwuchs, der Schutz bei der Mutter sucht. Oft geht bei Säugetieren die Trennung von der Mutter aus, die das bisherige „Kind“ als „Erwachsenen“ erkennt und den artgemäßen Abstand herstellt. Mütter, die erwachsene Kinder noch festhalten und nicht aufhören können, sie zu bemuttern, gibt es im Tierreich nicht.
Die Verhaltensforscher haben diese Reifungsprozesse von instinktiven Angstreaktionen untersucht; der Psychotherapeut kann nur mit der banalen, aber folgenschweren Ergänzung dienen, dass diese Tiere ihren Angsthaushalt weit ökonomischer gestalten können als der Mensch. Wer jeden erwachsenen Artgenossen für einen Störenfried hält und nur durch die Verblendung der Brunft diese Grundhaltung kurzfristig überwindet, kennt keine Bindung und braucht sich nicht vor den zahllosen Quellen von Angst und Schmerz zu fürchten, die mit einem Bindungs- oder Liebesleben zusammenhängen.
Weil unsere Situation derart kompliziert ist, entwickeln wir ein geistiges System, um zukünftige Ereignisse vorauszuberechnen und Schmerz- wie Angstquellen zu orten, um sie zu vermeiden oder zu bekämpfen. Damit ergänzen wir die äußere Realität, die uns viel antun kann, durch eine innere, die unter Umständen noch bedrohlicher ist. Unsere Phantasie kann uns vor Angst schützen, indem sie uns Gefahren voraussehen lässt; aber sie kann uns auch in Ängste stürzen, wenn sie dabei nicht durch ein Stück Unbekümmertheit und Zukunftsvertrauen gezügelt wird. Die meisten „modernen“ Ängste stammen aus narzisstischen Quellen. Sie sind mit dem Erhalt des Selbstgefühls verknüpft. Dieses bildet sich entsprechend den Rollenerwartungen unserer Kultur und organisiert sich sozusagen auf jeder Stufe der Kulturentwicklung neu. Der Arme fürchtet sich zu verhungern und glaubt, der Reiche sei frei von Ängsten. Sobald er selbst reich sei, hätte er auch keine Angst mehr. Reich geworden, kann er uns dann Auskunft über die Tatsache geben, dass sich unsere Ängste auf jeder Stufe unseres Selbstwerterlebens und unserer materiellen Absicherung neu bilden.
Angst differenziert nicht, sie vereinfacht. Es gibt in ihr keine unterschiedlichen Probleme mehr, sondern nur noch die eine, die umfassende Katastrophe. Daher sind wir in einer Angststimmung auch nicht zufrieden, wenn wir ein Problem erkannt und das in unserer Macht liegende getan haben, um es zu bewältigen. Wir müssen wieder und wieder in schlaflosen Nächten durchspielen, ob wir auch wirklich alles getan haben, wir können sozusagen unsere Gedanken nicht zu Ende denken und abschließen: Wenn unser Kind eine schlechte Note hat, wird es als Landstreicher unter einer Brücke schlafen müssen; wenn wir eine Verhärtung in unserem Körper ertasten, müssen wir an Krebs sterben; wenn wir nicht noch einmal prüfen, ob die Türe verschlossen ist, wird ein Einbrecher unsere Wohnung ausräumen.
In dem Bestreben, uns wirksam vor Gefahren zu schützen, übertreibt die Angst deren Folgen. So ängstigt uns die Phantasie drohender Ereignisse oft mehr, als es diese selbst tun, wenn sie tatsächlich eingetreten sind. Angstpatienten, die wirklich in Lebensgefahr geraten, Trennungsängstliche, die wirklich verlassen werden, wundern sich oft, wie ruhig sie bleiben. Das liegt zunächst daran, dass in unserer Phantasie alle „erdenklichen“ Gefahren zugleich vorweggenommen werden, wenn wir erst einmal in die Angststimmung geraten sind, während wir in der Realität nur jeweils einem Problem begegnen.
Ich erinnere mich, dass ich als junger Student bei meinem ersten Praktikum in einer psychiatrischen Klinik den Patienten mit der latent ängstlichen Erwartung entgegentrat, mit allen erdenklichen Formen der Verrücktheit – so wie ich sie aus der Lektüre kannte – konfrontiert zu werden. Folgerichtig war ich dann sehr überrascht, wie normal die Patientinnen und Patienten waren, mit denen ich mich beschäftigen und die ich testen sollte. Gewiss gab es alle Störungen, von denen ich gelesen hatte, aber jeder Patient hatte sozusagen nur eine davon, keiner war „total verrückt“, das meiste, was mir an den Kranken begegnete, kannte ich aus eigenem Erleben.
Mein Angstbild, dass die Kranken mich mit allen möglichen Bizarrerien erschrecken würden (ein Bild, das die meisten Spielfilmszenen aus dem Inneren einer Nervenklinik bestätigen), kippte in den Eindruck um, dass ihnen nur ein winziges Stück Anpassungsfähigkeit fehlte, um gerade so zu leben wie die Menschen draußen auch.
Wie viel mehr Angst unsere Wahrnehmungen durchtränkt, als wir es uns bei nüchterner Überlegung eingestehen würden, hat ein Team um den Harvard-Psychologen Daniel T. Gilbert gezeigt. Die Forscher ließen über fünfhundert Menschen, von denen die Hälfte vor kurzem einen Liebespartner verloren und die andere Hälfte vor kurzem einen gewonnen hatte, die Dauer ihrer Glücks- bzw. Elendsgefühle schätzen. Es zeigte sich, dass Menschen die Dauer ihrer Euphorie angesichts eines Erfolgserlebnisses realistisch einschätzen können. Angesichts eines Schicksalsschlages aber überschätzen sie die Dauer ihrer Depression erheblich.
Man kann fragen, ob die Angst der Agent eines Realitätsverlustes im Negativen ist, während die Lust an die positive Realität bindet. Eindeutig ist der Angstnutzen: Wenn wir wüssten, wie gut wir auch mit unangenehmen Dingen fertig werden, würden wir uns weniger bemühen, sie zu vermeiden. Die Angst steigert ihre Macht, indem sie unser Wissen um die Mittel verdüstert, diese Macht einzuschränken.
Angst vermindert sich durch Gewöhnung und/oder durch Flucht. Wo wir nicht fliehen können, müssen wir auf die Gewöhnung vertrauen. Jede Angst, an die wir uns gewöhnen, stärkt unsere Möglichkeiten, Angst zu beherrschen, während jede Angst, die Flucht durchgesetzt hat, in ihrer Macht bestehen bleibt.
Eine psychoanalytische Ergänzung dieser einfachen Grundgesetze (auf denen ein großer Teil des aus der Lerntheorie abgeleiteten, therapeutischen Standardumgangs mit der Angst beruht) betrifft die Angstvermeidung durch Unbewusstmachen: durch Verdrängung, Verleugnung oder Kombinationen beider. Zu verdrängen ermöglicht eine Flucht nach innen. Wie durch jede Flucht wird auch durch diese der Sicherheitsabstand wiederhergestellt und so die Empfindung der Kontrolle über die Umwelt erneuert. Aber das Verdrängte ist nicht bewältigt. Wenn es wiederkehrt, plagt es das Ich aufs Neue. Gegen die Verdrängung mobilisieren wir die Einsicht: Sie erlaubt dem verdrängten Inhalt die Existenz im Bewusstsein unter der Bedingung , dass er keinen Schaden anrichtet. Daher ist die Einsicht auch dem Affekt ebenso unterlegen, wie der Diplomat dem Soldaten.
Die menschliche Kulturentwicklung ist eine Geschichte von Versuchen, Ängste zu binden. Der Betrachter von Küstenlandschaften des Mittelmeers wird nicht begreifen, weshalb früher die Bauern ihre Dörfer weitab von ihren Feldern in der Ebene am Meer auf schwer zugängliche Hügel bauten, von denen sie weite Wege zu ihren Äckern hatten. Erst wenn ihm erklärt wird, dass seit Jahrtausenden Piraten wechselnder Herkunft – Phönizier, Griechen, Wikinger, Sarazenen und Türken – diese Küsten heimgesucht haben, wird der Sinn dieser Dorf-Festungen klar. Wer das Meer aus sicherer Entfernung überblicken kann, fühlt sich vor den Feinden geschützter, die ihn von dort überfallen könnten. Seit Touristen die Piraten abgelöst haben, verfallen die Dörfer in den Bergen. Ihre Bewohner ziehen in die Küstenstädte.