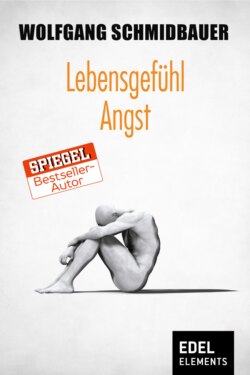Читать книгу Lebensgefühl Angst - Wolfgang Schmidbauer - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Hai-Syndrom oder die Verbesserung des Guten
Оглавление„Wir halten es für durchaus normal, dass das Mädchen von vier Jahren schmerzlich weint, wenn ihm eine Puppe zerbricht, mit sechs Jahren, wenn ihm die Lehrerin einen Verweis gibt, mit sechzehn Jahren, wenn der Geliebte sich nicht um sie bekümmert, mit fünfundzwanzig Jahren vielleicht, wenn sie ein Kind begräbt ... Es würde uns aber auffallen, wenn dies Mädchen als Frau über die Beschädigung einer Nippessache weinen würde. So benehmen sich aber die Neurotiker ... sie halten an allen früheren Angstbedingungen fest.”11
Hochseehaie unterscheiden sich von anderen Fischen in zwei Merkmalen: durch ein leichtes Knorpelskelett und durch das Fehlen einer Schwimmblase. Dieser regulierbare Luftbehälter dient den Fischen dazu, im Wasser stehen zu bleiben, ohne zu sinken. Nur Grundfische (wie etwa Schollen) können auf ein solches Organ verzichten. Haie hingegen müssen schwimmen, um nicht unterzugehen. Sie können nicht anders, es muss immer vorwärts gehen.
Mit dem Begriff des „Hai-Syndroms“ suche ich nach einer Metapher für die Unfähigkeit, etwas „gut sein zu lassen“, wie die Redensart sagt. Im Hai-Syndrom äußert sich eine ängstliche Spannung indirekt. Sie führt dazu, dass ein Zustand verbessert werden soll, der an sich gut ist, um in der Zukunft drohende Gefahren gleichsam vorbeugend zu bekämpfen.
Das Hai-Syndrom hat viel mit dem Zwang zu tun, etwas oder sich zu beweisen. Diese Beweisnot hängt mit dem Perfektionismus zusammen, der dazu dienen soll, Selbstgefühlsmängel auszugleichen und traumatische Belastungen der Psyche ungeschehen zu machen.
Ein Kind kommt von der Schule nach Hause.
„Wie war’s denn?“ fragt seine Mutter
„Wie soll’s schon gewesen sein?“ gibt das Kind trotzig zurück.
„Warum bist du nur so unfreundlich!“ sagt die Mutter. „Es interessiert mich eben, vielleicht kann ich helfen.“
„Warum lässt du mich nicht in Ruhe!”12
Untersuchen wir den Hintergrund dieser Szene, entdecken wir vielleicht eine Mutter, die dadurch verunsichert ist, dass ihre Kontrolle über das Leben des Kindes schwindet und sie nicht mehr die wichtigste, allwissende Person in dessen Leben ist. Dieser Bedeutungsverlust weckt bei der Mutter narzisstische Ängste, die sich darauf beziehen, dass er zunehmen, sich vertiefen, schlimmer werden könnte. Dagegen will sie etwas unternehmen. Sie stellt die Kontrollfrage und erlebt sich bemüht, auf dem Sprung, dem Kind zu helfen.
Das Kind hingegen erlebt keineswegs die Mutter, die sich ihm zuwendet und es unterstützt. Es findet nicht, dass die Mutter ihm etwas Gutes tut, sondern dass sie Aufmerksamkeit fordert und das Kind überlastet, das mit einem ganz anderen Prozess beschäftigt ist, in dem die Werte und Wünsche der Mutter es nur verwirren würden.
Warum lässt sie mich nicht los, denkt es, warum stört sie mich dabei, selbst die komplexen Wahrnehmungen zu ordnen, die jeder Schultag mit sich bringt? Für das Kind geht es darum, sich gegenüber Freundinnen und Lehrern zu positionieren, deren Verhalten einzuschätzen, sich zu überlegen, ob und wie sich die Beziehungen in der Schule gestalten lassen.
So lässt sich die Mutter am ehesten mit einem Zuschauer vergleichen, der dem Maler über die Schulter schaut und ihn fragt, was er da macht. Picasso hat gegen solche Zudringlichkeit die Plakette aus dem Bus zitiert: „Es ist verboten, während der Fahrt mit dem Chauffeur zu sprechen!”
Eine von Depressionen und Ängsten belastete Frau hat mir einmal erzählt, wie sie sich als Kind jeden Tag davor fürchtete und schämte, aus der Schule nach Hause zu kommen. Sie hatte bemerkt, dass die Mutter es nicht vertrug, wenn sie das tat, was sie am liebsten getan hätte: für sich zu behalten, was im Unterricht und in den Pausen geschehen war. So hatte sie sich daran gewöhnt, der Mutter Lügenmärchen aufzutischen, in denen die Tochter sich so darstellte, wie sie glaubte, dass die Mutter sie sich wünschte.
An dieser Szene lässt sich die Dynamik der Überbeschützung ablesen. Sie wurzelt darin, dass eine Person nicht sicher ist, gut genug für eine andere zu sein, und daher von sich und/oder von ihrem Gegenüber einen Beweis fordert bzw. einen autonomen Akt als Gegenbeweis deutet. In unserem Beispiel ist sich die Mutter nicht sicher, dass sie eine gute Mutter ist. Sie kann die Tatsachen – das Kind ist gesund, geht in die Schule, kommt heim, isst und schläft – nicht als ausreichenden Beweis deuten, dass alles in Ordnung ist, kann sich nicht selbst als gute Mutter und das Kind als gutes Kind bestätigen, kann sich nicht freuen und sehen, wie viel schlechter sie es treffen könnte.
Um die Kraft zu haben, sich überbeschützend in einen anderen Menschen einzumischen, muss es den Beteiligten relativ gut gehen. Die ängstliche Mutter hat viele Energien frei, die sie nicht sinnvoll einsetzen kann und daher verwendet, um sich schuldig für Probleme zu fühlen, die sie selbst inszeniert hat. Sehr treffend charakterisiert das der Witz von den zwei Krawatten, welche die Mutter dem Sohn geschenkt hat. Am nächsten Tag trägt er die eine, woraufhin die Mutter sagt: „Deine dumme alte Mutter hat keinen Geschmack, die andere Krawatte gefällt dir nicht!”
Die vom Hai-Syndrom Betroffenen müssen immer nach Beweisen suchen, dass sie „gut“ sind, oder Deutungen entkräften, die sie selbst vornehmen und die in ihnen einen Selbstzweifel geweckt haben. Häufig entfalten sie besonders hektische Anstrengungen, um Spaltungen zu „überwinden“ bzw. sich für imaginären Heroismus anerkennen zu lassen. Gerade in Beziehungen mit „guten“, versorgenden Partnern fühlen sich Personen mit Selbstgefühlsproblemen unsicher und stören oft das Gute, das sie haben, durch den Versuch, es zu verbessern, bis sich schließlich niemand mehr wohl fühlt. Ein Beispiel:
Eine ängstliche und unsichere Frau heiratet nach der ersten Liebesenttäuschung den braven Beamten, der um sie geworben hat. Er bietet ihr ein solides Leben an seiner Seite, geht aber in seinem Dienst auf und hat nur sehr wenige Interessen außerhalb seiner Arbeit. Er hat bald erkannt, dass sie seine Wünsche durch ihre Wünsche überschreibt, aber die Ängste, in seiner Arbeit den geringsten Fehler zu machen, absolut respektiert. So zieht er sich oft hinter Fachzeitschriften zurück und weist Reisepläne für die Familie, die er zu kostspielig findet, mit dem Hinweis auf Dienstverpflichtungen ab.
Der gemeinsame Sohn wird zum teilnahmsvollen Zuhörer der Mutter, die ihm fast jeden Tag schildert, wie sie neben diesem Pedanten emotional verkümmert. Er versucht, sie aufzuheitern, ist Sonnenschein und Musterschüler, erkrankt während des Studiums an Angstzuständen und behauptet im Alter von 35 Jahren, er wisse einfach nicht, ob er homo- oder heterosexuell sei, er könne sich nicht vorstellen, das eine oder das andere zu probieren.
Wenn die Mutter den Vater entwertet und den Sohn in ihren Liebesbekundungen und Liebesforderungen an dessen Stelle setzt, reagiert dieser auf die Forderungen, erwachsene Sexualität zu leben mit schwer überwindlicher Angst. Sie mündet oft in das Bestreben, sich erst dann auf eine Beziehung einzulassen, wenn er ganz sicher ist, dass alles perfekt funktioniert. Er kann seine Erotik nicht spielerisch erproben und aus Rückmeldungen lernen.
So entsteht die für die Näheangst charakteristische Mischung aus heftiger Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, verknüpft mit destruktiver Entwertung des Möglichen. Die Mutter wollte den Sohn zu einem viel besseren Mann machen, als es sein Vater war. Ihre Absicht bewirkt aber das Gegenteil: Der Sohn wundert sich, wie es sein Vater so lange mit einer Frau ausgehalten hat, und kann sich ein solches Leben nicht vorstellen.
Die nach dem Sohn geborene Tochter hat es leichter und schwerer zugleich. Sie erlebt sich zurückgesetzt und von der Mutter mit Vorwürfen überhäuft, dass sie nicht so lieb, nicht so brav wie der Bruder ist. Sie nähert sich dem Vater, der freilich in seinem Einfluss geschwächt ist, wenn die ganze Familie etwas unternimmt, aber doch bei der Tochter auf langen Wanderungen Freude an der Natur weckt. Sie wird Biologielehrerin, geht in ihrem Beruf auf und meidet Beziehungen zu Männern, in denen sie unbewusst eine Wiederholung der Entwertung und Fesselung durch die Mutter erwartet.
Das Hai-Syndrom lässt dort Angst stärker werden, wo Ruhe wäre; umgekehrt wird aber häufig auch die Anstrengung beklagt, die darin liegt, ständig nach Beweisen Ausschau zu halten und sich bemühen zu müssen. Während die Umstehenden denken, warum diese Person einfach nicht Ruhe geben kann, warum sie, wenn etwas gut und geordnet funktioniert, alles von Grund auf umstürzen möchte, sieht es für den Betroffenen anders aus. Er fürchtet sich, er glaubt, ins Bodenlose zu sinken, nutzlos zu sein, völlig allein und verlassen, weil es nichts zu kämpfen gibt und keine Not nach ihm schreit. Da erzeugt er lieber selber eine solche, als die Stille zu ertragen.
In Liebesbeziehungen führt das Hai-Syndrom dazu, dass die Erotik von dem Augenblick an nicht mehr so schön und aufregend ist, in dem das Paar sozusagen eine friedliche Bucht erreicht – zusammenzieht, heiratet, so eindeutig wird, dass beide entschlossen sind, zusammenzubleiben. Oft dauert es eine Weile, bis sich die Partner das gestehen können; manchmal wird die grausame Wahrheit über Jahre hin durch geschickte Täuschungen verschleiert und tritt erst ans Licht, wenn eine Geliebte oder ein Geliebter plötzlich die frühere Dynamik belebt.
Das Hai-Syndrom gehört zur Generation Angst. Es ist Ausdruck der Steuerung des Lebens durch narzisstische Ängste, die – anders als die primitive Steuerung durch Hunger und durch Liebe
– buchstäblich unersättlich sind. Ruhm und Sicherheit bzw. ihre Symbole (deren erstes heute das Geld ist) kann ich nie genug haben, während ich vom Essen satt und von der Liebe müde werde
– bis zum neuen Erwachen des Hungers, der Libido. Was die narzisstischen Ängste so quälend macht, ist die inszenierte Gefahr, die an Stelle der realen Gefahren durch Hunger oder Raubtier tritt. Diese Angst schärft den Geist und steigert die Wachsamkeit so sehr, dass keine Ruhe mehr möglich ist, weil es keine Triebziele gibt (wie bei Hunger und Sexualität), sondern eine unerschöpfliche Kette von Szenarien, die alle das Selbst bedrohen könnten.
Es ist wie Lampenfieber ohne Auftritt; jedes der unendlich vielen Übel, die den Menschen befallen können, muss erkannt und überwunden werden. Die Zahl dieser Übel hat sich mit unserem Reichtum an Wissen über Krankheiten, Unfälle und Gefahren ständig vermehrt. Wir denken an immer ausgefallenere Risiken.
Ein Vater findet nach dem Gartenfest, dass seine 14-jährige Jüngste veranstaltet hat, ein Fläschchen ohne Etikett, gefüllt mit kleinen weißen Pillen. Er schluckt zwei und ist überzeugt, sich ganz merkwürdig zu fühlen – es muss Ecstasy sein! Später fasst er sich ein Herz, stellt seine Tochter zu Rede. Sie ist froh und höchst amüsiert, denn ein Mitschüler hat sein homöopathisches Medikament schon vermisst.
Eine Mutter reist weit, um einen Spezialisten und Autor eines Buches über Rauschdrogen auszuhorchen, welche Gifte ihr Sohn, ein guter Schüler und Fan von Heavy Metal Rock, einnimmt. Sie hat leider in seinem Zimmer nichts gefunden, wie könnten die bösen Designer-Drogen denn aussehen, soll sie einen heimlichen Urintest machen? Der Sohn leugnet alles, sie aber weiß es besser.
Das Hai-Syndrom signalisiert den Perfektionismus des verletzten Selbstgefühls, das nach Halt sucht. Am stärksten ausgeprägt ist es bei seelisch Traumatisierten. Wenn sie untätig sind, gewinnen Angst und Unruhe in ihnen quälende Macht. Unvergesslich ist mir Matusseks Bericht13 über einen Juden, der das KZ überlebte und als Friseurmeister in Deutschland blieb. Unter seinen Kunden waren sogar frühere SS-Leute. Er arbeitete von früh bis spät in seinem Laden, den er putzte und aufräumte, wenn die Angestellten gegangen waren.
Schrecklich dehnten sich die Wochenenden: Es gab nichts zu tun! Als Lösung fand er einen Schrebergarten, in dem er nun auch seine Freizeit mit körperlicher Arbeit verbringen konnte – dem einzigen Mittel, das ihn von seinen Ängsten ablenkte, die Vergangenheit könne wiederauferstehen.
Eine ähnliche Geschichte stammt von einem engagierten Journalisten, der mit seiner Frau ein Waisenkind aus Kambodscha adoptierte, das in den Todeslagern der Roten Khmer Eltern und Geschwister verloren hatte. Die liebevollen deutschen Eltern verzagten fast, weil das Kind nicht sprach und emotional nicht auf ihre Zuwendung reagierte. Es war von Angst wie gelähmt und schien sich erst dann ein wenig zu entspannen, wenn es im Garten arbeiten konnte; darin war es unersättlich und hätte am liebsten das schon einmal umgegrabene Beet noch ein zweites Mal mit dem Spaten bearbeitet.
Der Hai symbolisiert das Unheimliche: Unheimlich ist die Ruhelosigkeit der Traumatisierten, ihre Unfähigkeit, einen Erfolg anzunehmen, sich für Mühe durch Genuss, für einen anstrengenden Kampf durch friedliche Tage zu entschädigen. Wir denken an das narzisstische Motto des (fast) unsterblichen, (fast) unverwundbaren Highlanders in dem gleichnamigen Film mit Christopher Lambert: „Es darf nur einen geben!“ Wir erinnern uns an den frenetischen Beifall, den die Ober-Haie einst für ihre Hai-Frage „Wollt ihr den totalen Krieg?“ erhielten, und können schließlich der Frage nicht mehr ausweichen, ob angesichts der Konkurrenz in der Konsum- und Leistungsgesellschaft ein Nicht-Hai viel Aussicht auf politische Macht und wirtschaftlichen Einfluss hat.
Die Ruhelosigkeit hängt mit der Abwehr von Regression zusammen. Stillstand ist Rückschritt; wer nach hinten blickt, verliert das Ziel, erstarrt zur Salzsäule. Perfektionismus setzt voraus, dass eine Kultur Schrift besitzt: ein Medium, hinter das nicht zurückgekehrt werden kann, eine Norm, die fest steht, die sich unerreichbar und überfordernd über das menschliche Gefühlsleben legt, das doch stets träumerisch und verspielt von Schlaf und Überschwang heimgesucht wird.
In unserem Beispiel von der Mutter, die wissen will, was in der Schule war, sehen wir aus einer gemeinschaftlich getragenen und gemilderten Angst zwei Ängste von zwei Individuen werden. Das Kind ahnt, dass es die Ängste allein bewältigen muss, die durch den Schritt fort von der Mutter, hin zur Gruppe der Gleichaltrigen entstehen. Es kann nicht in diese Gruppe finden, ohne sich von der Mutter zu distanzieren.
Die Mutter hingegen muss ertragen, dass ihr Kind jetzt neue Normen gefunden hat, welche ihre Normen zum Teil ungültig machen. Die Situation ist paradox: je mehr die Mutter auf ihrer Normenkontrolle beharrt, desto unglaubwürdiger wird sie; je sicherer sie im Loslassen ist, desto eher wird das Kind ihre Nähe suchen, wenn es eine Atempause angesichts der neuen Forderungen und neuen Ängste braucht.
Dieses Paradox gilt allgemein im Umgang mit dem Hai-Syndrom. Wer sich über den Rastlosen beklagt und sein Verhalten unerträglich findet, steigert dessen Unsicherheit und damit auch sein Bemühen, diese Unsicherheit auszugleichen.
Wenn wir uns den altsteinzeitlichen Jäger vorstellen, lässt sich auch der Zusammenhang zwischen der Intensität von Rastlosigkeit und der Differenzierung des kulturellen Gehäuses rekonstruieren. Wenn der Jäger erwacht, wird er in seinen Körper horchen – schmerzt etwas? Eine alte Narbe? Liegt eine Mahlzeit schwer im Magen, oder hat er heftigen Hunger? Er wird seinen Bogen, seine Fallen prüfen, wird sehen, wie es seinen Angehörigen geht und dann hinausziehen, allein oder mit anderen.
Der Raum, in dem wir uns geistig bewegen und den wir nach Gefahren absuchen, ist gegenüber dieser archaischen Situation enorm gewachsen. Er ist nicht mehr überschaubar. Wir werden, je kritischer wir ihn prüfen, umso sicherer sein, dass wir nicht sicher sein können, dass uns gewiss etwas entgangen ist. Es gibt große Organisationen und viele Experten, die uns Sicherheit oder Vorsorge anbieten. Sie machen uns einerseits auf Gefahren aufmerksam, an die wir sonst gar nicht denken würden („Was passiert, wenn Sie durch einen Unfall arbeitsunfähig werden? Wenn Ihnen ein Reh vor das Auto springt? Wenn die Badewanne überläuft und einen Millionenschaden anrichtet?“). Um diese abzuwehren, fordern sie Opfer an Zeit und Geld. Auch im Körperinneren genügt es nicht mehr, hinzuspüren, ob Atem und Verdauung ihren Dienst tun; wir müssen uns untersuchen lassen, um rechtzeitig Gefahren zu finden, von denen wir noch gar nichts wissen.
Im Hai-Syndrom werden solche kulturell vorgegebenen Szenen verinnerlicht und übersteigert. Das verbindet es mit den zwanghaften Mechanismen. Auch hier wiederholen sich Gedanken oder Handlungen, manchmal bis zur völligen Erschöpfung. Sie überwältigen das Ich, und wenn dieses versucht, dem Zwangsimpuls zu widerstehen, wird es von so heftigen Ängsten gequält, dass ihm der sinnlose Zwang zum kleineren Übel wird.
So lässt sich das Hai-Syndrom als milde, alltagsnahe Form der Zwangskrankheit beschreiben, und diese als übersteigertes Bestreben, das Gute so zu bessern, bis es zum Übel wird. Wer sich die Hände nicht wäscht und die Tür nicht absperrt, ist nachlässig und geht überflüssige Risiken ein; wer aber die Hände so lange wäscht, bis sie schmerzen und die Tür so oft absperrt, dass er jede zweite Woche ein neues Schloss benötigt, der schadet sich mehr, als ihm die Nachlässigkeit jemals schaden könnte.
Freud hat in seiner großen Arbeit über „Hemmung, Symptom und Angst”14 beschrieben, wie sich äußere von inneren Gefahren unterscheiden: Das Raubtier würde uns anfallen, gleichgültig, wie wir uns benehmen und was wir ihm versprechen, während die geliebte Person, die wir zu verlieren fürchten, uns nicht bedroht, solange wir nicht von ihr unerwünschte Gefühle und Absichten in unserem Inneren nähren. Diese werden dann zum Bestandteil einer äußeren Gefahr.
Die Angst wird in der Psyche verarbeitet, und im Zug dieser Prozesse entstehen neue seelische Gebilde. Das hängt damit zusammen, dass die Angst vor der äußeren Gefahr – dem Raubtier – eine Grenze hat, der Rückzug in einen schützenden Raum das angsterfüllte Ich beruhigt, wie wir es uns vorstellen können, wenn wir nach einem nächtlichen Gang, auf dem wir uns von einem Unbekannten verfolgt fühlten, aufatmend die Haustür hinter uns verriegeln.
Sobald es sich um innere Gefahren handelt, können wir nicht mehr fliehen und uns nicht mehr schützen. Wir sind Jäger und Gejagte zugleich. Diese Situation entsteht, weil sich in uns aus den verinnerlichten, für unsere seelische Entwicklung lebensnotwendigen Elternbildern Strukturen entwickelt haben, die das Ich bedrohen und verfolgen, wenn es von einer Norm abweicht.
Der treulose Ehemann mag seine Frau täuschen; diese Instanz in seinem Inneren täuscht er nicht. Oft erlebt er ihre Kritik, die sich als Schuldgefühl äußert, mit solcher Angst, dass er sozusagen zu seiner Partnerin flieht und sie bittet, ihn vor diesen Schuldgefühlen zu schützen, er hat es ja nicht so böse gemeint. In anderen Fällen ist die Szene weitgehend unbewusst: Der Verbrecher verrät sich selbst, um durch die dann von außen kommende Verfolgung die inneren Strafen zu mildern. Auch die bereits beschriebenen Selbstverletzungen enthalten den Versuch, eine innere, unsichtbare Angstdynamik in eine sichtbare Wunde zu verwandeln, die dann gepflegt werden kann.
Das Ich, in dem die Angst entsteht, und das Es, welches die gefährliche Wut gegen das Liebesobjekt entwickelt, sind beide Teile unserer Psyche. So verwundert es nicht, wenn aus dem Einwirken des Ich auf das Es (und umgekehrt) Neubildungen entstehen. Zwangssymptome sind ein Beispiel dafür; sie deuten den Triebcharakter durch ihre Impulsivität an, den Einfluss des Ichs durch ihre Gestalt (eben die Verbesserung des Guten) und die Abkunft von der Angst dadurch, dass diese sich bemerkbar macht, wenn der Vollzug der Zwangshandlung blockiert wird.
In dieses Bild fügt sich die Beobachtung, dass in dem Augenblick, in dem reale Gefahren drohen, das Hai-Syndrom ebenso verschwindet wie viele Zwangssymptome. Daraus lässt sich auch der ebenso wichtige wie schwer zu befolgende Rat an Angst- und Zwangskranke ableiten, von dem wir schon sprachen: die Angst und den Zwang möglichst zu ignorieren, sich in keiner Entscheidung von ihnen beeinflussen zu lassen und nicht durch Vermeidungsverhalten zu zeigen, dass ihre Macht stärker ist als die der Vernunft.
Wer erlebt, dass er an seiner Angst nicht stirbt, kann auch in anderen Bereichen dem Leben mehr Platz schaffen. Der perfektionistische Teufelskreis will uns erklären, dass wir erst dann einen Schritt tun dürfen, wenn wir ihn nicht mehr fürchten; die Analyse der Angst aber belehrt uns, dass wir den Schritt umso weniger fürchten werden, je eher wir ihn tun, gleichgültig, was die Angst zu vermeiden gebietet. Am Anfang war die Tat, das gilt überall, besonders jedoch in Bezug auf die menschliche Angst.