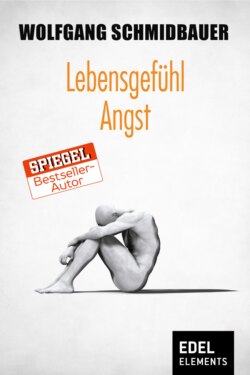Читать книгу Lebensgefühl Angst - Wolfgang Schmidbauer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Der Mitmensch als Angstquelle
ОглавлениеDas Beispiel der Piraten zeigt, dass der Mensch für den Menschen immer beides ist: die wichtigste Quelle von Angst und die wichtigste Quelle von Sicherheit. Der Dörfler fürchtet sich vor dem Fremden und sucht Schutz bei seinem Nachbarn hinter einer gemeinsam erbauten Mauer. Im Märchen wird dieses Thema etwa so dargestellt: Der verirrte Wanderer ist angesichts seiner Ängste im finsteren Wald entzückt, das Licht einer Köhlerhütte zu sehen. Er eilt darauf zu – und sieht sich dort von Räubern umringt, die ihm ans Leben wollen.
Dieser Wanderer symbolisiert das Kind, das zu weit vom Vertrauten entfernt ist. Wer sich fern der Heimat verirrt hat, weiß nicht, ob die Menschen, auf die er trifft, ihm die Sicherheit spenden können, nach der er sich sehnt. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass diese Sicherheit von einem gesunden Kind als beengend erlebt wird. Die ersten Schritte führen in der Regel von der Mutter weg.
Der Erwachsene erinnert sich an beides: an die schreckliche Angst, die Mutter zu verlieren, das Wesen einzubüßen, dessen Anwesenheit Sicherheit verheißt, und ebenso an die Angst, eingesperrt zu sein, gefesselt, angeödet, ohne Möglichkeit, etwas Neues zu erleben und zu erobern. In den narzisstischen Störungen, die früher vor allem als „Angstneurosen“ beschrieben wurden, sind beide Formen übersteigert. Diese Menschen binden sich manchmal extrem schnell und behaupten schon nach wenigen Tagen, sie würden einen Partner nie wieder verlassen. Diese Beziehung beruht gewissermaßen auf der Abspaltung alles Trennenden, das nicht integriert ist und zu plötzlichen Trennungen oder impulsiven Ausbrüchen von Hass führen kann. In der Therapie macht sich das dadurch bemerkbar, dass die Patienten scheinbar wahllos von Arzt zu Arzt gehen und auch Quacksalber keineswegs verschmähen. Nicht selten versuchen sie, „mehrere Eisen im Feuer” zu haben, d.h. mehreren Helfern (oder auch Geliebten) zu beteuern, sie seien die einzig wichtigen. Ein gemeinsamer Nenner dieser Probleme ist das ängstliche Bestreben, schnell eine „gute“ und „richtige“ Situation zu finden. Im Grunde traut sich der narzisstisch Gestörte die gute Beziehung, die er ersehnt, gar nicht zu. Und je mehr das Gute, das wir haben könnten, überhand nimmt, desto häufiger müssen auch diese Störungen werden.
Probleme, deren ungünstigen Ausgang wir fürchten, ohne dass wir sogleich etwas unternehmen können, werden in einer komplexen, materiell reich versorgten Kultur immer häufiger. Wer auf dem Boden schläft, kann nicht aus dem Bett fallen, wer kein Auto hat, fürchtet sich nicht vor dem Unfall und vor der Panne. Wer das Geld nicht kennt, den kümmern keine Schulden; wer nicht weiß, was ein Computer ist, hat auch keine Angst vor dem Virus, der seine Daten frisst.
Wenn der Steinzeitjäger sich von einem Feind bedroht fühlte, musste er kämpfen oder fliehen. In beiden Reaktionen baute sich seine Angst ab. Wenn der moderne Angestellte sich vor einem Kollegen bedroht fühlt, kann er meist weder das eine noch das andere. Er muss morgen wieder ins Büro und den Menschen höflich begrüßen, den er im Verdacht hat, eine feindliche Intrige zu spinnen, die ihn den Arbeitsplatz kosten kann.
„Höflich“ ist hier ein Schlüsselwort. Unsere moderne Kultur im Umgang mit Affekten ist an den feudalen Höfen entstanden, in denen rangniedrige Männer lernen mussten, mit ranghohen Frauen umzugehen – während doch in der „unhöflichen“ Vorzeit der Stärkere (also der Mann) notfalls mit Fäusten sein Recht schaffen konnte. Norbert Elias hat viel Material gesammelt, das belegt, wie aus den Regeln für den „Hofmann“ die bürgerliche Höflichkeit entstand, ohne die eine moderne Gesellschaft undenkbar wäre.10 Mit und dank dieser Höflichkeit ist sie aber auch eine Veranstaltung, welche Neurosen und psychosomatische Erkrankungen fördert.
Je weiter der „Prozess der Zivilisation“ voranschreitet, desto stärker prägen sich Aufschübe in der unmittelbaren Umsetzung von Affekt zur Handlung aus. „Selbstbeherrschung“ ist gefragt. Der mittelalterliche Krieger schlug jeden mit dem Schwert nieder, der ihn beleidigte. Der moderne Soldat trägt den Konflikt einem Ranghöheren vor.
Die Entwicklung der Höflichkeit zeigt, dass der Mensch als Angstquelle die „wilde“ Natur zu ersetzen beginnt und nun mehr und mehr Regeln benötigt, um die aus dieser neuen Abhängigkeit stammenden Ängste zu bändigen. Historisch ist der Zusammenhang zwischen der Geburt von solchen Ritualen und der Verschärfung der Verteilungskämpfe deutlich, die anbrechen mussten, sobald eine Stammesgesellschaft nichts mehr zu erobern hatte. Ein Feudalherr war darauf angewiesen, seine Diener durch großzügige „Lehen“ bei der Stange zu halten (die ja ursprünglich die Fahnenstange war, die er im Kampf mit sich führte).
Die Angst in einer traditionsbestimmten Gesellschaft hatte zwei wesentliche Quellen: die Gefahren, welche von der Natur ausgingen, und die Gefahren, welche die Kultur mit sich brachte, indem sie jene bedrohte, welche nicht in einer der angebotenen Rollen zufrieden waren. Der Sohn des Handwerkers musste ein Handwerk erlernen, der Hoferbe wurde Bauer, die unverheiratete Tochter Magd oder Klosterschwester.
In den Freisetzungsprozessen der Industriegesellschaft sind solche Ängste vergleichsweise harmlos und selten, verglichen mit der zentralen neuen Angstquelle, der narzisstischen Angst. In ihr wird eine Beeinträchtigung des Selbstgefühls gefürchtet. Reale, öfter noch imaginäre Dritte, vor denen ich mich schämen, denen gegenüber ich mich schuldig fühlen muss, bedrohen mich mit Entzug von Liebe, Bewunderung, Aufmerksamkeit. Irgendetwas, das ich angefangen habe, wird nicht gut ausgehen, wenn ich nicht ständig dabei bin und aufpasse.
Auch hier spielen kulturelle Faktoren eine wichtige Rolle. Je weiter sich der Mensch von der Natur entfernt und in riesigen Städten lebt, desto weniger kann er sich auch auf seine Umwelt verlassen. Er müsste sie kontrollieren, kann es aber nicht. Er müsste Einfluss nehmen, ist jedoch unsicher, ob es gelingt.
In einer traditionellen Kultur, gleichgültig ob von Pflanzern, Hirten oder Bauern, gibt es lange Perioden, in denen organisches Leben wächst, nach seinem eigenen, vom Menschen nur wenig beeinflussten Rhythmus und Tempo. Es macht, wie das chinesische Sprichwort sagt, keinen Sinn, an den Halmen zu ziehen, damit der Reis schneller wächst.
In einer modernen, gemachten, konstruierten, gebauten Umwelt ist das bereits ganz anders, noch viel mehr aber in einer, in der entscheidende Eindrücke von einem neben dem wirklichen Leben ablaufenden, enorm beschleunigten virtuellen Leben ausgehen. Diese Erfahrung multipliziert in der Phantasie die Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu gewinnen, bewundert zu werden, glücklich zu sein, parallel dazu aber auch die Gefahren, solche Ziele nicht nur nicht zu erreichen, sondern einer der ebenso vielen negativen Inszenierungen zum Opfer zu fallen.
Die Zukunft der meisten Menschen und damit auch der menschlichen Ängste liegt in Mega-Citys wie Istanbul, Mexiko City, Kalkutta, Sao Paulo, Lagos, Manila, Kairo oder Schanghai. Während vor hundert Jahren noch weitaus die meisten Menschen in Dörfern lebten, hat sich die Verstädterung gerade in den Entwicklungsländern rapide beschleunigt. Die meisten Städte mit über 10 Millionen Einwohnern sind gegenwärtig von chronischen Krisen und chaotischen Zuständen belastet, was die Versorgung, den Verkehr, die Luftverschmutzung und die Kriminalität angeht. Eine junge Brasilianerin aus begüterter Familie erzählt, dass es in ihrer Heimat selbstverständlich ist, vor der Heimkehr in die umzäunten und wie eine Festung bewachten Wohnanlagen der Reichen mit dem Handy den Wachdienst zu verständigen, der die sensiblen Augenblicke beschützt, in denen ein Auto mit reichen Insassen darauf wartet, dass sich das bewachte Tor öffnet.
So verwundert es nicht, dass die Angstbereitschaft enorm angewachsen ist und viele Menschen chronisch in einem Zustand des latenten Alarms leben. Sie halten ständig innere Übungen ab und erschöpfen sich darin wie der Kapitän eines Schiffes, der jeden Tag eine Seenotübung veranstaltet, bis seine Mannschaft so müde ist, dass sie im Ernstfall versagt. Diese Form der ängstlichen Suche nach Gründen für die eigene Angst kann zu einem Teufelskreis werden: Sie schwächt das Selbstgefühl und muss dann gesteigert werden, um es vor einem Zusammenbruch zu bewahren. In milderen Fällen führt sie nur dazu, Gutes zu „verbessern“ und dadurch kostbare Ressourcen zu verschwenden.