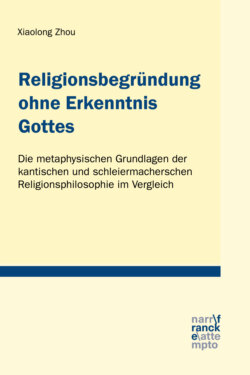Читать книгу Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes - Xiaolong Zhou - Страница 16
1.3.1 Die Analogie als eine Methode der Erkenntnis
ОглавлениеDer Anhang zur transzendentalen Dialektik der KrV ist in zwei Teile gegliedert, nämlich Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft und Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft. In diesem Anhang behandelt Kant ausführlich die Theorie der Analogie. Er weist in Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft darauf hin, dass es insgesamt zwei unterschiedliche Gegenstände gibt: „Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft als ein Gegenstand schlechthin, oder nur als ein Gegenstand in der Idee gegeben wird.“1 Deswegen haben wir entsprechend zwei Methoden, den Gegenstand zu bestimmen:
„In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direct kein Gegenstand, auch nicht einmal hypothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände vermittelst der Beziehung auf diese Idee nach ihrer systematischen Einheit, mithin indirect uns vorzustellen.“2
Einen Gegenstand schlechthin, bzw. einen realen Gegenstand, kann man direkt mit den Kategorien des Verstandes bestimmen. Allerdings ist der in der Idee gegebene Gegenstand nur ein Schema, der daher nicht direkt bestimmt wird, sondern nur indirekt „vermittelst der Beziehung auf diese Idee nach ihrer systematischen Einheit“. Es ist bekannt, dass in der Analytik der Grundsätze der KrV das Schema eng mit dem Verstandesbegriff verbunden ist, was also bedeutet „Schema“ an dieser Stelle?
Hier wende ich mich der anderen Deduktion der Vernunftidee zu, von der in Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft gesprochen worden ist. Genau wie sich Kant in Von der Deduction der reinen Verstandesbegriffe mit der objektiven Gültigkeit der Kategorien beschäftigt hat, möchte er auch hier die objektive Gültigkeit der Idee beweisen. Für eine Deduktion der Verstandesbegriffe oder der Kategorien hat man ein Schema in der Anschauung gefunden, doch für eine Deduktion der Vernunftidee ist der Fall ganz anders:
„Allein obgleich für die durchgängige systematische Einheit aller Verstandesbegriffe kein Schema in der Anschauung ausfindig gemacht werden kann, so kann und muß doch ein Analogon eines solchen Schema gegeben werden, welches die Idee des Maximums der Abtheilung und der Vereinigung der Verstandeserkenntniß in einem Princip ist […] Also ist die Idee der Vernunft ein Analogon von einem Schema der Sinnlichkeit, aber mit dem Unterschiede, daß die Anwendung der Verstandesbegriffe auf das Schema der Vernunft nicht eben so eine Erkenntniß des Gegenstandes selbst ist (wie bei der Anwendung der Kategorien auf ihre sinnliche Schemate), sondern nur eine Regel oder Princip der systematischen Einheit alles Verstandesgebrauchs.“3
In diesem Paragraphen sagt Kant sehr klar, dass „die Idee der Vernunft ein Analogon von einem Schema der Sinnlichkeit“ ist. Daraus folgt, dass der in der Idee gegebene Gegenstand für Kant nur ein Schema ist, doch kein sinnliches Schema, das „in der Anschauung ausfindig gemacht werden kann“, sondern nur ein Analogon des sinnlichen Schemas.4 Kant drückt hier aus, dass der Gegenstand der Idee nicht direkt durch Kategorien vorgestellt werden kann, doch dass dieser Gegenstand ein Analogon zu einem sinnlichen Gegenstand in Hinsicht auf eine systematische Einheit ist, die die Idee bedeutet. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Gegenstand der Idee nur durch eine Analogie erklärt werden kann.
In der „Analogie der Erfahrung“ der Analytik der Grundsätze der KrV findet sich ein sehr wichtiger Absatz, der von der Analogie handelt:
„In der Philosophie bedeuten Analogien etwas sehr Verschiedenes von demjenigen, was sie in der Mathematik vorstellen. In dieser sind es Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhältnisse aussagen, und jederzeit constitutiv, so daß, wenn drei Glieder der Proportion gegeben sind, auch das vierte dadurch gegeben wird, d.i. construirt werden kann. In der Philosophie aber ist die Analogie nicht die Gleichheit zweier quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse, wo ich aus drei gegebenen Gliedern nur das Verhältniß zu einem vierten, nicht aber dieses vierte Glied selbst erkennen und a priori geben kann, wohl aber eine Regel habe, es in der Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben aufzufinden.“5
Ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass der regulative Gebrauch eine enge Beziehung zur Analogie hat. Diese Tatsache wird eine hilfreiche Perspektive für das Thema dieser Untersuchung sein. Nun kann Kants Meinung wieder in zwei Teile gegliedert und analysiert werden: (1) Die Analogie bezieht sich nicht auf „die Gleichheit zweier quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse“. (2) Aus drei gegebenen Gliedern wird das vierte Glied nicht gegeben, sondern nur das Verhältnis zu diesem vierten Glied. Im Folgenden werde ich diese Punkte weiter veranschaulichen.
(1) Wenn in der Mathematik a : b = c : x gegeben ist, können wir unzweifelhaft schließen, dass x = b ^ c / a ist. Solange a nicht gleich Null ist, erhalten wir definitiv den Wert von x. Die Analogie der Philosophie ist jedoch keineswegs quantitativ gemeint. Diese Auffassung drückt Kant auch in den Prolegomena aus: „Eine solche Erkenntniß ist die nach der Analogie, welche nicht etwa, wie man das Wort gemeiniglich nimmt, eine unvollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommne Ähnlichkeit zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen bedeutet.“6 Denn was hier im Zentrum steht, ist die Ähnlichkeit zweier Verhältnisse, genauer gesagt: Das Verhältnis von a zu b ist dem von c zu x ähnlich. Um dies besser zu verstehen, wird die Anmerkung Kants zu diesem Absatz analysiert. Hier nennt Kant zwei Beispiele: Erstens gibt es eine Analogie zwischen den rechtlichen Verhältnissen menschlicher Handlungen und den mechanischen Verhältnissen der bewegenden Kräfte, weil alle wissen, dass das Recht eines Menschen gegenüber einem anderen dasselbe ist wie die Wirkung und Gegenwirkung. D.h. das Verhältnis hat eine Ähnlichkeit. So behauptet Kant: „Vermittelst einer solchen Analogie kann ich daher einen Verhältnißbegriff von Dingen, die mir absolut unbekannt sind, geben.“7 Zudem wird noch ein anderes Beispiel beschrieben, das direkt mit unserem Thema verbunden ist: „wie sich verhält die Beförderung des Glücks der Kinder = a zu der Liebe der Eltern = b, so die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts = c zu dem Unbekannten in Gott = x, welches wir Liebe nennen.“8 Kant betont hier, dass, obwohl Gott uns unbekannt ist, das Verhältnis seiner Liebe zur Wohlfahrt dem Verhältnis der Liebe der Eltern zur Beförderung des Glückes der Kinder ähnlich ist.
(2) Jetzt kann festgestellt werden, dass es bei a : b = c : x eine Ähnlichkeit des Verhältnisses gibt. Somit werden, wenn auch das unbekannte x nicht direkt bestimmt oder erkannt werden kann, doch seine Eigenschaften durch die Analogie festgehalten. Jetzt stellt sich die Frage, um welch ein Verhältnis es hier geht. In den Prolegomena sagt Kant deutlich: „Der Verhältnißbegriff aber ist hier eine bloße Kategorie, nämlich der Begriff der Ursache.“9 D.h. die Gleichung a : b = c : x wird aufgestellt, weil die Kausalität zwischen a und b und die Kausalität zwischen c und x analog sind. Die Behauptung wird in der KU von Kant noch weiter ausgeführt:
„Analogie (in qualitativer Bedeutung) ist die Identität des Verhältnisses zwischen Gründen und Folgen (Ursachen und Wirkungen) […] So denken wir uns zu den Kunsthandlungen der Thiere in Vergleichung mit denen des Menschen den Grund dieser Wirkungen in den ersteren, den wir nicht kennen, mit dem Grunde ähnlicher Wirkungen des Menschen (der Vernunft), den wir kennen, als Analogon der Vernunft; und wollen damit zugleich anzeigen: daß der Grund des thierischen Kunstvermögens unter der Benennung eines Instincts von der Vernunft in der That specifisch unterschieden, doch auf die Wirkung (der Bau der Biber mit dem der Menschen verglichen) ein ähnliches Verhältniß habe. Deswegen aber kann ich daraus, weil der Mensch zu seinem Bauen Vernunft braucht, nicht schließen, daß der Biber auch dergleichen haben müsse, und es einen Schluß nach der Analogie nennen.“10
Hier weist Kant deutlich darauf hin: „Analogie (in qualitativer Bedeutung) ist die Identität des Verhältnisses zwischen Gründen und Folgen (Ursachen und Wirkungen).“ Dementsprechend änderte Sebastian Maly die obige Formel in U1 : W1 = U2 : W2. Dabei steht „U“ für Ursache, „W“ für Wirkungen, und diese Analogie wird „Proportionalitätsanalogie“ genannt.11 In Abschnitt 1.4 wird deutlich werden, dass Kant dazu neigt, das Verhältnis zwischen Gott und Welt als das zwischen Grund und Folge zu bestimmen. Aus diesem Grund bevorzuge ich hier die Formel G1 : F1 = G2 : F2. Im obigen Beispiel wies Kant darauf hin, dass sich die Kunsthandlungen des Bibers auch auf ein „Analogon der Vernunft“ stützen, da menschliche Kunsthandlungen als Konsequenz auf der menschlichen Vernunft beruhen. Wir können aber nicht daraus schließen, dass der Biber eine solche Vernunft besitzt. In dieser Formel können G1, F1, F2 durch Erfahrung erlernt sein, aber wir haben für G2 keine sinnliche Anschauung und Intuition, so dass wir nicht wissen können, ob es wirklich existiert, und was wir hervorgebracht haben, sind nicht die Eigenschaften der Sache selbst. Aber analog können wir uns G2 als Analogon von G1 vorstellen.
An dieser Stelle fasse ich die Punkte (1) und (2) wie folgt zusammen: Analogie ist für Kant eine wichtige Methode, ein unbekanntes Ding x zu erkennen. Doch kann x nicht direkt bestimmt werden, folglich soll man x in ein Verhältnis setzen. X wird als Grund von c bestimmt, das kausale Verhältnis ist dem zwischen Grund b und Folge a ähnlich. Damit können wir eine indirekte Erkenntnis von x erhalten. Damit kann eine indirekte Erkenntnis von x erzielt werden. Natürlich wird Kant nicht müde zu betonen, dass diese Erkenntnis nicht gewiss und diskursiv ist.