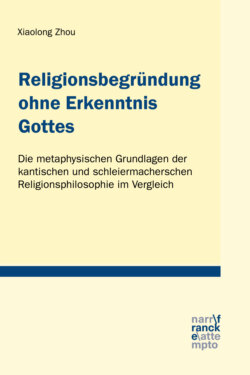Читать книгу Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes - Xiaolong Zhou - Страница 18
1.4 Die Ideen Gottes als das Substratum für die Materie und Form der Welt
ОглавлениеIn den Abschnitten 1.2 und 1.3 habe ich schon gezeigt, dass Kant von der transzendentalen und aposteriorischen Methode aus jeweils versucht hat, Gott zu erkennen bzw. die Eigenschaften Gottes zu bestimmen. Die transzendentale Methode betrachtet Gott als die höchste Intelligenz, die aposteriorische Methode als das ens realissimum. Jetzt werde ich das Verhältnis zwischen den beiden Ideen Gottes betrachten im Hinblick darauf, ob es doch eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen gibt. Es kommt mir hier darauf an, zu betonen, dass das ens realissimum Gott als Substratum der Materie der Welt bezeichnet, und dass die höchste Intelligenz Gott als Substratum der Form der Welt charakterisiert.
Im sechsten Abschnitt des Theologie-Hauptstückes, wird die Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises ausgeführt. Hier gibt es einen Absatz, der für die Fragestellung dieser Dissertation sehr wichtig ist. Er lautet wie folgt:
„Nach diesem Schlusse müßte die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit der Form, aber nicht der Materie […] beweisen […] Der Beweis könnte also höchstens einen Weltbaumeister, der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre, aber nicht einen Weltschöpfer, dessen Idee alles unterworfen ist, darthun […] Wollten wir die Zufälligkeit der Materie selbst beweisen, so müßten wir zu einem transzendentalen Argumente unsere Zuflucht nehmen, welches aber hier eben hat vermieden werden sollen.“1
Kant postuliert in dieser Passage, dass der physikotheologische Beweis durch die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit der Welt bloß die Zufälligkeit der Form beweist. D.h. die Form kommt aus Gott, aber der Beweis kann nicht zeigen, dass die Materie der Welt von Gott kommt. Wenn man nicht beweisen kann, dass die Materie der Welt von Gott kommt, ist Gott nur der Architekt der Welt und somit der Materie der Welt unterworfen. Somit wird die Allgenugsamkeit Gottes stark eingeschränkt.2 Um zu beweisen, dass die Materie der Welt aus Gott kommt, „müßten wir zu einem transzendentalen Argument unsere Zuflucht nehmen“, doch leider ist das für den physikotheologischen Beweis a posteriori unmöglich. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass wir durch ein transzendentales Argument Gott als das ens realissimum bezeichnet haben. Deswegen besteht die Möglichkeit, dass die Materie der Welt aus Gott als ens realissimum kommt. Ich werde nun diese Hypothese beweisen.
In der Vorlesung über Rationaltheologie gibt es einen ähnlichen Paragraphen: „Dadurch verlieret Gott an seiner Majestät als Weltschöpfer nichts […] so ist auch diese Einrichtung in der Natur, nach welcher eine Anstalt nothwendig ist, aus seinem Wesen abzuleiten, aber nicht aus seinem Willen; denn sonst wäre er bloß Architekt der Welt, und nicht Weltschöpfer. Nur das Zufällige in den Dingen kann aus dem göttlichen Willen und aus willkürlichen Anordnungen desselben hergeleitet werden. Nun lieget aber alles Zufällige in der Form der Dinge; folglich kann man nur die Form der Dinge aus dem göttlichen Willen ableiten […] Denn die Materie, im welcher das Reale selbst lieget, leiten wir aus dem göttlichen Wesen her […] “3 Was Kant hier sagen möchte, ist, dass nur die Zufälligkeit oder die Form der Dinge aus dem göttlichen Willen und aus den willkürlichen Anordnungen desselben hergeleitet wird, die Materie jedoch aus dem göttlichen Wesen. Obwohl sich Kants Behauptung hier vom obigen Zitat unterscheidet, haben beide Zitate eine gemeinsame Bedeutung: Wenn Gott nur der Ursprung aller Formen der Dinge ist, kann er nur als Architekt der Welt betrachtet werden. Nur wenn er auch die Quelle der Materie der Welt ist, kann er als Schöpfer der Welt betrachtet werden, und die Form, die aus seinem Willen kommt, wird nicht durch die Materie eingeschränkt.
Daraus ergibt sich, dass sich Gott als ens realissimum oder ens originarium, das man durch die transzendentale Methode erkennt, auf die Materie der Welt bezieht. Im Gegensatz dazu bedeutet Gott als der göttliche Wille oder die höchste Intelligenz, die durch Analogie bestimmt wird, die Quelle der Form der Welt. Im Folgenden möchte ich dazu folgende Fragen stellen: (1) Was für eine Materie ist die hier genannte? (2) Warum ist Gott das Substratum der Materie? (3) Was bedeutet die Form der Welt?
(1) Zuerst möchte ich zeigen, dass Gott als ens realissimum eng mit der Materie verbunden ist. Wir haben in Abschnitt 1.2 den Ableitungsprozess des entis realissimi rekonstruiert. In diesem Prozess weist Kant auf das Folgende hin: „wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle mögliche Prädikate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders, als die Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahren Verneinungen sind alsdann nichts als Schranken, welches sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht das unbeschränkte (das All) zum Grunde läge“4. Kant glaubt, dass dieses transzendentale Substratum „den ganzen Vorrat des Stoffes“ enthält. Daraus können wir erkennen, dass das Substratum eine enge Beziehung zum Stoff hat. Tatsächlich ist der Begriff der Materie im gesamten Prozess der Argumentation der zentrale Kern: z. B. enthält das Prinzip der durchgängigen Bestimmung „eine transzendentale Voraussetzung, nämlich die der Materie zu aller Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll“5. Deshalb gilt z. B. für das ens realissimum: „also ist es ein transzendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung, die nothwendig bei allem, was existiert, angetroffen wird, zum Grunde liegt und die oberste und vollständige materiale Bedingung seiner Möglichkeit ausmacht.“6 An dieser Stelle ist nun zu fragen, was hier die Materie bedeutet.
Wie bereits ausgeführt wurde, behandelt Kant in der Ersten Analogie. Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz der KrV die Kategorie der Substanz-Akzidenz mit Hilfe der Zeit als Substratum des Wechsels, welches eine Analogie zur Beziehung zwischen Substanz und Akzidenz ist.7 Was die Substanz hier angeht, haben viele Forscher festgestellt, dass sie die Materie ist. Der Absatz, aus dem die Forscher ableiten, dass die Substanz als Materie verstanden werden muss, lautet: „Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert.“8 Carl Friedrich von Weizsäcker verbindet diesen Absatz mit Kants Naturuntersuchung.9 Für diese Verbindung hat Weizsäcker viele Argumente: in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft definiert Kant z. B. das Erste Gesetz der Mechanik wie folgt: „Bei allen Veränderungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität der Materie im Ganzen dieselbe, unvermehrt und unvermindert.“10 Dazu erklärt Kant: „nun entsteht und vergeht bei allem Wechsel der Materie die Substanz niemals; also wird auch die Quantität der Materie dadurch weder vermehrt, noch vermindert, sondern bleibt immer dieselbe und zwar im Ganzen“. 11 Gleichzeitig weist Kant im Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen darauf hin: „in allen natürlichen Veränderungen der Welt wird die Summe des Positiven […] weder vermehrt noch vermindert.“12 Diese Absätze geben uns einen Schlüssel, um die Bedeutung der Materie in Kants Metaphysik und Naturforschung zu verstehen.13
Wenn wir feststellen, dass in den oben genannten beiden Zitaten „die Quantität der Materie“ und „die Summe des Positiven“ dieselbe Bedeutung haben, dann können wir daraus ableiten, dass das Positive mit der Materie gleichzusetzen ist. Also bedeutet die Materie das Positive (Realität) und so entspricht bei Kant die Materie metaphysisch der Summe der Realität. Nun prüfen wir dieses Argument in Verbindung mit Kants Naturforschung und seinem metaphysischen Denken in der vorkritischen Zeit.
In der Naturgeschichte veröffentlicht Kant seinen physikotheologischen Beweis von der Existenz Gottes: „Die Materie, die der Urstoff aller Dinge ist, ist also an gewisse Gesetze gebunden, welchen sie frei überlassen nothwendig schöne Verbindungen hervorbringen muß. Sie hat keine Freiheit von diesem Plane der Vollkommenheit abzuweichen. Da sie also sich einer höchst weisen Absicht unterworfen befindet, so muß sie nothwendig in solche übereinstimmende Verhältnisse durch eine über sie herrschende erste Ursache versetzt worden sein, und es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch selbst im Chaos nicht anders als regelmäßig und ordentlich verfahren kann.“14 In Kapitel 7 des 2. Abschnittes betont Kant gleichzeitig: „allein die Grundmaterie selber, deren Eigenschaften und Kräfte allen Veränderungen zum Grunde liegen, ist eine unmittelbare Folge des göttlichen Daseins: selbige muß also auf einmal so reich, so vollständig sein, daß die Entwicklung ihrer Zusammensetzungen in dem Abflusse der Ewigkeit sich über einen Plan ausbreiten könne, der alles in sich schließt, was sein kann, der kein Maß annimmt, kurz, der unendlich ist.“15 Gemäß diesen beiden Zitaten kommen wir zum Schluss, dass die Materie der Welt unendlich ist, dass sie sich weder vermehrt noch vermindert. Natürlich entspricht die Materie in der Naturforschung dem Begriff der metaphysischen Materie nicht direkt. Zum Verständnis von Kants metaphysischem Materiebegriff können wir auf die nova dilucidatio verweisen. In PROP. VII der nova dilucidatio wird das Sein Gottes dargestellt. Dieser Beweis ist in zwei Schritte unterteilt: (1) Kant schließt vom Stoff für alle möglichen Begriffe auf das absolut notwendige Wesen und (2) von dem absolut notwendigen Wesen auf das unendliche und einzige Wesen.16 Der Stoff der möglichen Begriffe ist Realität. In PROP. X der nova dilucidatio schlägt Kant vor: „Quantitas realitatis absolutae in mundo naturaliter non mutatur, nec augescendo nec decrescendo.“17 Das bedeutet, dass Gott als Inbegriff aller Realitäten notwendig alle Realitäten enthält. Der Beweis vom Sein Gottes a posteriori in der Naturgeschichte und der Beweis a priori in der nova dilucidatio sind formal unterschiedlich, aber am Ende beweisen sie beide, dass Gott ein ausreichender Grund für die Unendlichkeit und Vielfältigkeit der Dinge sein kann. Aus diesem Grund glauben einige Forscher, dass die beiden Arbeiten grundsätzlich konsistent sind.18 In Bezug auf die Forschungsfrage dieser Dissertation wird daraus abgeleitet, dass die Materie in Kants Naturforschung mit der Realität im metaphysischen Denken verglichen werden kann, oder dass Kants Materie aus metaphysischer Sicht Realität ist und die Realität mit der Möglichkeit der Dinge gleichzusetzen ist.19 Mit anderen Worten, unabhängig davon, wie sich die Form der Dinge ändert, ändert sich die Summe der Möglichkeiten oder Realitäten hinter den Dingen nicht. Wie Kant selbst gesagt hat: „auch wurde in Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie aller Möglichkeit, Einschränkung derselben aber (Negation) als diejenige Form angesehen.“20 Hier ist der Begriff der „unbegrenzten Realität“ dem Inbegriff der Realitäten, der Summe des Positiven gleich, ebenso wie der Quantität der Materie in der Naturforschung, die als Materie aller Möglichkeiten betrachtet wird.
Daraus folgt, dass die Materie der Summe der Möglichkeit oder der Realität entspricht. Jetzt können wir festhalten, dass Gott, wenn er als ens realissimum betrachtet wird, das Substratum für die Materie der Welt ist, und zwar in dem Sinn, dass der Inbegriff der Materie die Summe der Realität bedeutet.
(2) Des Weiteren kann jetzt die Frage beantwortet werden, warum Gott das Substratum der Materie ist. Die Antwort ist einfach: Weil Gott als das ens realissimum betrachtet wird, das doch in Relation zu „dem Inbegriff aller möglichen Prädikate“ steht. Genauer gesagt, ist die Materie der Welt der Inbegriff aller möglichen Prädikate. Aus diesem Grund ist es plausibel, dass Gott mit der Materie der Welt zu tun hat. Dieser Zusammenhang muss noch ausführlicher interpretiert werden.
An dieser Stelle halten wir fest, dass die Materie der Summe (dem Inbegriff) der Realitäten entspricht. Ich habe den folgenden Absatz oben zitiert: „Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle mögliche Prädikate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders, als die Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahren Verneinungen sind alsdann nichts als Schranken, welches sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht das unbeschränkte (das All) zum Grunde läge.“21 Hier sehen wir, dass das ens realissimum als Substratum eine Überlagerung aller Realitäten zu sein scheint, so dass andere Dinge als Beschränkungen an diesem Substratum betrachtet werden können. Daher scheint die Beziehung zwischen diesem Substratum und anderen endlichen Dingen die Beziehung zwischen dem Ganzen und dem Teil zu sein. Diese Bedeutung ist am deutlichsten, wenn Kant sagt: „alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist nur eine eben so vielfältige Art, den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, einzuschränken, so wie alle Figuren nur als verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, möglich sind.“22 Aber ist die Beziehung zwischen allen Dingen und Gott als Substratum wirklich der Beziehung zwischen allen Figuren und dem unendlichen Raum ähnlich?
In Abschnitt 1.2 haben wir darauf hingewiesen, dass das ens realissimum als omnitudo realitatis nicht dem Inbegriff aller möglichen Prädikate gleich ist, weil jenes die abgeleiteten und nicht nebeneinanderstehenden Prädikate ausschließt. Obwohl Kant zu glauben scheint, dass die Beziehung zwischen allen Dingen und Gott eine zwischen dem Teil und dem Ganzen ist, korrigiert er bald seine Meinung: „Die Ableitung aller anderen Möglichkeit von diesem Urwesen wird daher, genau zu reden, auch nicht als eine Einschränkung seiner höchsten Realität und gleichsam als eine Theilung derselben angesehen werden können; denn alsdann würde das Urwesen als ein bloßes Aggregat von abgeleiteten Wesen angesehen werden. […] Vielmehr würde der Möglichkeit aller Dinge die höchste Realität als ein Grund und nicht als Inbegriff zum Grunde liegen und die Mannigfaltigkeit der ersteren nicht auf der Einschränkung des Urwesens selbst, sondern seiner vollständigen Folge beruhen.“23 Daher ist die Beziehung zwischen Gott und allen Dingen die zwischen dem Grund und der Folge und nicht die zwischen dem Ganzen und dem Teil. Das ens realissimum als Ideal nennt Kant auch Prototypon transzendentale, wie die Überschrift dieses Abschnitts zeigt. Kants Erklärung dafür lautet: „das Ideal ist ihr also das Urbild (Prototypon) aller Dinge, welche insgesamt als mangelhafte Copeien (ectypa) den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen.“24 Dieser von Platon entlehnte Begriff drückt die Beziehung zwischen allen Dingen und Gott besser aus: alle Dinge haben an der Realität des entis realissimi teil, und die Materie der Möglichkeit aller Dinge leitet sich vom transzendentalen Ideal ab, gewinnt ihre Realität davon und wird als Folge daraus betrachtet.
(3) Oben haben wir gesehen, dass Gott als das ens realissmum das Substratum der Materie der Welt ist. Zudem drückt Kant die Meinung aus, dass Gott auch als Substratum der Form der Welt betrachtet werden kann, jedoch aus einer anderen Perspektive: Gott ist die höchste Intelligenz. Am Anfang von Abschnitt 1.1 haben wir schon einen Absatz aus der KrV wie folgt zitiert: „Ist endlich drittens die Frage, ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Analogie mit den Gegenständen der Erfahrung denken dürfen: so ist die Antwort: allerdings, aber nur als Gegenstand in der Idee und nicht in der Realität, nämlich nur so fern er ein uns unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche sich die Vernunft zum regulativen Princip ihrer Naturforschung machen muß.“25 In dieser Passage sagt Kant deutlich, dass die Idee Gottes „ein uns unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist“. Die systematische Einheit der Welt ist gerade die Form der Welt.
An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass es für Kant zwei verschiedene Formen der Dinge gibt: die Form des Individuums und die Form als Beziehung zwischen Individuen. Wir haben die folgende Passage zitiert: „auch wurde in Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie aller Möglichkeit, Einschränkung derselben aber (Negation) als diejenige Form angesehen.“26 Diese Form ist Einschränkung der umgrenzten Realität, oder ist die Form des Individuums.27 Doch was hier mit der Form hinsichtlich der weltlichen Einheit gemeint ist, das ist nicht die Form des Individuums. Was im Zentrum steht, ist die Form zwischen Individuen, nämlich die systematische Einheit der Welt, die die Beziehung zwischen Individuen bezeichnet. Um dies besser zu verstehen, lohnt sich ein erneuter Blick in die nova dilucidatio. Neben dem ontotheologischen Beweis in PROP. VII bietet Kant noch einen anderen in PROP. XIII an, in dem das Principium coexsistentiae diskutiert wird: „Substantiae finitae per solam ipsarum exsistentiam nullis se relationibus respiciunt, nulloque plane commercio continentur, nisi quatenus a communi exsistentiae suae principio, divino nempe intellectu, mutuis respectibus conformatae sustinentur.“28 Folglich nimmt Kant an, dass nur durch die göttliche Intelligenz (divino intellectu) die wechselseitigen Beziehungen zwischen den endlichen Substanzen entstehen. Diese Tatsache führt Kant zu einem Plädoyer für das Dasein Gottes: „Cum ergo, quatenus substantiarum singulae independentem ab aliis habent exsistentiam, nexui earum mutuo locus non sit, in finita vero utique non cadat, substantiarum aliarum causas esse, nihilo tamen minus omnia in universo mutuo nexu colligata reperiantur, relationem hanc a communione causae, nempe Deo, exsistentium generali principio, pendere confitendum est.“29 Denn die Gemeinschaft aller Substanzen setzt voraus, dass Gott als die höchste Intelligenz existiert. Doch in der KrV bestimmt Kant die Beziehung zwischen den Substanzen als systematische Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit, die Gott als die höchste Intelligenz (wenigstens als die Idee der höchsten Intelligenz) voraussetzt, nämlich dass Gott als die höchste Intelligenz auch das Substratum der systematischen Einheit der Welt ist.
In Abschnitt 1.4 haben wir versucht, die transzendentalen und aposteriorischen Methoden in eine Einheit zu bringen. Anhand der vorkritischen Schriften und der kantischen Naturforschung haben wir aufgezeigt, dass die Ideen von Gott als das ens realissimum und von Gott als höchste Intelligenz miteinander verbunden sind. Beide bezeichnen Gott als Substratum, doch Gott als das ens realissimum ist transzendentales Substratum im Sinn der Materie der Welt, und Gott als die höchste Intelligenz funktioniert als das Substratum der Form, nämlich der systematischen Einheit der Welt. Deswegen ist in der kantischen Philosophie Gott das Substratum für die Materie und für die Form der Welt.