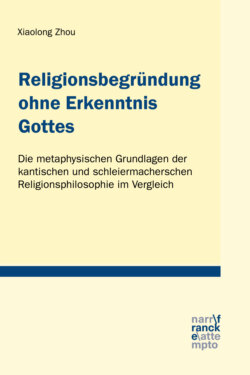Читать книгу Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes - Xiaolong Zhou - Страница 8
0.3 Ziel und Kapiteleinteilung
ОглавлениеDas Ziel dieser Untersuchung besteht darin, die metaphysischen Grundlagen der kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophien zu verdeutlichen und auf dieser Grundlage einen Vergleich durchzuführen. Meines Erachtens müssen diese Grundlagen in der Gotteslehre gesucht werden: Die Möglichkeit, Gott zu erkennen, die Art, wie man ihn erkennt, der Zugang zu Gott, müssen eine zentrale Rolle spielen. Ohne ihre Gotteslehre zu untersuchen und ohne auf diese Grundlage einzugehen, erscheint der Vergleich zwischen Kant und Schleiermacher nur oberflächlich. Damit verbunden ist ein weiteres Ziel dieser Untersuchung, nämlich die Missverständnisse über ihre Gotteslehre zu widerlegen. In den Forschungen über Kants Moraltheologie fehlt es immer an einer Untersuchung über seine transzendentale Theologie. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Kant nur den aposteriorischen Beweis thematisiert, ohne eine Verbindung zwischen dem transzendentalen Ideal und der Moraltheologie vorzunehmen. Die Missverständnisse über Schleiermachers Religionstheorie sind vielfältig. Das berühmteste davon ist der Vorwurf, seine Religionstheorie sei nur subjektiv und mystisch. Dieses Missverständnis ist bis heute populär in der Heimat des Verfassers dieser Dissertation, in China. Nach diesem Missverständnis scheint Schleiermachers Religionsphilosophie der Religionstheorie von William James zu ähneln. Diese Untersuchung wird beweisen, dass die Suche nach Gott das wichtigste Ziel von Schleiermachers Religionsphilosophie ist. Außerdem möchte ich die Frage diskutieren, ob es möglich ist, eine Religion zu begründen, ohne Gott zu erkennen.
Im ersten Teil stelle ich die Gotteslehre Kants dar. In diesem Teil wird die Bedeutung der apriorischen Theologie bzw. der Lehre vom transzendentalen Ideal hervorgehoben, die m.E. die Grundlage der kantischen Religionsphilosophie bildet. Außerdem wird die apriorische Theologie mit den aposteriorischen Theologien (dem symbolischen Anthropomorphismus und der Moraltheologie) in Zusammenhang gebracht. In diesem Teil versuche ich zu erklären, wie Kant die Gotteslehre innerhalb der Vernunft darstellt und wie Gott für ihn ein notwendiger Gegenstand der Vernunft ist. In diesem Teil werden in Kapitel 1 zwei verschiedene Weisen, Gott zu denken, thematisiert. Die apriorischen Eigenschaften Gottes sollen durch die Vernunft a priori begriffen werden, während Verstand und Wille nur aposteriorisch, nämlich durch das Verhältnis Gottes zur Zweckmäßigkeit der Welt, Gott zugeschrieben werden. Kapitel 2 zeigt auf, dass die Existenz Gottes nicht dadurch gesichert wird, dass die Methode apriorisch oder aposteriorisch ist. Aufgrund dessen werde ich in Kapitel 3 weiter diskutieren, warum die Moral die Existenz Gottes notwendig postuliert. In diesem Kapitel werden die Ähnlichkeit und der Zusammenhang zwischen der Moraltheologie und dem symbolischen Anthropomorphismus ins Zentrum gestellt.
Die Aufgabe des zweiten Teils ist die Erörterung der Gotteslehre Schleiermachers. Die Unerkennbarkeit Gottes ist der Leitfaden dieses Teils. Hier möchte ich klarmachen, dass sich diese Art der Unerkennbarkeit Gottes von der kantischen Unerkennbarkeit unterscheidet. Kurz gesagt, verneint Kant die Denkbarkeit Gottes nicht, während Schleiermacher sie vollständig ablehnt. Außerdem wird in diesem Teil auf die Frage eingegangen, ob die radikale Unerkennbarkeit Gottes in der Religionsbegründung Schleiermachers überhaupt möglich ist. Ausgehend davon untersucht Kapitel 4 die Gotteslehre seiner frühen Zeit, in der Kant und Spinoza einen großen Einfluss auf ihn hatten. Die Spinozaschrift und die Reden sollen als Ausbruch aus der kantischen Gotteslehre anhand der spinozianischen Philosophie betrachtet werden. Um die metaphysische Grundlage für diese radikale Unerkennbarkeit Gottes herauszufinden, interpretiert Kapitel 5 die Erkenntnistheorie in der Dialektik, wo Schleiermacher die Grenze der Erkenntnis deutlich in den Vordergrund stellt. Auf dieser Grundlage kritisiert er alle Formeln der Idee Gottes bzw. des transzendentalen Grundes. Damit wird die Denkbarkeit Gottes durch die Vernunft vollständig abgelehnt. Kapitel 6 beantwortet die Frage, ob sich ein Widerspruch zur radikalen Unerkennbarkeit Gottes in der Darstellung des religiösen Gefühls verbirgt. Das Kapitel weist darauf hin, dass nur in der zweiten Auflage der Glaubenslehre ein vorausgesetztes Wissen über Gott vermieden wird.
Einen grundlegenden Vergleich nehme ich im dritten Teil vor. Durch die Beschränkung der Erkenntnis auf die Erfahrung wird Gott ein Problem für den Verstand. Gott wird in die Welt der Noumena verschoben. Schleiermacher nimmt diese Tradition auf. Deshalb bildet die Unerkennbarkeit Gottes eine gemeinsame Voraussetzung oder die Grundlage für Kant und Schleiermacher. Obwohl die Unerkennbarkeit Gottes eine zentrale Herausforderung für beide Philosophen ist, haben sie je ihre eigenen Weisen erarbeitet, Gott zu denken. Meines Erachtens möchte Kant die Aporie über Gott innerhalb der Grenze der Vernunft lösen, indem er das allerrealste Wesen (das ens realissimum) durch das Prinzip der durchgängigen Bestimmung aus der Vernunft entwickelt. Im Unterschied dazu betrachtet Schleiermacher Gott als Dasein außerhalb unserer Vernunft, jedoch mit der Überlegung, dass Gott immer tätig und handelnd in der Welt ist. Wir werden entdecken, dass die jeweiligen Betrachtungsweisen ihre eigenen Schwierigkeiten in sich bergen. Was Kant betrifft, liegt die Aporie seiner Theorie darin, dass die Existenz Gottes nicht direkt aus dem Begriff vom enti realissmo abgeleitet werden kann. Damit soll die Idee eines lebendigen Gottes nur auf aposteriorische Weise ergänzt werden. Im Gegensatz dazu ist die Existenz Gottes für Schleiermacher unmittelbar durch das religiöse Bewusstsein gesichert. Außerdem ist der lebendige Gott eine Voraussetzung für Schleiermachers Religionstheorie. Jedoch liegt im Ausschluss eines vorausgehenden Wissens um Gott ein innerer Widerspruch: Ohne über Gott theoretisch nachzudenken, wäre es unmöglich zu bestimmen, ob das im schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühl mitgesetzte X Gott ist. Um ihre aposteriorischen Erkenntnisse Gottes zu vergleichen, gebe ich der Moraltheologie Kants und der Religionstheorie Schleiermachers jeweils den Namen Moral-Physikotheologie und Bewusstseins-Kosmotheologie. Daraus ergibt sich, dass Kant den Verstand und den Willen Gottes für symbolisch und aus der Zweckmäßigkeit der Welt abgeleitet hält, während Schleiermacher alle Eigenschaften Gottes durch die Wirkung Gottes auf das religiöse Bewusstsein erkennen möchte, wobei die Zweckmäßigkeit der Welt keine Rolle spielt.
Aufgrund dieser Auslegungen kommt diese Untersuchung zum Schluss, dass die apriorischen und aposteriorischen Erkenntnisse Gottes untrennbar sein müssen. Darin liegt der Grund, warum m.E. die kantische Theorie logisch konsequenter als die Religionsphilosophie Schleiermachers ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gottesbezogenheit für Schleiermachers Darlegungen über das religiöse Gemüt notwendig ist. Damit erscheint der Vorwurf der „Subjektivität“ als wenig stichhaltig.