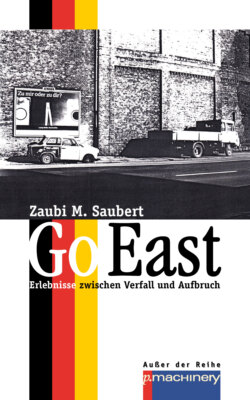Читать книгу GO EAST - Zaubi M. Saubert - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwei
ОглавлениеAm 1. Juli 1990 kehrte ich nach Halle zurück. Seit diesem Tag galt die D-Mark in der DDR als offizielles Zahlungsmittel. Es war ein heißer Sonntag und man spürte die Spannung, die über allem lag, wie ein Sirren in der Luft. An einem solch heißen Sonntag im Juli wären die Dörfer und Städte normalerweise wie ausgestorben gewesen. Die Menschen hätten sich auf ihre Datsche zurückgezogen oder würden sich zumindest in irgendeinem Freibad oder an einem See erholen. Heute verhielt sich das anders. Die Sparkassen hatten Sonderöffnungen eingerichtet und gaben das neue Geld an die aufgeregt wartenden Massen aus. Bereits in den Ortschaften auf dem Weg nach Halle hatte ich vereinzelt Menschenschlangen vor den Banken in der Mittagsglut ausharren gesehen. In Halle selbst kam es mir total wuselig vor, alles schien auf den Beinen zu sein.
Zurück in Anitas Wohnung in HaNeu, wie Halle-Neustadt umgangssprachlich hieß, berichteten mir Anita und Rolf davon, dass letzte Nacht in ganz Halle eine riesige Party stattgefunden hatte. Überall wurde bis tief in die Nacht der Abschied von der Ostmark, den »Aluchips«, gefeiert.
Nachmittags machten wir dann einen Spaziergang durch Halle-Neustadt und kamen dabei auch an »unserer« Kaufhalle vorbei. Auch hier war einiges los. Die Leute waren entweder auf dem Weg zur Bank oder kamen gerade von dort mit dem neuen Geld zurück, blieben an den Schaufenstern der Kaufhalle stehen und guckten in den geschlossenen Markt. Warum schaut man in einen geschlossenen Supermarkt, fragte ich mich, und ging nun selbst hin. Beim Hinsehen erschloss sich mir der Grund. Da, wo letzte Woche noch die leeren Regale standen, hatte man nun die neuen Westprodukte eingeräumt. Doch heute am Sonntag hatte die Kaufhalle geschlossen und es gab nichts zu kaufen, nur zu gucken.
Voller Begeisterung drückten sich die Leute die Nasen an den Scheiben platt und machten sich gegenseitig aufmerksam auf die schönen Dinge, die sie durch die Scheibe erkennen konnten.
»Ah, gucke nur, soo viel Coca Cola.«
»Boah, da ist ein ganzes Regal voll Nutella.«
»Da, der gute Westkaffee.«
Rolf und ich fanden die Situation kurios, weil wir so etwas nie erlebt hatten. Was sollte daran Besonderes sein, in einen geschlossenen Supermarkt zu gucken. Aber Anita sah das anders und fühlte sich und ihre Landsleute auf den Arm genommen.
Später in der Stadt stießen wir wieder auf die fliegenden Händler am Hansering. Dort herrschte absolut Hochkonjunktur, denn hier konnte man gleich etwas für die neue D-Mark kaufen. Die begehrte Halbliterdose Holsten war ruckzuck ausverkauft. Aber egal, dann nahmen die Leute eben einen Würstcheneintopf oder ein paar Tütensuppen, Hauptsache, man konnte Westwaren für Westgeld kaufen. Alles ging weg. An einer dieser Buden trafen wir auf Werner, den Cousin meines Freundes Frank aus Hannover. Der weilte schon seit Mai hier in Halle und betrieb einen solchen Pavillon. Gerade lud er etliche Paletten Dosenbier aus einem alten Lieferwagen und trug sie in den Verkaufsstand. Wir begrüßten uns und quatschen kurz miteinander. Er hatte zu tun, was nicht zu übersehen war, meinte aber, dass er abends noch bei Anita vorbeikäme und dann mehr Zeit hätte.
Abends kam Werner dann tatsächlich und erzählte von seinen Geschäften. Den Pavillon hatte er in Hildesheim billig gebraucht erstanden. Nun verkaufte er hier, mit inzwischen drei Angestellten, jeden Tag Bier, Konserven und Kaffee. Zu durchaus zivilen Preisen und immer schon nur gegen »Westmark«.
»Die reißen dir das Zeug nur so aus den Händen. Du hast die Paletten kaum aus dem Wagen gebuckelt, da sind sie schon weg. Das ist total irre«, schwärmte er.
Jeden zweiten Tag fuhr er zurück über die Grenze in den Westen, um neue Ware anzukarren.
»Du verdienst dich dumm und dusselig.« Als Beleg holte er ein dickes Bündel Geldscheine aus der Jacke und hielt sie hoch.
»Hier, alles von heute.« Ja, verrückt. Es herrschte Goldgräberstimmung.
»Darauf trinken wir erst mal einen«, stellte Rolf fest und schenkte allen einen ordentlichen Braunen ein.
An diesem Abend wurde es nicht nur wieder spät, sondern auch eng in der kleinen Zweiraumwohnung. Anita ließ erwartungsgemäß keinen von uns in die freie Hälfte ihres Ehebettes, Werner blieb auch über Nacht und Horst war inzwischen ebenfalls eingetrudelt. So suchte sich jeder eine Ecke im Wohnzimmer und breitete seine Luftmatratze aus. Bis auf Rolf, der hatte sich als Stammgast längst eine eigene Matratze mitgebracht und diese ständig in der Wohnung liegen.
Als ich Montagfrüh in die Kaufhalle kam, um Brötchen zu holen, wurde das gleich richtig spannend. Es herrschte dort bereits ziemliche Betriebsamkeit trotz des regulierten Zugangs. Ich hatte Glück und brauchte nicht lange auf einen Einkaufswagen zu warten. Im Laden standen die Menschen vor den Regalen, drehten staunend irgendwelche Marmeladengläser in der Hand, verharrten völlig überfordert vor dem Regal mit den vielen verschiedenen Kaffeesorten oder debattierten heftig mit der Nachbarin darüber, welche Sorte Bonduelle man nun kaufen sollte.
»Nu gucke nur, diese Vielfalt. Da gibt es Erbsen fein und hier sogar extrafein.«
»Nee, das gloob ich jetzt nich.«
Mütter versuchten ihre Kinder daran zu hindern, gleich das ganze Süßigkeitenregal in den Einkaufswagen zu stürzen. Die zugangsregulierenden Einkaufswagen standen kreuz und quer und versperrten die Gänge.
Ein Durchkommen bis nach hinten zum Backwarenstand glich einem Hindernislauf. Nachdem ich meine Brötchen gegriffen hatte, wollte ich zügig zurück zur Kasse. Gleich, als ich mich mit der Brötchentüte umdrehte, lief ich beinah in zwei schwergewichtige Damen hinein, die hinter mir fassungslos auf die Brotpreise oben auf der Tafel starrten. Wie sollte man auch begreifen, dass sich der Preis für das gleiche Brot von Samstag auf Montag um ein Vielfaches erhöht hatte. Auch vor dem Spirituosenregal entdeckte ich zwei staunende Männer mit einer Flasche Goldbrand in der Hand, die einfach nicht fassen konnten, dass der Preis für ihren heiß geliebten DDR-Weinbrand praktisch über Nacht explodiert war.
»Wieso isn der jetzt so teuer?«
»Na, das ist die Westmark.«
»Ja, aber auch für unseren Goldbrand?«
An der Kasse stellte ich fest, dass meine Brötchen fast das Gleiche kosteten wie bei meinem Bäcker in Hannover.
Die nächsten Tage in Halle verbrachte ich damit, etwas an meiner Karriere zu basteln. Ich gab bei der Mitteldeutschen Zeitung eine Anzeige auf, in der ich Mitarbeiter suchte. »Kontaktfreudige Menschen für abwechslungsreiche Tätigkeit bei überdurchschnittlichem Verdienst gesucht« oder so ähnlich. Am Montag, den 9. Juli, wollten Frau Gehrke und ich im Hotel Rotes Ross den ersten Informationsabend in Halle veranstalten.
An einem Nachmittag fuhr ich noch mal zu den Bekannten nach Leipzig. Walter zeigte sich zwar skeptisch, aber auch interessiert, zumal sich abzeichnete, dass es sein Industriekombinat wahrscheinlich nicht mehr lange geben würde. Er sagte zu, in einer Woche zu der Veranstaltung nach Halle zu kommen und auch noch einen Kollegen mitzubringen. Na, den Anfang hatte ich gemacht. Am Mittwoch ging es wieder zurück nach Hannover. Es begann die Zeit des Pendelns. Die halbe Woche in Halle und die andere Hälfte in Hannover. Das hieß, viel Zeit im Auto zu verbringen. Für die etwa zweihundertvierzig Kilometer zwischen Halle und Hannover brauchte ich in der Regel etwa drei bis vier Stunden, meist aber auch länger, da sich die Fahrt über die Landstraße zwischen Magdeburg und Halle ganz schön in die Länge zog und es immer wieder Baustellen und Umleitungen gab.
Am nächsten Sonntag war ich dann schon wieder »drüben«. Und zwar diesmal in Aschersleben, wo ich um elf Uhr vormittags mit meiner Chefin im Braunen Hirsch verabredet war. Sie hatte hier bereits erste Mitarbeiterkontakte anberaumt. Aschersleben entpuppte sich endgültig als staubige, graue Provinz, und der Braune Hirsch passte dort wunderbar rein. Grauer Hirsch hätte als Name noch besser gepasst. Frau Gehrke meinte, ich müsste mir unbedingt ihr Zimmer ansehen, denn der Hirsch vermietete auch Zimmer. Über eine schmale, abenteuerliche Stiege ging es steil nach oben zu einer verwinkelten kleinen Dachkammer. Mehrmals musste ich aufpassen, mir nicht den Kopf zu stoßen. Abenteuerlich, aber gemütlich.
Montag, am Tag darauf, trafen wir uns wieder. Um achtzehn Uhr zum ersten Informationsabend im Hotel Rotes Ross in Halle. Horst war auch mit von der Partie. Ganz stolz packte ich meine neueste technische Errungenschaft aus, einen Overheadprojektor. Da mir die kleinen mobilen Reiseprojektoren viel zu teuer waren, hatte ich mir ein ganz normales Standgerät gekauft, wie man es auch in der Schule benutzte. Das bedeutete zwar immer etwas Schlepperei, diesen vom Auto in den Schulungsraum zu tragen und wieder zurück, aber was half es? Hauptsache ein richtiger Projektor. Denn keine Schulung ohne Folien, die man schön groß und anschaulich an die Wand werfen konnte. Und wunderbar schreiben ließ sich darauf auch.
Ich war schon den ganzen Tag richtig aufgeregt. Ob wohl auch Leute auf meine Anzeige kommen würden? Und wenn ja, wie viele? Die Spannung stieg beim Warten. Als Erstes erblickte ich Walter im Türrahmen, der tatsächlich noch einen Kollegen mitgebracht hatte. Und sie blieben nicht die Einzigen, die kamen. Insgesamt erschienen etwa fünfzehn Männer und Frauen. Jetzt erst recht etwas aufgeregt begrüßte ich die Anwesenden und leitete dann zu Frau Gehrke über, die souverän die Firmenvorstellung der OVB übernahm und die Tätigkeit des Finanzkaufmanns vorstellte.
Dadurch, dass Frau Gehrke nicht mehr ganz so jung war, kam sie etwas gesetzter und seriöser rüber, was mir besser gefiel, als manch einer dieser geleckten Bossanzugträger, die in der Branche sonst häufig vorkamen. Sie dagegen strahlte Seriosität aus, blieb auf dem Teppich und konnte trotzdem begeistern. Die Zuhörer machten einen interessierten Eindruck und es gab natürlich viele Fragen, auch eine Menge skeptische. Diese kamen besonders von den beiden Leipzigern. Am Ende waren wir alle mit der Veranstaltung zufrieden, die eigentlich zwei Stunden dauern sollte und dann doch drei Stunden währte. Hinterher saß ich noch eine Weile mit Frau Gehrke und Horst zusammen, bevor sie abends wieder zurück nach Hannover fuhr und wir nach HaNeu in die Zweiraumwohnung. Am kommenden Samstag sollte es dann mit einem ersten, ganztägigen Seminar als Einstieg für die Interessierten richtig losgehen. Da stellte sich natürlich die Frage, wie viele von den heute Anwesenden dann kommen würden.
Wegen eines Termins musste ich in der kommenden Woche noch kurz nach Hannover. Inzwischen kannte ich die Strecke schon ganz gut, doch auf der Rückfahrt erlebte ich etwas Besonderes. In Bernburg bog ich hinter dem Ortseingang wieder rechts um die Kurve und rollte dann nichts ahnend auf der brutalen Holperpiste hinunter auf den Bahnübergang zu, dessen Schranken wie immer geschlossen waren. Plötzlich sah ich, wie ein paar Wagen vor mir, an einem Transporter die Türen aufflogen, etwa ein halbes Dutzend Männer in Kampfanzügen und mit Maschinenpistolen im Anschlag aus dem Wagen sprangen und sich auf der Straße verteilten.
Was war das? Krieg, Überfall oder was? Erschrocken schaute ich mich um und überlegte, was zu tun war. Etwas weiter vorne entdeckte ich einen merkwürdigen grün-weiß lackierten LKW. Er sah wie ein Gefangenentransporter aus, nur mit winzigen Fenstern. Davor und dahinter befand sich je ein Polizeiwagen. Die bewaffneten Männer standen inzwischen um diesen LKW, die Waffen im Anschlag.
Kurz darauf gingen die Schranken wieder hoch, die Männer verschwanden wieder in dem Transporter und der Spuk endete so plötzlich, wie er begonnen hatte. Inzwischen dämmerte mir, was da vor sich ging. Vor mir befand sich ein Geldtransport der besonderen Art. Hier wurde gerade frisches Westgeld in den Osten gefahren. Und so, wie der LKW gesichert war, hatte der bestimmt einiges an Barem geladen. In der Zeitung stand, dass für die Währungsumstellung insgesamt fünfundzwanzig Milliarden Westmark in den Osten gekarrt wurden. Sechstausend Tonnen Geldscheine und etwa fünfhundert Tonnen Münzen. Das musste man sich mal vorstellen. Das konnte man sich kaum vorstellen. Und da, vor mir an dem Bahnübergang, waren sicher gerade ein paar Millionen davon unterwegs.
Trotz des schönen neuen Geldes gab es vieles vor Ort noch gar nicht, weil die Geschäfte noch die alten waren und oft noch gar keine oder nur wenige Westwaren auf Lager hatten. Da standen eben immer noch die alten RFT-Fernseher im Schaufenster. Und so einen wollte halt keiner mehr, auch wenn die inzwischen natürlich auch in Farbe ausstrahlten. Genauso wie diese klobigen Stereokompaktanlagen. Da musste jetzt einfach ein richtiger Gettoblaster her. So verwunderte es dann nicht, dass man abends im Fernsehen Berichte darüber sehen konnte, wie im sogenannten ehemaligen Zonenrandgebiet im Westen alles leer gekauft wurde. Wie die Heuschrecken fielen dort die angehenden Neubundesbürger in die Läden ein und räumten ruckzuck den Laden förmlich leer.
Die Schnellsten, die vor Ort im Osten ankamen, waren die Gebrauchtwagenhändler. Eine leere Fläche, die flugs provisorisch eingezäunt wurde, fand sich schnell und schon konnte ein schwunghafter Gebrauchtwagenhandel beginnen. Trabi und Wartburg waren über Nacht out. Jetzt musste ein Westwagen her. Am besten gleich, koste es, was es wolle. Dass bei der Nachfrage der ersten Wochen alles in den Osten gekarrt wurde, was noch vier Räder hatte und wo der Motor ansprang, verwunderte eigentlich nicht. Genossen Gebrauchtwagenhändler im Westen schon nicht den besten Ruf, so wurde hier mancher Wagen für viel zu viel teure Westmark losgeschlagen, der ursprünglich kaum noch oder gar nicht mehr verkäuflich war. Einmal durch die Waschstraße, eine Motorwäsche, etwas Cockpitspray und ein Duftbaum, schon ließ sich mit einem abgewrackten 3er BMW noch richtig Geld machen.
Aber sicher, wenn man früher über zehn Jahre auf einen Trabant warten musste und nun all die schönen Westwagen zu haben waren, konnte es vielen gar nicht schnell genug gehen, ihren einst so heiß geliebten und gepflegten »Schorsch«, wie der Trabi oft liebevoll genannt wurde, loszuwerden. Sehr bald schon wurde es ein gewohntes Bild, einen alten Trabi abgewrackt am Straßenrand oder irgendwo in der Natur zu finden. Was sich als noch brauchbar erwies, hatte man demontiert, dann ließen sich noch ein paar Halbstarke an ihm aus und zurück blieb ein Wrack, welches die Kommunen gar nicht in der Lage waren, zu entsorgen.
Eines Tages wies mich Rolf auf eine große Anzeige in der Mitteldeutschen Zeitung hin:
»Beate Uhse kommt nach Halle!«
Das wollte ich mir natürlich unbedingt ansehen. Als ich zu dem angekündigten Termin auf dem Markt eintraf, sah ich ihn sofort. Ein großer Sattelschlepper, knallig bunt, mit riesigem Beate Uhse Schriftzug, stand dort, mitten auf dem Platz. Nee, das ist nicht wahr, dachte ich, aber es war so. Drum herum herrschte eine Menge Betrieb und je näher ich dem Laster kam, desto voller wurde es. Neugierig drängelten sich die Menschen um den Sattelschlepper, der hier wie ein UFO aus einer anderen Welt wirkte.
Ich konnte kaum glauben, was ich sah. Die Mitarbeiter des Erotikunternehmens machten sich gar nicht die Mühe, einen großen Verkaufsstand aufzubauen, sondern verkauften direkt von der Laderampe des Sattelschleppers. Da wurden paketweise Pornos, Videos, Schachteln mit Dildos in verschiedenen Farben und Größen, Negligés und noch einiges mehr, für wenig Geld, unter das staunende Volk gebracht. Es erinnerte mich ein wenig an die bekannten Marktschreier, »alles für zehn D-Mark.«
Das war für die Ossis natürlich wieder etwas total Neues. Beate Uhse. Hatte man höchstens mal im Westfernsehen gesehen. Und jetzt konnte man all diese exotischen Sachen hier, direkt auf dem Markt in Halle, kaufen. Ich fand es lustig anzuschauen, wie die Leute mit großen Augen auf die angebotenen Sexartikel starrten und nicht lange zögerten, sich für einen Zehner auch so ein kleines eingeschweißtes Päckchen zu sichern. Neben mir beobachtete ich zwei junge Frauen, die jede eine Schachtel mit einem bunten Dildo erstanden hatten und jetzt kichernd und verstohlen ihre »Beute« betrachteten. Männer hielten staunend Pakete in den Händen und blickten mit großen Augen auf die nackten Tatsachen unter der durchsichtigen Plastikfolie. Auch ein paar Schulkinder standen neugierig kichernd herum.
Noch spannender als ein LKW voller Pornos war ein anderes Phänomen der damaligen Zeit: der Hütchenspieler. Den hatte ich vorher noch nicht live erlebt. Als ich über den Boulevard, wie die hallesche Fußgängerzone genannt wurde, schlenderte, fiel mir eine kleine Gruppe Menschen auf, die in einem Halbrund zusammenstand. Dies machte mich neugierig und so wollte ich gucken, was die denn da so machten. Ich trat näher heran und sah einen Karton, der offensichtlich die Aufmerksamkeit der Herumstehenden auf sich zog.
Auf dem Pappkarton entdeckte ich drei kleine Pappschachteln, Schubfächer von Streichholzschachteln, und dahinter einen Mann, der diese Schachteln geschickt hin und her schob und den Zuschauern dabei gleich das Spiel erklärte.
»Hier ist die rote Kugel. Achten Sie auf die rote Kugel. Wo ist die rote Kugel?«
Spannend, wie er die Zuschauer in seinen Bann zog. Das war sozusagen die Proberunde. Nachdem die rote Kugel unter der mittleren Schachtel zum Vorschein gekommen war, heftete ich meine Augen an die Schachtel und verfolgte ihre Bewegungen bei dem nächsten Spiel.
»Wo ist die rote Kugel?«, wollte der »Spielleiter« schließlich wissen. Die befand sich unter der linken Schachtel, dessen war ich mir sicher. Die Hand lüftete eine Schachtel und siehe da, es war die linke und die rote Kugel befand sich tatsächlich darunter. Gar nicht so schwer.
Nun ging es ans Eingemachte. Wer spielt mit? Einsatz war ein Hundertmarkschein. Seit Kurzem besaß man die ja überhaupt erst, diese hübschen Geldscheine und mit etwas Glück konnte man aus einem Schein zwei machen. Schnell ließ sich der Erste der Umstehenden überzeugen, zückte einen dieser begehrten Scheine und reichte ihn an den Assistenten des Spielleiters weiter. Die Stimmung stieg und alle starrten nun auf die drei kleinen Pappschachteln, die kurz darauf flink über den Kartondeckel bewegt wurden. Im Geiste verfolgten zig Augenpaare die Schachteln und in den dazu gehörenden Köpfen arbeitete es gewaltig. Dann nahm der Spielleiter die Hand weg und die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt: Unter welcher Schachtel lag die kleine rote Kugel? Der Mann tippte auf die rechte.
Bingo, er hatte tatsächlich Glück. Und vor den staunenden Blicken der Umstehenden erhielt er nicht nur seinen Hundertmarkschein zurück, sondern noch einen Zweiten. Damit hatte sich auch gleich die Frage geklärt, wer in der nächsten Runde mitspielen wollte, denn sofort zückten mehrere der umstehenden Herren ebenfalls einen Geldschein. Zugegeben, die Verlockung war groß. Hatte ich doch eben beim Trockentraining auch auf die richtige Schachtel gesetzt. Und wo konnte man so schnell aus hundert Mark zweihundert machen?
Doch wie hatte meine Oma früher immer gesagt: »Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.« Also Finger weg. Und ich sollte recht behalten. Der nächste Spieler lag daneben, tippte auf die falsche Schachtel und sah seinen Schein nicht wieder, auch der folgende schenkte den schönen Schein her. Missmut und Gemurmel setzten ein. Die Verlierer trollten sich schlecht gelaunt. Was würden sie zu Hause erzählen? Eben waren sie mit hundert Mark aus der Wohnung weggegangen und nun, ohne dass sie etwas gekauft hatten, kehrten sie ohne den Schein zurück. Es sah doch so einfach aus und es hätte doch so schön sein können. Hätte!
Das Publikum an dem kleinen Pappkarton wechselte. Frustrierte Verlierer schlichen von dannen, andere blieben wiederum neugierig stehen. Ich hielt mich unbeteiligt am Rand, als der Spuk urplötzlich endete. Das kleine Spielcasino verschwand. Zurück blieb ein einsamer alter Pappkarton. Lange sah man das Spiel nicht in der Fußgängerzone. Irgendwann waren sie verschwunden, die illegalen Hütchenspieler. Denn die Polizei saß ihnen im Nacken.
Es war schon eine verrückte Zeit in jenem Sommer. Tagsüber waren Horst und ich ziemlich rührig im Job unterwegs. Im Lauf des Abends trudelten wir dann wieder in der Zweiraumwohnung von Anita ein. Entweder saß Rolf dann mit einem Bier vor der Glotze und es wehte ein leichter Marihuanageruch durch die Wohnung oder wir fanden einen Zettel vor, auf dem er uns mitteilte, wo heute was los wäre. Meist trafen wir uns dann noch in einem der Studentenklubs.
Der Turm war mir irgendwann zu abgedreht. Sich immer vorher »auf die Liste« setzen zu lassen, damit man auch hineingelassen wurde, hatte etwas von den Nobeldiscos im Westen. Daher bevorzugte ich bald die Gosenschenke, kurz Gose genannt. Ein Studentenklub im sozialistischen Deutschland, wo die Mutter in der Küche für das leibliche Wohl sorgte, während Vater hinterm Tresen stand, der Sohn den Einlass machte und meist auch die Musik auflegte. Ein richtiger Familienbetrieb in einem alten Haus, mit viel Atmosphäre.
Oder Horst und ich gingen in den Bauernklub an der Reilstraße. Der wartete mit einer anderen Kuriosität auf. Der Zugang erfolgte dort durch eine Metallgittertür in einer hohen Mauer, die nur zur halben und vollen Stunde geöffnet wurde. Das hieß nicht nur, dass man warten musste, um eingelassen zu werden, nein, man musste genauso warten, wenn man wieder hinaus wollte. Zu DDR-Zeiten war der Bürger das Anstehen gewohnt und so fand, außer den Wessis, niemand diese Regelung verwunderlich.
Oft kehrten wir erst spät am Abend aus den Klubs zurück nach HaNeu, nahmen dort in der Zweiraumwohnung noch einen Absacker und fielen dann in die Betten beziehungsweise auf die Luftmatratzen. Es herrschte Partytime. Morgens konnten wir ausschlafen, da vormittags in der Regel noch keine Kundentermine anstanden. Bei dem heißen Wetter, das in diesem Sommer herrschte, fuhren wir sogar manchmal mittags noch zum Abkühlen an die Regattastrecke der halleschen Ruderer, die ganz in der Nähe lag und wo man prima schwimmen konnte. Oder an einen der Steinbrüche etwas außerhalb von Halle, bevor wir uns dann an die Arbeit machten und oft erst nach zweiundzwanzig Uhr wieder zurückkamen.
Eines Morgens hatte ich mir bei Anita eine Wanne eingelassen. Während das Wasser einlief, hatte ich das Badezimmer verlassen und mich schon einmal ausgezogen. Als ich wenig später ins Bad zurückkehrte, traute ich meinen Augen nicht. Die Wanne war weitestgehend voll. Voll mit trübem Wasser, in einem knalligen rostorangen Farbton. Was bedeutete das? Noch dazu handelte es sich um kaltes Wasser. Dann baden wir halt nicht, entschied ich. Denn in diese Brühe wollte ich mich nun wirklich nicht setzen und schon gar nicht in kaltes Wasser.
Des Rätsels Lösung bestand darin, dass jedes Jahr im Juli das warme Wasser in HaNeu für zwei Wochen abgestellt wurde, um das Leitungsnetz zu reinigen. Offenbar vertrat die Wasserwirtschaft die Meinung, dass man im Sommer ruhig mal zwei Wochen ohne warmes Wasser auskommen konnte. Und bei der Färbung handelte es sich schließlich nur um Eisenoxid, landläufig auch Rost genannt und letztlich nicht schädlich. Trotz alledem versuchte ich, mir in diesen Tagen, auch das Duschen möglichst zu verkneifen. So ist das nun mal in »fremden« Ländern, sagte ich mir.
In diesem so turbulenten Sommer fand zu allem Überfluss auch noch die Fußballweltmeisterschaft statt. Diesmal in Italien und die noch westdeutsche Mannschaft gehörte zu den Favoriten. Je weiter die WM voranschritt, desto leerer wurden die Straßen während der »deutschen« Spiele. Und da es in den Plattenbauten im Sommer besonders warm war, hatten alle die Fenster offen und so hörte man bei jedem deutschen Tor ein vielstimmiges Geschrei von allen Seiten. Als ich am Tag des Finals nach Hause kam, nahm ich gleich im Treppenhaus einen appetitlichen Geruch wahr. Ente? Aus unserer Wohnung? Ich schloss die Tür auf und sofort schlug mir eine warme, wohlriechende Wolke entgegen. Da Anita in Hannover weilte, traf ich lediglich Horst in der Küche an, der mir strahlend mitteilte, dass er uns zur Feier des Tages eine Ente in den Ofen geschoben hätte.
Gegen eine knusprige Ente hatte ich im Prinzip nichts einzuwenden. Aber mitten im Juli, bei dreißig Grad im Schatten, in einem ohnehin schon knackig warmen Plattenbau? Keine Ahnung, woher die Ente stammte. Weil es dazugehörte, wurde der Vogel natürlich standesgemäß mit Klößen und Rotkohl angerichtet. Tja, warum nicht? Wenn schon, denn schon. Heftig schwitzend haben wir das Tier später mit Genuss verdrückt. Um die Hitze halbwegs im Rahmen zu halten, bemühten wir uns um reichliche Kühlung mittels kalten Biers. So hatten wir auf alle Fälle eine gute Grundlage für das Finale.
Als Andi Brehme in der fünfundachtzigsten Minute den Elfmeter zum einzigen, alles entscheidenden Tor verwandelte und Deutschland damit zum Fußballweltmeister machte, gab es in Halle kein Halten mehr. Die zukünftigen »Ostneuwestdeutschen« waren nicht mehr zu bremsen. Horst und ich waren dagegen erst mal ziemlich geschafft: Die Hitze, der gebratene Vogel, auch noch mit den Klößen, das Bier und der Braune dazu, forderten ihren Preis. Wir mussten raus, an die Luft, in die Stadt. Dort feierte ganz Halle bis spät in die Nacht und wir mittendrin. Eine gute Grundlage hatten wir ja.
Bei unserem Kneipenbummel hielt Horst plötzlich grinsend eine volle Flasche Braunen hoch. Die hatte er wohl im Vorbeigehen, in einer Kneipe, mitgehen lassen. Damit waren wir natürlich überall gern gesehen. In der Erinnerung hört die Party irgendwann im halleschen Hauptbahnhof auf. Da wir uns am nächsten Tag in unseren Betten wiederfanden, ohne Verluste oder offene Wunden, sind wir irgendwann, irgendwie, wieder zurück nach HaNeu gekommen.
Eine überbordende Ausgelassenheit war symptomatisch für diese turbulente Zeit, als die D-Mark die Ostmark ablöste, die DDR in den letzten Zuckungen lag und sich so vieles über Nacht völlig änderte. Mahnende Stimmen waren da nicht angesagt, stattdessen hörte man überall nur von den blühenden Landschaften, die sich auftun würden, und dass es niemandem schlechter gehen würde als bisher.
Doch wie es nach einer ausschweifenden Feier oft der Fall ist, ließ der Kater nicht lange auf sich warten. In den Kneipen kostete das Bier seit der Einführung der D-Mark plötzlich nicht mehr neunzig Pfennige, sondern das Dreifache. Essen gehen wurde über Nacht fast unerschwinglich. War der Besitz von Westmark früher ein Schatz und ein Privileg, so musste man nun mit diesem Schatz eine banale Tasse Kaffee im Café oder einen Sack Kartoffeln in der Kaufhalle bezahlen. Es gab ja nur noch diese eine Währung. Und da die Subventionen für Grundnahrungsmittel, die es in der DDR gegeben hatte, wegfielen, kostete ein Sack Kartoffeln nun auf einmal fünf D-Mark.
So blieb der erwartete Kaufrausch zumindest in Teilen aus. Und was gekauft wurde, musste unbedingt aus dem Westen sein. Zum einen überschwemmten Westwaren das Land, und zum anderen wollte niemand mehr für die kostbare Westmark ein Ostprodukt kaufen. Das sollte der Anfang vom Untergang ostdeutscher Produkte und Betriebe sein, die praktisch über Nacht nicht mehr konkurrenzfähig waren. Dass diese Entwicklung den Zusammenbruch vieler Unternehmen und Betriebe mit sich brachte, stellte die tragische, aber logische Konsequenz dar.