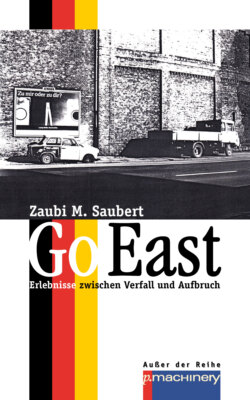Читать книгу GO EAST - Zaubi M. Saubert - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eins
ОглавлениеEs war ein schöner Tag im Juni. Die Sonne schien heiß aus blauem Himmel, während wir auf der Landstraße durch goldgelbe Getreidefelder fuhren. Aus den Lautsprechern begleiteten uns Campino und die Toten Hosen mit »Azzurro«. Wir waren bester Laune, total aufgeregt und gespannt auf das, was uns wohl erwarten würde.
Das erste Stück der Fahrt war noch ganz normal verlaufen. Wie oft hatte ich die A2 Richtung Berlin schon befahren? Aber spätestens seit Helmstedt hatte sich alles geändert. Musste man sich früher an der sogenannten innerdeutschen Grenze anstellen, sich von den stechenden Blicken der Grenzer durchbohren lassen und versuchen, bloß nicht aufzufallen, wurden wir jetzt einfach durchgewunken und befanden uns in der DDR. Und zwar richtig in der DDR, nicht nur auf der Transitautobahn nach West-Berlin.
In Magdeburg verließen wir die Autobahn und folgten den nur noch schwer leserlichen, ehemals gelben Schildern Richtung Halle. Es ging vorbei an einer dieser Plattenbausiedlungen, wie man sie aus dem Fernsehen kannte. Das Bild, das sich beim Blick aus dem Autofenster bot, hatte sich völlig gewandelt. Die Straße war deutlich schlechter geworden. Überall Schlaglöcher und Unebenheiten. Mein knallroter VW-Passat plötzlich umgeben von grauen Wartburgs und Trabis. Die Häuser und Dörfer entlang des Weges sahen auch anders aus, als ich es kannte, und hatten mehr als nur einen neuen Anstrich nötig. Wir passierten kleine graue Ortschaften, von deren Namen wir noch nie gehört hatten.
»Eh cool, Zaubi«, meinte Horst vom Beifahrersitz, wies mit der Hand nach vorne und zündete sich eine neue Zigarette an.
»Ja, total spannend«, erwiderte ich.
»Und vielleicht fahren wir hier in einem Jahr in nem dicken Benz lang und ziehen erst mal eine schöne Line durch«, spann Horst vor sich hin.
Bei Horst handelte es sich um meinen Neffen, oder, wie er immer sagte, mein Schwippschwager. Der Sohn der Schwester meiner Freundin Sylvie. Mit seinen gerade mal zwanzig Jahren ein kleines, etwas pickliges Großmaul. Groß gewachsen und dürr. »Eh cool« gehörte zu seinen beliebtesten Redewendungen. Wir beide befanden uns auf dem Weg nach Halle an der Saale.
Zwischen den Obstbäumen am Straßenrand machten wir ein verrostetes Ortsschild aus. Bernburg. Der Straßenbelag wechselte auf eine gewölbte, alte Kopfsteinpflasterdecke. Hinter einer Rechtskurve ging es steil bergab auf einen geschlossenen Bahnübergang zu. Die Straße hatte sich in eine gepflasterte Buckelpiste verwandelt. Mir fliegt sicher gleich ein Reifen oder mindestens der Auspuff weg, ging es mir durch den Kopf, während wir uns rumpelnd dem Übergang näherten.
Zum Glück waren die Schranken geschlossen, denn ansonsten hätte man sich bei dem Versuch, den Bahnübergang in normaler Geschwindigkeit zu überqueren, wahrscheinlich die Achse gebrochen. So aber holperten wir im Schritttempo über die Gleise, nachdem sich die Schranken wieder geöffnet hatten, und wurden dabei nur ordentlich durchgeschüttelt. Mein Gott, was für eine Piste, dachte ich. Anschließend wurde die Straße wieder etwas besser.
Bernburg war die erste DDR-Stadt, durch die wir fuhren. An Magdeburg waren wir ja nur vorbeigekommen. In Bernburg ging es nun einmal mittendurch. Hier war alles anders, als ich es sonst kannte. Trotz des blauen Himmels und dem Sonnenschein wirkte alles grau. Die Fassaden, die Dächer, die Autos, eigentlich alles. Sogar die vereinzelten Menschen, die ich auf der Straße sah. Und es bröckelte. Überall bröckelte es. Von den maroden Dächern, den löchrigen Fassaden.
Bald hatten wir Bernburg hinter uns gelassen und rollten Halle entgegen. Einladend sah Halle nicht aus, als wir es dann vor uns liegen sahen. Am Straßenrand stand auf einmal ein großes, natürlich graues Betonteil mit zwei Sternen und einem liegenden Halbmond. Unwissend, wie ich damals noch war, brachte ich die Sterne erst mal mit den Sowjetsternen in Verbindung. Das behielt ich glücklicherweise für mich. In Wirklichkeit handelte es sich um einen geöffneten roten Halbmond zwischen zwei roten Sternen auf weißem Grund. Das hallesche Stadtwappen, das eine stilisierte Siedepfanne und Salzkristalle darstellt. Halle die Salzstadt.
Jetzt bemerkten wir erst mal eine leicht bräunlich-graue, diesige Glocke über der Stadt. Im leichten Schlingerkurs fuhren wir über Kopfsteinpflaster und Straßenbahngleise in die Stadt hinein und erreichten wenig später einen riesigen Kreisverkehr, den Thälmann-Platz, damals der größte Kreisverkehr der DDR. Fünf breite Straßen führten von dort in alle Richtungen, die Straßenbahnen hatten in der Mitte des Platzes ihre Haltestellen, überspannt wurde das Ganze zusätzlich von einer Hochstraße, umgeben von wuchtigen Plattenbauten. Ein futuristisches Ensemble. Ich sollte bald Leute kennenlernen, die diesen riesigen Kreisverkehr prinzipiell aus Angst mieden und lieber große Umwege in Kauf nahmen, nur um mit dem Auto nicht darüber fahren zu müssen.
Wir fanden den Abzweig nach Halle-Neustadt, überquerten auf der aufgeständerten Magistrale kurz darauf die Saale und erblickten die große Plattenbauvorstadt, die damals über neunzigtausend Einwohner zählte. Jetzt rechts abbiegen und dann sollte auch schon gleich der Flugzeugrumpf einer ausrangierten Iljuschin aus der Grünanlage auftauchen. Danach an der Kreuzung links abgebogen und wir hätten unser Ziel erreicht. So zumindest hatte Anita uns den Weg beschrieben.
Die alte Iljuschin konnten wir schwer übersehen, und so bogen wir an der bezeichneten Kreuzung links ab. Jetzt mussten wir gleich da sein. Block 337/Haus 1, lautete unser Ziel. Straßennamen gab es hier keine, denn hier hatte man alles durchnummeriert. Aha, wir entdeckten Block 324. Na, dann konnte es ja nicht mehr weit sein. Als dann Block 253 folgte, wurden wir stutzig. Wie geht denn das zusammen? Bald schwante mir, dass man der Nummerierung nicht unbedingt mit unserer Westlogik beikommen konnte. Noch dazu befanden wir uns ja auch nicht in einer gewachsenen Stadt, denn die Gründung von Halle-Neustadt ging auf einen Beschluss des ZK der SED aus dem Jahr 1963 zurück. Hier sollten die Arbeiter der großen Chemiestandorte Leuna und Buna untergebracht werden.
Nachdem wir eine Weile planlos zwischen den Plattenbauten herumgekurvt waren und zunehmend die Orientierung verloren, traten wir den Rückweg an. Noch mal zurück zu der Kreuzung, von der aus wir die Irrfahrt begonnen hatten.
»He, Zaubi, da vorne geht rechts noch eine Straße ab«, stellte Horst fest und schon bogen wir in diese ein. Wir hatten Glück und entdeckten gleich am ersten Hauseingang das Kürzel 337/1. Bingo, angekommen. Wir suchten uns zwischen den Trabis, Wartburgs, Ladas sowie einigen uns unbekannten Fahrzeugtypen einen Parkplatz und stiegen aus.
Sah alles so ganz anders aus hier als bei uns im Westen, dachte ich, und streckte mich nach der langen Fahrt erst einmal ordentlich aus. Renntenntenn tenntenntenn. Knatternd fuhr ein Trabi an uns vorbei, eine leicht bläuliche Rauchfahne hinter sich herziehend. Und es roch hier auch anders. Das war schon echt aufregend. Während mein Blick noch über die leicht schmuddelige Plattenbaufassade glitt, entdeckte ich im Erdgeschoss jemanden. Es war Anita, die am Fenster stand und ganz aufgeregt winkte.
Wir suchten noch nach der Klingel, als sie bereits die Haustür aufriss, mir jubelnd um den Hals fiel und mich mit ihrem unnachahmlichen halleschen Dialekt begrüßte.
»Nu Meener, seit ihr endlich do.«
Im Hintergrund tauchte nun auch mein Freund Rolf auf, der lebte zurzeit bei Anita.
»Willkommen im Osten«, meinte er breit grinsend mit einem Bier in der Hand. Ich stellte Horst kurz vor und wenig später saßen wir vier, aufgeregt plaudernd, im Wohnzimmer von Anitas Zweiraumwohnung.
Anita kannte ich eigentlich nur über drei Ecken. Freunde von mir hatten sie im Sommerurlaub in Ungarn am Balaton kennengelernt. Nachdem die Grenze geöffnet wurde, kam sie im letzten Winter nach Hannover zu Besuch. Dort traf ich sie das erste Mal. Anita war eine Lustige, mit langen, dunkelblonden Locken. Sie konnte schnell, ohne Punkt und Komma plappern und hatte eine ansteckende, auffällige Lache. Nachdem sich Horst und ich erst mal ein kaltes Bier nach der langen Fahrt gegönnt hatten, stellte Rolf nun die Flasche Braunen, den allgegenwärtigen DDR-Weinbrand, wie wir noch lernen sollten, auf den Tisch. Anita konterte mit einer Flasche Pfeffie, dem in der DDR so beliebten Pfefferminzlikör. Der sah schon so giftig grün aus, dass ich gleich abwinkte. Die Nacht wurde lang und feucht-fröhlich. Irgendwann pumpten Horst und ich mit letzter Kraft unsere Luftmatratzen im Wohnzimmer auf und krochen in unsere Schlafsäcke.
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück als Erstes zum Einkaufen in die Kaufhalle. Das wurde richtig aufregend und fing bereits am Eingang mit dem Namen an, Kaufhalle und nicht Supermarkt. Drinnen ging es weiter, dort hing nämlich ein großes Schild, das unmissverständlich verkündete: »Kein Rundgang ohne Korb!« Da konnte man nicht wie bei uns, so mir nix dir nix eben mal rein, Brötchen holen und sich damit an der Kasse anstellen. Nein, man stellte sich erst mal vor der Kasse an und wartete, bis dort, nach dem Bezahlen eines Kunden, sein Einkaufswagen frei wurde. Mit diesem durfte man dann den sozialistischen Konsumtempel betreten. So regelte die Anzahl der Einkaufswagen den Zugang zum Markt. Was es alles gab. Horst und ich waren baff.
Drinnen ging es spannend weiter, denn dort sah es so anders aus, keine bekannten Produkte, alles nüchtern und schlicht verpackt. Farbe fehlte. Die Wurst am Fleischwarenstand wirkte ein bisschen so grau wie alles andere hier auch. Selbst das Gemüse war zwar grün, wirkte aber irgendwie gerupft und unterernährt. Ein langes Trassenband sperrte die halbe Kaufhalle ab. Erst als Rolf mich darauf hinwies, dass doch hier im Osten bald die D-Mark eingeführt würde, erklärte sich mir der Sachverhalt. Hier entstand bereits Platz für die neuen Westwaren, die in Kürze in den Regalen stehen sollten.
Im Anschluss an unseren ersten Kaufhallenbesuch fuhren wir mit unseren beiden Gastgebern ins Zentrum zur Stadtbesichtigung. Irgendwie sah alles anders aus, fast wie in einem anderen Land, obwohl die Leute deutsch sprachen und man natürlich auch alles lesen konnte. Der Sozialismus zeigte sich, nicht nur in roten plakativen Spruchbändern, allgegenwärtig. Wir kamen an einem hübschen baumbestandenen Boulevard vorbei, dem Hansering, dessen Ende vom sogenannten Fahnenmonument bekrönt wurde, wie uns Anita aufklärte. Dabei handelte es sich um eine riesige, etwa zwanzig Meter hohe Betonskulptur, in Form einer wehenden Fahne, natürlich einer roten.
»Die hat was mit den Russen zu tun«, versuchte Anita uns deren Sinn zu erklären. Genauer gesagt wurde sie 1967, zum 50. Jahrestag und Gedenken an die Oktoberrevolution, als »Flamme der Revolution« errichtet, wie ich später erfuhr. Im Volksmund hieß sie nur die Fahne.
Im krassen Gegensatz zu diesem Relikt des Kommunismus standen in direkter Nähe etliche achteckige Bierbuden unter den Bäumen, wie man sie im Westen von Volksfesten kannte. Hier wirkten sie etwas zweckentfremdet. Zwar gab es auch tatsächlich Bier, aber weniger zum geselligen Sofortverzehr frisch gezapft, sondern eher zum Mitnehmen in der Dose. Dies waren die ersten Kioske mit Westware. Staunend registrierte ich, dass hier Holsten Bier in 0,5-Liter-Dosen, einzeln oder gleich als ganze Palette, verkauft wurde. Für Westmark natürlich. Ich glaube für eine Mark fünfzig die Dose. Obendrein gab es noch guten Westkaffee und Konserven: Eintöpfe, Würstchen, Bonduelle-Gemüsekonserven und was der Discounter im Westen noch an Dosen hergab. Unter der roten Fahne herrschte emsiges geschäftliches Treiben und insbesondere das Holsten war heiß begehrt. Holsten – weil’s knallt am dollsten, ging es mir durch den Kopf.
Zum Mittagessen führte uns Rolf ins Restaurant des Hotels Rotes Ross, eines der ersten Häuser am Platz, wie er berichtete. Die Preise waren für Westverhältnisse natürlich der Hammer. Da konnte man es sich für wenig Geld richtig gut gehen lassen. Schön mit weißem Tischtuch eingedeckte Tische, riesige weiße Stoffservietten und livrierte Kellner. Vorher hieß es aber erst einmal warten. »Sie werden platziert«, verkündete das Schild am Eingang. Aber Rolf war nach eigenen Angaben hier Stammgast und so ging es recht flott, bis wir an einem schönen Tisch saßen und staunend auf die Preise neben den ansprechend beschriebenen Gerichten der Speisekarte guckten.
»Eh cool, ist das billig«, entfuhr es Horst, worauf der Ober, der gerade die Getränkebestellung aufnehmen wollte, doch etwas betreten guckte. Gönnerhaft erzählte uns Rolf, dass er hier mittags häufiger essen würde. Und überhaupt ginge er oft zweimal täglich essen und dazu manchmal noch frühstücken. Na klar, wer hatte schon Lust, morgens noch selber Brötchen zu holen, wenn man sich für wenig Geld alles vorsetzen lassen konnte. Horst kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
Rolf war Messebauer und hatte sich Ende 1989 von seinem Arbeitgeber kündigen lassen, sozusagen eine Auszeit genommen, mit der Absprache, dass man ihn nach einem halben oder einem Jahr wieder einstellte. Und dann fuhr er im Januar 1990 zu Anita und anderen Bekannten nach Halle. Nicht nur, dass er durch seinen Job ein gutes Arbeitslosengeld hatte, von dem man in der untergehenden DDR exzellent leben konnte. Nein, man konnte damals ja auch noch schwarz Westmark gegen Ostmark tauschen, im Verhältnis eins zu sieben! Den Zwangsumtausch, den es früher für Besucher der DDR gab, hatte man mittlerweile abgeschafft und mit einem Portemonnaie voll »Spielgeld«, wie die DDR-Mark gerne abwertend genannt wurde, war man endgültig König und konnte es so richtig krachen lassen.
Und das tat er damals halt auch. Er ging immer in die besten Restaurants, abends dann in die Studentenklubs, wo er schnell einige hübsche Studentinnen um sich scharte und großzügig die ohnehin schon billigen Getränke orderte. Ein Leben in Saus und Braus, nach dem Motto »Was kostet die Welt?«. Für den Nachhauseweg fand sich dann meist noch ein Taxi, und wenn es sich nur um ein Schwarztaxi handelte, denn echte Taxis waren Mangelware. Als Schwarztaxi bezeichnete man einen Privatwagen, dessen Fahrer für Geld Personen beförderte, ohne dass er einen Taxischein besaß. Die Fahrzeuge waren selten Trabis, meist Ladas oder Wartburgs, weil die mehr Komfort boten. Man musste nur am Straßenrand den Autos zuwinken und mit etwas Glück hielt ein solches Schwarztaxi dann an. Über den Preis einigte man sich in der Regel.
Ich bemerkte, wie Horst bei der Schilderung von Rolfs Lebenswandel große Augen machte. Ja, das wollte er auch haben.
»Eh cool«, staunte er.
Hm, das sah wirklich alles ganz nett aus und war sicherlich ein schönes Abenteuer, was aber nicht ewig so weitergehen würde. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis die D-Mark am 1. Juli kam und mit ihr dann auch in Kürze die Wiedervereinigung. Und deswegen waren wir eigentlich hier, um die Lage zu sondieren, Eindrücke in Echtzeit zu sammeln, um dann in Halle den großen geschäftlichen Höhenflug zu starten.
Damals, Ende der Achtziger, studierte ich Architektur an der Uni in Hannover, hatte aber aus unterschiedlichen Gründen meine Lust und Motivation zu diesem Studium verloren. Dazu kam, dass man in dieser Zeit mit Architekten die Straßen pflastern konnte. Es war alles gebaut, die Altstädte entweder planiert und neu gebaut oder aufwendig saniert, die Landschaft mit gesichtslosen Einfamilienhausteppichen vollgestellt. Städte und Kommunen waren noch dazu weitgehend pleite. Da sahen die Berufsaussichten für Architekten, von denen jedes Jahr viel zu viele die Hochschulen verließen, eher düster aus. Woher also noch die Lust für das Studium nehmen?
Über meinen Freund Frank gelangte ich eines Tages, eher auf der Suche nach einem Nebenverdienst, zu einer Informationsveranstaltung eines großen deutschen Finanzdienstleisters, der OVB. Schick gestylte Herren in Maßanzügen und mit einer Rolex am Handgelenk erzählten mir, im Himmel wäre Jahrmarkt und man würde nur noch auf mich warten. Als Hauptredner trat ein gewisser Carsten Maschmeyer aufs Podest, der damals mit Ende zwanzig, gerade sein Medizinstudium an den Nagel gehängt hatte und sich stattdessen von seinen Provisionen bereits eine eigene Insel gönnte. Etwa zwei Stunden später schwebte ich, mit etwa zwanzig anderen Teilnehmern, einen halben Meter über dem Fußboden völlig benommen aus dem Saal. Wow, der Weg zu Geld, Karriere und Reichtum. Er war so einfach! Man musste es nur tun. »TuN – Tag und Nacht«, eine seiner Losungen zum Erfolg.
Das war vor etwa zweieinhalb Jahren gewesen. Das mit dem TuN sollte nicht so einfach sein wie gedacht, aber Schritt für Schritt kam ich vorwärts. In etlichen Schulungen und Seminaren hatte mich die OVB zum sogenannten Finanzkaufmann ausgebildet, eine nicht geschützte Berufsbezeichnung, hinter der sich letztlich der Vertrieb von Versicherungen, Bausparverträgen und diversen anderen Finanzprodukten verbarg. Seit anderthalb Jahren war ich sogenannter Geschäftsstellenleiter und dabei, mir in Hannover meine eigene Mitarbeiterstruktur, wie man so schön sagte, aufzubauen. Dazu gehörte seit Kurzem auch mein Neffe Horst, der hier im Verkauf die Chance sah, die er in seinem gelernten Beruf als Handelsfachpacker nicht besaß.
Meine Chefin, Dagmar Gehrke, war eine sehr freundliche, gewinnende Frau, die aber auch zu führen wusste, Anfang fünfzig, dunkelhaarig, gut aussehend und immer adrett gekleidet. Ich habe sie sehr geschätzt und viel von ihr gelernt. Sie hielt eigentlich zu Beginn nichts davon, im Osten etwas aufzubauen. Wir sollten doch erst einmal zusehen, dass wir in unserem eigenen Gebiet die Struktur ausbauen und festigen konnten. Aber gerade unter ihren Geschäftsstellenleitern scharrten fast alle mit den Hufen und wollten in den Osten. Und letztlich sollte es nur noch eine Frage von Tagen sein, bis die damals noch bestehenden Handelsschranken fallen würden. Und vor allem, wenn die D-Mark zum 1. Juli 1990 kam, dann gab es sowieso kein Halten mehr. So hatte ich beschlossen, dieses Wochenende einmal Ostluft zu schnuppern und die Bekannten in Halle zu besuchen. Dabei wollte ich natürlich auch schauen, wie denn die Chancen für einen beruflichen Einstieg in Halle standen. Horst war natürlich gern bereit, mich auf dieses kleine Abenteuer zu begleiten.
Nach dem Mittagessen im Roten Ross ließen wir uns von Rolf noch etwas mehr von Halle zeigen. Mein Gott sah das alles marode und grau aus. Es bröckelte an allen Ecken und Enden. Zu sagen, dass der Zahn der Zeit an dieser Stadt nagte, wäre untertrieben gewesen, der Zahn war eher dabei, sie Stück für Stück einzureißen. Die Luft tat ein Übriges. Das lag zum einen an den knatternden Trabis, Wartburgs, und wie sie alle hießen, die aus ihren Zweitaktmotoren dicke, stinkende, bläuliche Wolken hinter sich herzogen, und zum anderen lag es an der Braunkohle, deren Geruch fast allgegenwärtig war. Auch die Menschen sahen ein bisschen wie ihre Häuser aus. Die Kleidung, die Schuhe, die Gesichter. Alles in Grautönen.
Abends führte uns Rolf ins hallesche Nachtleben ein. Es ging in den »Turm«, Halles angesagtesten Studentenklub, gelegen in einem alten mächtigen Wehrturm der Moritzburg. Es handelte sich um eine Studentenkneipe mit Disco auf mehreren Ebenen. Während draußen Dutzende Leute darauf warteten, eingelassen zu werden, gingen wir gleich an der Schlange vorbei, nach vorne durch zum Einlass. Rolf wurde dort sofort nett begrüßt und erklärte, er hätte heute zwei Wessis mitgebracht, die zu Besuch seien, und schon waren wir, nach allseitigem freundlichem Hallo mit den Türstehern, drin.
»Wie funktioniert denn das jetzt? Du scheinst ja hier bestens bekannt zu sein«, wollte ich von Rolf wissen.
»Ja, na klar, der Maik ist ein Kumpel von mir«, erzählte er gönnerhaft, »der setzt mich immer auf die Liste und so lassen die mich am Eingang immer durch.«
»Hä?«
»Ja, naja, eigentlich musst du Türmer sein, also Klubmitglied oder zumindest einen Studentenausweis haben«, führte er aus.
»Sonst ist das schwer hier reinzukommen. Oder du hast einen Kumpel, der Mitglied ist und der kann immer noch einen mitbringen und dich für den Abend auf die Liste setzen.«
Beziehungen musste man also haben und auf der Liste stehen, so funktionierte das also. Fast genauso wie in den schicken Klubs im Westen, dachte ich.
Wie hatte es die legendäre Punkband »Peter and the Test Tube Babies« einmal treffend besungen: »Get me on the guest list.« Drinnen herrschte das gemütlich-rustikale Ambiente einer Studentenkneipe, mit alten Schildern an den Natursteinwänden, derbem Mobiliar, super Stimmung und billigen Getränken. Bei diesen Preisen konnte man großzügig mal einen ausgeben. Maik Klausen, der Türsteher, seine Freundin Manuela, Anita und etliche andere gesellten sich zu uns und wir verbrachten einen ausgelassenen Abend. Die Morgendämmerung hatte bereits eingesetzt, als wir mit einem Schwarztaxi die Heimfahrt nach Halle-Neustadt antraten.
Am Sonntag brachen Horst und ich nach dem Frühstück zu einem Abstecher nach Leipzig auf. Dort wollte ich Hildegard und Walter Eckstein besuchen. Walter war ein alter Schulfreund meines Vaters und die Freundschaft hatte all die Jahre überdauert. Wir rumpelten mit meinem Passat die vierzig Kilometer über die miserable Autobahn nach Leipzig. Im vergangenen November hatte ich die beiden, nach der Grenzöffnung, schon einmal zusammen mit meiner Freundin Sylvie besucht. Puh, damals erschien uns alles nur schrecklich trist, farblos und es roch noch viel schlimmer nach Braunkohle als dieses Mal. Ich wusste noch, wie wir in der Arthur-Hoffmann-Straße ihr Haus gesucht hatten. Walter hatte gesagt:
»Nu, das ist ganz einfach. Die Häuser auf der einen Seite sind rot und die auf der anderen Seite sind gelb. Die Siebzehn ist das zweite gelbe Haus.«
Ganz einfach. Sylvie und ich hatten die Arthur-Hoffmann-Straße in Leipzig damals in der Abenddämmerung eines extragrauen Novembertages, bei leichtem Nieselregen, erreicht. Ratlos schauten wir aus den heruntergekurbelten Seitenfenstern in die fahle, nebelverhangene Straße. Welches Haus war hier nun rot und welches gelb? Die Hausnummern konnten wir erst recht nicht in diesem Nebel erkennen. Also stieg ich aus und näherte mich dem ersten Haus. Für Gelb wirkte es eindeutig zu dunkel. Aber rot erschien es mir auch nicht. Letzten Endes hatten wir uns dann über die winzigen Hausnummern über den Hauseingängen an die gesuchte Nummer herangetastet. Und das Haus sollte gelb sein? Auch am nächsten Morgen, im kalten, grauen Tageslicht bedurfte es schon etwas Fantasie, um das Haus als gelb zu bezeichnen. Wobei auch hier der Unterschied zum Rot auf der anderen Straßenseite eher im Nuancenbereich anzusiedeln war. Na, egal.
Jetzt, ein Jahr später, kam ich wieder nach Leipzig und wir hatten immerhin Sommer, die Luft wirkte auf mich nicht ganz so schlecht und das Grau heller. Wir fanden die Adresse von Hildegard und Walter ohne Probleme und wurden auch schon sehnsüchtig erwartet. Westbesuch stand ins Haus, das war immer ein großes Ereignis in der DDR. Es gab jede Menge Kuchen, natürlich Jacobs Kaffee und dann
»‘nen kleinen Braunen? Oder lieber einen Wodka?«
Nee, nee, wiegelten wir ab, denn wir mussten an dem Tag noch nach Hannover zurückfahren. Hildegard und Walter waren so Mitte fünfzig, beide berufstätig und total gespannt, wie das nun weitergehen würde im Staate, mit dem Staate. Aber sie hatten auch ihre Zweifel: ob ihr Kombinat wohl bestehen bleiben würde, ob sie ihre Arbeit behielten und wie das mit dem Ersparten wäre. Das ging ihnen im Moment alles zu schnell. Als ich Walter erzählte, was ich hier im Osten plante, guckte er mich groß an. Erst recht als ich ihn fragte, ob er nicht bei mir mitarbeiten wolle. Ja, Interesse zeigte er schon, nur so recht vorstellen konnte er es sich nicht.
Wie auch? In der DDR kannte man nur die Sparkasse, da konnte der Bürger ein Sparbuch eröffnen oder vielleicht einen Kredit für die erste Schrankwand oder das Häuschen aufnehmen. Mehr gab es da nicht. Dann war da noch die staatliche Versicherung der DDR. Dort konnte man eine kleine Lebensversicherung abschließen, seinen Trabi oder die Pressplatteneinrichtung der Plattenbauwohnung versichern und noch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Mehr gab es auch da nicht. Walter wusste zwar, vor allem aus dem Westfernsehen, dass man sich im Westen gegen alles Mögliche versichern konnte und dass es bei unzähligen Banken unzählige Möglichkeiten gab, sein Geld anzulegen, aber das war hier im Osten noch Zukunftsmusik.
Am späten Sonntagnachmittag brachen wir von Leipzig aus, zur Heimfahrt nach Hannover auf. Ein total aufregendes Wochenende mit tausend und mehr Eindrücken ging zu Ende. Besonders auffallend: die Freundlichkeit, Offenheit und Herzlichkeit der Menschen. Das kannte ich so aus dem Westen kaum, denn da war cool sein angesagt und alle darauf bedacht diese Fassade immer schön hochzuhalten. Die Menschen, die ich hier im Osten kennengelernt hatte, kamen so ehrlich sie selber, so natürlich und menschlich rüber und damit erfrischend normal. Ganz anders als oft bei uns im Westen.
Am nächsten Tag, einem Montag, hatte ich ab zehn Uhr Bürodienst im Firmenbüro in der hannoverschen Bultstraße. Als meine Chefin später dazu kam, sollten meine Erlebnisse in Halle natürlich das Thema überhaupt sein. In den kommenden Tagen verflüchtigten sich ihre Vorbehalte gegen ein Engagement im Osten mehr und mehr. Der Zug war nicht mehr aufzuhalten. Meine Chefin blieb nicht untätig und knüpfte erste eigene Kontakte. Sie orientierte sich nach Magdeburg und Aschersleben, einen anderen Kollegen von uns zog es nach Greifswald. Es entwickelte sich eine richtige Aufbruchsstimmung. Man konnte die Spannung förmlich knistern hören. Die Tage in Hannover vergingen wie im Fluge. Ich hatte etliche Kundentermine und dann gab es noch Meetings im Büro.
Auch abends zu Hause sollte mein Besuch in Halle das große Thema sein. Meine Freundin Sylvie zeigte sich erst einmal etwas skeptisch, was mein mögliches Engagement im Osten anging, vor allem, weil ich oft weg sein würde und sie sich einen eventuellen Umzug nach Halle so gar nicht vorstellen konnte. Sie wusste aber auch, dass Halle eventuell meine große Chance sein konnte, und wollte sich da nicht quer stellen. Sylvie war damals fünfundzwanzig Jahre alt, hundertachtzig Zentimeter groß, sehr schlank mit karottenroten Haaren. Sie selber sagte immer etwas ironisch über sich: »Eine große Dürre wird kommen.«
Sie managte die Fitnessetage »Panorama 17« des Hotels am Stadtpark in Hannover, passenderweise im siebzehnten Stock. Ein Job mit toller Aussicht über die Dächer der Stadt. Wir waren seit sieben Jahren glücklich zusammen und teilten seit einigen Jahren eine erste gemeinsame Wohnung. Unser Leben war bislang nie ganz geradlinig verlaufen, doch das störte uns nicht. Und jetzt sollte für uns beide das spannendste Kapitel überhaupt folgen.