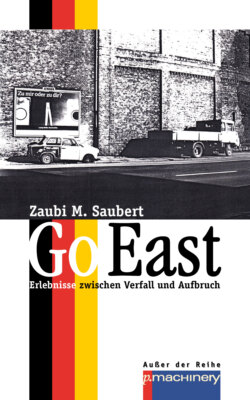Читать книгу GO EAST - Zaubi M. Saubert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drei
ОглавлениеFür mich endete nun die Zeit, wo ich jeden Abend noch Party machte, denn meine Tätigkeit hier in Halle forderte mich. Schnell hatte ich etwa ein halbes Dutzend Mitarbeiter, die regelmäßig zu den Schulungen erschienen und die wollten nicht nur ausgebildet, sondern auch letztlich mehr oder weniger an die Hand genommen werden. Denn für sie war ja alles neu, um was es bei der Tätigkeit als Finanzkaufmann ging. In der DDR hatte es bislang weder Bausparverträge noch Fondsanlagen gegeben, sondern nur ein Sparbuch mit fast null Zinsen, und auch das Versicherungsangebot hatte sich bekanntlich ebenfalls sehr übersichtlich dargestellt. Das änderte sich gerade grundlegend.
Für meine neuen Mitarbeiter ging es jedoch fürs Erste nur um ein gewisses Grundverständnis dessen, was an den Mann oder die Frau gebracht werden sollte, denn der Schwerpunkt lag auf dem Verkaufen. Aber auch das wollte gelernt sein. Bislang waren Begriffe wie Konkurrenz und Auswahl eher Fremdwörter gewesen. Wenn es etwas gab, dann oft nur in einer Ausführung und da stellte sich nur die Frage: Nehmen oder nicht nehmen? Und da es vieles gar nicht oder nur selten gab, stellte sich diese Frage eigentlich auch nicht. Der Bürger nahm, was er kriegen konnte. Zur Not konnte es ja noch gegen etwas anderes getauscht werden. Doch auch viele andere Dinge des täglichen Lebens waren für die angehenden Bundesbürger neu und unbekannt. Und so entwickelten sich die Schulungen auch immer etwas zur praktischen Hilfe im Alltag. Manches Mal musste ich dabei aufpassen, nicht völlig vom Thema abzukommen.
Bald zählte auch das nahe gelegene Leipzig zu meinem Schulungsgebiet. Von den Teilnehmern der Infoabende blieb meist nur ein Drittel übrig. Der Rest traute sich nicht oder hatte gleich erkannt, dass es nicht das Richtige war. Bald bildete sich in Halle eine nette kleine Gruppe heraus, die aufgeschlossen und interessiert an die Sache heran ging. Dazu gehörten auch die beiden Leipziger, die unserer halleschen Gruppe die Treue hielten. Die beiden hielten allen voran die Skepsis hoch. Dann gab es da noch Paul Abendroth, Bauingenieur und seine Partnerin, eine Frau Doktor Klug, die an der halleschen Universität arbeitete. Die fielen mir gleich auf, da die beiden sich besonders an den Verdienstaussichten sehr interessiert zeigten und auch ansonsten einen recht spitzfindigen Eindruck machten. Ferner kamen noch zwei befreundete Frauen regelmäßig zu den Schulungen im Hauptberuf Lehrerinnen.
Manchmal saßen wir nach der Schulung noch eine Stunde in kleiner Runde beisammen, schwatzten miteinander, tranken etwas und erzählten dabei auch manche private Anekdote. Es war eine sehr optimistische Zeit. Alles entwickelte sich rasend schnell vorwärts. Und das schlug sich zunehmend nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Mitarbeitern in barer Münze nieder. Denn schnell hatten diese erste Beratungstermine vereinbart, die ich mit ihnen gemeinsam durchführte. Kam es dabei zu einem Vertragsabschluss, hatten sie bereits ihr erstes Geld verdient. Dies wiederum spornte sie an und motivierte die anderen aus der Gruppe.
Für die Ossis war vieles anders und das begann bereits mit dem Erscheinungsbild. Im Westen wurde erwartet, dass man in dieser Branche hundertprozentig seriös im Anzug auftrat. Als wenn man aus der Qualität der Aufmachung Rückschlüsse auf die Seriosität des Verkäufers schließen könnte. Das ging man hier im Osten wesentlich unbefangener an. Dies lebten besonders meine beiden Leipziger vor und setzten sogar ein spezielles optisches Highlight. Die Männer kamen normalerweise mit Hemd, Stoffhose, Sakko und Schlips zu den Schulungen. Die beiden im Prinzip auch. Nur dass sie als Hose kurze graue Shorts trugen, dazu weiße Socken und graue Halbschuhe. Das war gepaart mit einer alten braunen Aktentasche schon ein ganz besonderer Hingucker. Doch der Hit an sich bestand in dem bunt geblümten Hawaiihemd, das sie dazu trugen. Nun, okay, warm genug war es ja, aber Krawatte und kurze Hose, zusammen mit dem bunten Hemd, das sah schon ziemlich gewöhnungsbedürftig aus.
Auch für mich war hier im Osten im beruflichen Ablauf einiges neu. Da ich noch kein Büro hatte, spielten sich alle Zusammenkünfte im Rahmen der Schulungen ab. Am gewöhnungsbedürftigsten stellte sich für mich die Sache mit dem Telefon dar. Denn das war für mich völlig ungewohnt, plötzlich nicht mal eben zum Hörer greifen zu können, sei es, weil sich Termine verschoben, um Fachliches zu klären oder einfach nur, um abends mal mit meiner Freundin Sylvie quatschen zu können.
In Halle konnte ich höchstens mal bei dem einen oder anderen Mitarbeiter von zu Hause aus telefonieren, sofern dieser ein Telefon hatte, oder ich ging zur Hauptpost. Es gab zwar auch einzelne Telefonzellen oder besser gesagt Münzfernsprecher, aber mir sollte es in der ganzen Zeit nie vergönnt sein, diesen wuchtigen, grauen Kästen auch nur ein Freizeichen zu entlocken, geschweige denn eine Verbindung herzustellen. Ein paar Mal hatte ich schon die schicke alte Hauptpost aufgesucht. Darin kam man sich vor wie im Ausland. In der hübschen, aber düsteren Halle musste man sich erst einmal zum Telefonieren anmelden und dann natürlich warten, bis man eine frei gewordene Zelle zugewiesen bekam.
Diese Zellen waren total klein und eng, schwach beleuchtet und mit einer winzigen Ablage in der Ecke, auf die nicht viel mehr als das alte Telefon passte. Der Versuch, sich während des Telefonates etwas zu notieren, grenzte an Artistik. Man musste sich den Hörer zwischen Kopf und Schulter klemmen, den Kalender mit der rechten Seite auf die Ablage legen und mit der linken Hand die linke Hälfte des Kalenders festhalten. Dann konnte man mit der rechten Hand schreiben. War man mit dem Telefonieren fertig, hieß es das Gespräch noch am Schalter zu bezahlen. Meistens musste man sich dafür in der Warteschlange anstellen. Eine umständliche Prozedur, der man sich nicht häufiger als unbedingt nötig unterzog.
Als wäre mein Büroalltag damit nicht kompliziert genug, musste ich meist auch noch freitags nach Hannover fahren. Denn dort wartete neben einem Samstag im Büro auch noch meine Freundin Sylvie auf mich. Die gemeinsame Zeit mit ihr kam dabei ziemlich kurz. Sylvie und ich waren damals nicht glücklich, dass wir uns nur noch so wenig sahen, aber wir wussten auch, dass die Sache in Halle die große Chance für mich bedeutete. So versuchte sie, dass sie am Wochenende frei hatte, damit wir möglichst viel Zeit gemeinsam hatten, was aber bei ihrem Schichtbetrieb im Hotel nur teilweise klappte.
Manchmal schaffte ich es, freitags bis kurz vor zweiundzwanzig Uhr in Hannover anzukommen und holte sie dann noch im Hotel ab. Um zweiundzwanzig Uhr schloss sie dort die Fitnessetage, in der sie arbeitete, und hatte dann noch aufzuräumen, bevor sie nach Hause konnte. Sie freute sich immer riesig, wenn ich plötzlich unerwartet bei ihr im siebzehnten Stock aus dem Fahrstuhl stieg. Ich nutzte die Zeit dann meist noch für einen kleinen Saunagang oder ein kleines Bad in Hannovers höchstem Pool, was nach der anstrengenden Fahrt sehr entspannend war. Oft bekam ich dazu noch einen leckeren, frisch gepressten O-Saft »auf Kosten des Hauses«. Welch ein Unterschied zu meinem Leben in Halle, wo sich in Kürze auch noch meine Wohnsituation deutlich ändern sollte.
Sylvie freute sich sehr darüber, wie gut sich die Sache mit den Finanzberatungen bislang anließ, zumal sich das Engagement inzwischen auch finanziell niederschlug. Einmal hatte sie mich schon in Anitas Zweiraumwohnung in HaNeu besucht und fand das alles auch ziemlich spannend. Nur die Sache mit dem Wohnen gefiel ihr nicht. Sicherheitsbedürftig, wie sie nun einmal war, setzte sie zu diesem Zeitpunkt noch auf ihren geregelten Job in Hannover. Man wusste ja nie. Wir sprachen schon darüber, mal ganz nach Halle zu ziehen. Wenn die Entwicklung so weiterginge, wäre das irgendwann nur die logische Konsequenz. Aber momentan wollte sie davon nichts wissen.
»Erst wenn du eine gescheite Wohnung für uns hast«, pflegte sie immer zu sagen, wohl wissend, dass die nicht eben mal so aus dem Hut zu zaubern war.