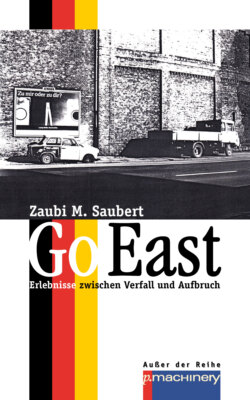Читать книгу GO EAST - Zaubi M. Saubert - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neun
ОглавлениеNachdem man am 3. Oktober die deutsche Einheit vollzogen hatte, war ich nun nicht mehr Ausländer in Deutschland und ich beschloss, einen neuen Anlauf zur Erlangung eines Wohnberechtigungsscheines zu wagen. Daher machte ich mich knapp eine Woche nach der Wiedervereinigung erneut auf den Weg zum Magistrat. Stellte mich wieder artig an und wurde irgendwann von der gleichen dicken Olga mit dem gleichen feindseligen Blick aufgefordert, einzutreten.
Zwei Dinge waren diesmal anders. Zum einen war die Olga nicht mehr allein im Zimmer, nein, ihr gegenüber hockte ein zartes Jüngelchen an einem Schreibtisch, und zum anderen prangte über ihr auf der schrecklich gemusterten, vergilbten Tapete ein fast bunter Fleck, der mich im ersten Moment verwunderte. Na klar, hier hatte bis vor Kurzem noch das Konterfei des großen Staatsratsvorsitzenden von oben auf die Genossin geblickt. Aber das war nun Geschichte.
Wieder trug ich brav mein Anliegen, die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines für mich und meine Freundin, vor. Und wieder sah ich, wie der Olga der Kamm, äh, beziehungsweise der astronomische Busen in der weißen Bluse anschwoll und sie dazu ansetzte, mir erneut etwas von Zuzugssperre und Ausländern zu erzählen. Doch während sie noch zum verbalen Rundumschlag ausholte, fiel ich ihr ins Wort.
»Gute Frau, ich bin freier Bürger in einem freien Land und ich fordere Sie hiermit auf, mir hier und jetzt einen Wohnberechtigungsschein auszustellen«, brachte ich meinen Wunsch vor. Gerade sitzend, mit vorgestreckter Brust. Mein Gegenüber pumpte, wie ich es bereits schon einmal bei ihr gesehen hatte. Die Nähte ihrer Bluse spannten sich wieder zum Bersten und ich rechnete jeden Moment damit, dass mir die Knöpfe derselben wie aus einer Stalinorgel um die Ohren schießen würden. Ihre Gesichtsfarbe wechselte von Rot zu Purpur. Sie musste jeden Moment platzen. Doch da ergriff das kleine Männchen auf der anderen Seite des Schreibtisches das Wort.
»Äh«, brachte es mit leicht erhobenem Zeigefinger hervor. Böse funkelte sie ihn an.
»Äh, Entschuldigung, Genossin, äh, der Bürger hat recht. Das ist nicht mehr so«, brachte er zaghaft hervor. Für einen Moment herrschte absolute Stille im Raum. Dann wandte sich die Olga, immer noch zum Bersten angeschwollen, mit purpurrotem Gesicht zu mir herum und herrschte mich an: »Sie warten draußen!«
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, stand auf und verließ eilig den Raum. Im Hinausgehen fiel mir ein Bilderrahmen auf, der umgedreht in der Ecke stand. Aha, der Staatsratsvorsitzende a.. Etwa eine Viertelstunde später öffnete sich die Tür erneut und Olga erschien im Türrahmen. Mit den Worten »Hier, Bürger« drückte sie mir ein postkartengroßes Stück Papier in die Hand, überschrieben mit dem Wort »Wohnberechtigungsschein«. Bingo. Ich strahlte sie freundlich an, sagte »Danke« und wünschte ihr noch einen schönen Tag. Wortlos, mit einem leisen, unfreundlichen Grunzen drehte sie sich auf der Stelle um und schloss lautstark die Tür hinter sich. Juhu, mit diesem Schein hatte ich Anrecht auf eine sogenannte Zweiraumwohnung. Ganz genau sogar auf eine 2–3-RWE, wie man in der Kurzform für Raumwohneinheit sagte. Was wollte ich mehr, fragte ich mich und hatte für den Rest des Tages gute Laune.
Nun überlegten Horst und ich, wie wir zu einer Wohnung gelangen konnten. Er bemühte sich erst einmal nicht selber um einen Wohnberechtigungsschein, wohl in der Annahme, dass mein Schein fürs Erste ausreichen würde und wir zu dritt eine Wohnung beziehen könnten. Wir hatten den Tipp bekommen, selber loszugehen und nach leeren Wohnungen Ausschau zu halten. Hatten wir etwas gefunden, könnten wir dann zu der entsprechenden Stelle bei der Genossenschaft gehen, dort vorsprechen und versuchen, an die betreffende Wohnung zu gelangen. Doch das wäre nicht einfach, weil die halbwegs brauchbaren Wohnungen meist anderweitig oder mittels Schmiergeld vergeben wurden. Den Genossenschaften haftete dazu noch der Ruf der Unfähigkeit an und dass sie zum Teil gar nicht wüssten, was sie im Bestand hatten. Erschwerend kam hinzu, dass manch leere Wohnung zu Recht leer stand, weil sie einfach nicht mehr bewohnbar war. Das konnte man von außen aber nicht unbedingt sehen.
An eine Plattenbauwohnung kam man eh nicht ran. Für die gab es sogar noch lange Wartelisten. Gut, da wollte ich eigentlich sowieso nicht rein. Auch bei den Altneubauten hatte man keine Chancen. Also blieben nur die Altbauten. Eigentlich toll, nur befanden die sich meist in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand. Das hatte ich ja schon selber mitbekommen. Mir kam eine Idee: Warum sollte ich nicht versuchen, unsere jetzige Wohnung in der Großen Ulrichstraße zu bekommen? Die war ja von der Sache nicht schlecht und die zentrale Lage in der Nähe des Marktes war toll. Und wegen des fehlenden Bades konnte man sich ja etwas einfallen lassen.
Ich hatte erfahren, dass für unsere Wohnung wohl das Gewerbeamt zuständig sei. Na, okay, dann gehe ich halt mal dorthin und frage nach, überlegte ich mir. Gesagt, getan. Wenige Tage später machte ich mich morgens auf den Weg zu einem für DDR-Verhältnisse modernen Gebäude in der Schmerstraße. Die zuständige Sachbearbeiterin dort war zwar nicht so eine Granate wie die auf dem Magistrat, strahlte mir gegenüber aber trotzdem gleich eine gewisse Ablehnung aus. Ich erläuterte ihr, dass ich auf der Suche nach Gewerbe- und Wohnraum in Halle wäre und auch bereit sei, ein gewisses Maß an Instandsetzung zu übernehmen. Konkret konnte oder wollte sie mir gar nichts anbieten. Ich erkundigte mich dann einmal vorsichtig nach dem Haus in der Großen Ulrichstraße. Ja, da wüsste sie auch nicht, da müsste man vielleicht mal gucken … Vielleicht könne sie ja mal schauen, ich würde dann in der kommenden Woche wiederkommen, bat ich sie. Auf alle Fälle rückte ich ziemlich unverrichteter Dinge wieder ab.
Zurück in unserer Wohnung erlebte ich eine böse Überraschung. Am Gaszähler im Treppenhaus hing ein Zettel, auf dem stand, dass man diesen Zähler und den dazugehörenden Stromzähler in zwei Tagen abklemmen würde. Uh! Schöner Mist. Nachdem ich mit Horst und Malte Kriegsrat gehalten hatte, beschloss ich, gleich am nächsten Tag zur Energiewirtschaft zu gehen und zu versuchen, dies zu verhindern. Wir waren ja durchaus bereit, für Strom und Gas zu bezahlen. Zumal es ohne natürlich gar nicht ging.
Die Energiewirtschaft saß in einer riesigen »Scheibe« am Thälmannplatz. Bei den Plattenbauhochhäusern unterschied man zwischen Punkthochhäusern und Scheiben, womit sich die Hausformen selber erklärten. Dies war also eine zehngeschossige Scheibe und der riesige Thälmannplatz hieß neuerdings Riebeckplatz, was aber nur langsam den Weg in den Wortschatz des Hallensers fand. Die Fußgängerzone endete ebenfalls am Thälmann- beziehungsweise Riebeckplatz und dahinter lag der Hauptbahnhof. Eingerahmt wurde der Platz von mehreren großen Scheiben und Punkthochhäusern und dem sogenannten Haus des Lehrers, mit einer typischen vorgehängten 60er-Jahre-Fassade und den »Fäusten« davor. Hierbei handelte es sich um eine unglaublich hässliche Betonskulptur aus dem Jahr 1970, die mit ihren gestreckten Fäusten die Kampfbereitschaft der revolutionären Arbeiterbewegung darstellte. Alles in allem war der Thälmannplatz damals eine imposante Erscheinung für die aufstrebende DDR gewesen. Inzwischen gewesen, denn das Flair der 70er Jahre verfehlte nun seine Wirkung.
In dem riesigen Gebäude der Energiewirtschaft brauchte ich eine Weile, um mich zu orientieren. Im Gegensatz zu anderen Ämterkontakten wurde ich hier sehr nett und hilfsbereit behandelt. Schließlich hatte ich mich zur richtigen Stelle durchgefragt, trug mein Anliegen vor, allerdings etwas geschönt. So erzählte ich, dass wir angefangen hätten, die Wohnung zu renovieren, weil wir dort einziehen wollten und von dem Zettel am Gaszähler. Deswegen bat ich, man möge uns Strom, Wasser und Gas nicht abstellen, sondern dies gleich auf mich anmelden.
Was nun folgte, konnte ich kaum glauben. Der Mitarbeiter schaute mich verständnisvoll an, meinte in feinstem halleschem Dialekt »Nu gloar« und teilte mir mit, dass ich auf den Zettel am Gaszähler einfach hätte drauf schreiben sollen: »Bitte nicht abstellen wegen Renovierung.« Das hätte gereicht. Mir fehlten die Worte. So einfach ging das. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Auf alle Fälle meldete ich die Energie ordnungsgemäß an. So wohnten wir zwar immer noch illegal, bezogen aber wenigstens legal Strom, Wasser und Gas.
Leider gab es bei dem Status der Wohnung keine Veränderung. Auch als ich das nächste Mal auf dem Gewerbeamt vorsprach, tat sich nichts. Nein, man könne mir weder Wohn- noch Gewerberäume anbieten. Und die Wohnung in der Großen Ulrichstraße sei nicht zu mieten, hieß es dort lapidar. Auf meine Frage nach dem Warum erhielt ich keine Antwort. Auch auf die Frage, was denn zukünftig mit dem Haus vorgesehen wäre, blieb man mir die Antwort schuldig. Die wollten scheinbar nicht. Aber warum? Ich war freundlich und nett und ließ bestimmt nicht den arroganten Wessi raushängen. Denn der war nämlich inzwischen durchaus in Halle angekommen.
Einige Tage später platzte mir auf dem Gewerbeamt dann der Kragen. Ich erläuterte der Sachbearbeiterin, dass ich hier in Halle Arbeitsplätze schaffe und zurzeit bereits zwanzig Mitarbeiter beschäftige und da müsse ich ja irgendwo bleiben. Wie sie sich das denn vorstelle, wollte ich von ihr wissen.
»Das ist Ihr Problem«, bekam ich schnippisch zur Antwort. Da hatte ich genug und offenbarte ihr, dass ich bereits in der besagten Wohnung wohnen würde, denn schließlich könne ich ja nicht auf der Straße leben.
Das saß. Ich konnte förmlich zusehen, wie ihr die Kinnlade herunter klappte, sie nach Luft schnappte und mich völlig entgeistert anstarrte.
»Sie wohnen dort?«, wiederholte sie ungläubig und teilte mir dann mit, dass dies völlig illegal sei, ob ich das nicht wisse. Und das dies gar nicht ginge und ich dort sofort ausziehen müsse. Worauf ich ihr sagte, dass ich dazu nur allzu gern bereit wäre, wenn sie mir geeignete Räumlichkeiten anbieten könne. Konnte oder wollte sie jetzt aber erst recht nicht. Stattdessen ereiferte sie sich nur noch weiter darüber, wie illegal mein Verhalten wäre und dass sie mich räumen lassen könne. Das war’s dann wohl. Darauf empfahl ich der sichtlich erregten Frau, sie möge dann eine Räumung veranlassen, wünschte ihr noch einen schönen Tag und ging.
Mist. Da führte also kein Weg rein. Dann mussten wir uns also weiter nach anderem Wohnraum umsehen. Sichtlich genervt und abgebockt kehrte ich in die Große Ulrichstraße zurück. Ausnahmsweise hatte ich heute keine Termine und so verabredete ich mich mit Eduard, dem netten Wessi von über uns, schon am frühen Abend zum Biertrinken im Nöö. Gerade hatte ich ihm von meiner Niederlage auf dem Gewerbeamt erzählt, als er meinte, er hätte dafür auch eine gute Nachricht für mich. Was das denn sein sollte, wollte ich missmutig wissen.
»Na, ihr wolltet doch Telefon haben«, begann er.
»Ich habe mit den anderen gesprochen und die haben nichts dagegen, dass ihr unsere Leitung anzapft«, eröffnete er mir grinsend. Wow, das war ja mal eine super Nachricht.
»Telefon, ich glaubs ja nicht«, jubelte ich und lud Eduard gleich auf das nächste Bier ein. Wir hatten neulich darüber gesprochen, dass es in ihrer Wohnung einen intakten, funktionierenden Telefonanschluss gab, für den noch dazu bislang nie eine Rechnung gekommen wäre. Das hieß, man konnte sogar kostenlos telefonieren. Ich hatte gemutmaßt, dass das mit der Kammer für Außenhandel bei uns im Haus zusammenhing. Bestimmt ein alter Stasianschluss, dachte ich, aber egal. In dem Zusammenhang hatte ich ihn gefragt, ob wir diesen Anschluss nicht anzapfen könnten. Vorausschauend hatte ich mir aus Hannover bereits einen alten Apparat mitgebracht. Das hatte ich vor lauter Ärger vergessen.
Am nächsten Tag ging ich dann gleich nach dem Frühstück in den kleinen Elektroladen bei uns um die Ecke, kaufte dreißig Meter Telefonkabel und eilte damit zu Eduard in den dritten Stock. Handwerklich versiert, wie er war, hatte er das Kabel dort ruckzuck an der Telefondose angeschlossen, dann das Kabel einmal durch die Wohnung bis zum Fenster verlegt und durch den alten Holzrahmen nach außen gezogen. Schon baumelte es unten bei uns vor dem Fenster.
Dort zogen wir dann das Ende der Telefonleitung wieder durch den undichten Fensterrahmen bei mir im Zimmer in die Wohnung. Nun schloss Eduard geschickt das Ende des Kabels an das mitgebrachte Telefon. Nun kam der große Moment. Ich nahm den Hörer ab. Und? Ich hörte das Freizeichen schon, bevor ich den Hörer am Ohr hatte.
»Wow, ist das geil«, freute ich mich.
»Cool«, meldete sich Horst aus seinem Zimmer.
Wen rufe ich jetzt an? Sylvie, na klar. Sie hatte heute Spätschicht und könnte zu Hause sein. Schnell hatte ich ihre Nummer gewählt und lauschte auf das Verbindungsgeräusch. Nach einer Weile klingelte es am anderen Ende der Leitung. Vielleicht etwas leiser als sonst. Spannende Sekunden verrannen.
»Stegmann«, vernahm ich plötzlich eine mir wohl bekannte Stimme.
»Hey, ich bin’s, Zaubi, wir haben Telefon!«, meldete ich mich freudig.
»Echt? Von Eduard?«, wollte sie wissen, was ich bejahte.
»Das ist ja toll«, freute sie sich und notierte sich gleich meine Nummer. Zur Kontrolle rief sie mich anschließend zurück. Auch das funktionierte reibungslos. Toll. In der Folgezeit musste man nur vor dem Wählen einmal in den Hörer lauschen, ob nicht gerade jemand aus der oberen Wohnung telefonierte, was aber selten vorkam. Wenn die Leitung frei war, konnte man dann ganz normal telefonieren. Das erwies sich natürlich als sehr praktisch. Das Telefon stand zwar bei mir im Zimmer, aber das Kabel reichte quer durch die ganze Wohnung.
Unsere anderen beiden Mitbewohner freuten sich natürlich ebenfalls darüber. Der drohende Ärger mit dem Gewerbeamt war ihnen allerdings ziemlich egal. Mia wollte sowieso ausziehen und suchte bereits eine neue WG und Malte meinte, er würde sich dann halt auch was Neues suchen. Nur für uns standen die Chancen ganz schlecht, hier offiziell bleiben zu können, und illegal würde es nicht ewig gut gehen. Wir kamen nicht drum herum, weiter nach einer Wohnung zu suchen.