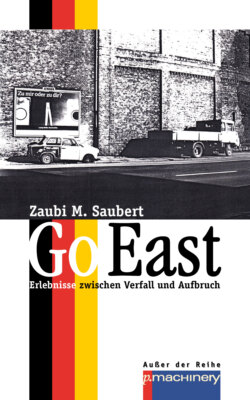Читать книгу GO EAST - Zaubi M. Saubert - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Elf
ОглавлениеInzwischen hatte der Herbst in Halle Einzug gehalten. Es wurde später hell und dafür früher wieder dunkel. Dazwischen war es oft den ganzen Tag gleichbleibend grau. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Häufig kam dazu auch noch Nebel. Ein dichter, manchmal undurchdringlicher grauer Nebel, der den ganzen Tag nicht wich. Vor der Kulisse der alten, halb verfallenen Straßen mutete es manchmal an wie im London der alten Edgar-Wallace-Filme.
Und gleich das Erste, was ich morgens nach dem Aufwachen noch im Bett roch, war der typische Geruch von Braunkohle, inzwischen allgegenwärtig. Noch schlief ich damals bei offenem Fenster, gewöhnte mir dies aber bald ab. Besonders intensiv wurde der Geruch, wenn man das Haus verließ, lag die Große Ulrichstraße doch in einer Senke. Sobald man die Haustür öffnete, stieg einem dieser markante Braunkohleduft ganz deutlich in die Nase.
Wir parkten unsere Autos meist nur wenige Schritte entfernt in einer kleinen Seitenstraße hinter der Universität. Inzwischen hatte ich mir angewöhnt, vor dem Losfahren erst einmal die Scheibenwaschanlage zu betätigen, um den schwarzen Rußfilm auf der Scheibe, der jetzt in der Heizperiode noch schlimmer wurde, wegzuwaschen. Dass der einst knallrote Lack meines VW Passat inzwischen deutlich ins Anthrazitfarbene tendierte, ignorierte ich. Wie sollte ich auch anders reagieren. Waschanlagen im westlichen Sinn gab es natürlich in Halle noch nicht, und wenn ich mal in Hannover weilte, kam ich nicht dazu, den Wagen zu waschen, oder ich dachte nicht daran.
Zu dieser Zeit gestaltete sich schon das banale Tanken nicht ganz einfach, da Halle nur über ganze zwei Tankstellen verfügte. Da war Geduld gefragt. Ich fuhr meistens zu der Minol-Tankstelle auf der Magistrale am Eingang von HaNeu. Oft durfte man sich dort schon auf dem Standstreifen, vor der eigentlichen Einfahrt zur Tankstelle, in die Warteschlange einreihen. Realistisch betrachtet dauerte es oft etwa eine Stunde, »wenn man eben mal tanken fuhr«. Aber es zeichnete sich ja Besserung ab.
In der halleschen Südstadt entstand die erste Tankstelle der Firma DEA. Zufällig kam ich an einem Sonntagnachmittag dort vorbei. Zuerst bemerkte ich einen Menschenauflauf, der sich da neben der Straße auf einer Baustelle gebildet hatte. Ist hier ein Fest, fragte ich mich, ein Tag der offenen Tür? Unter dem bunten Kunststoffdach der zukünftigen Zapfstellen herrschte ein mächtiges Gewusel. Hier tummelten sich wirklich alle, vom Kleinkind bis zum Greis. An dem Tankstellengebäude selber waren gerade mal Fenster und Türen eingebaut, und obwohl es im Inneren des Gebäudes nichts zu sehen gab, drückten sich die Menschen die Nasen an den Scheiben platt. Es gab hier eigentlich gar nichts. Weder einen Bierausschank noch gegrillte Würstchen. Es handelte sich eigentlich nur um eine ganz normale Baustelle, trotzdem liefen hier so viele Menschen rum. Es war halt die erste Westbaustelle einer Westtankstelle, die man hier in Halle bestaunen und anfassen konnte. Das stellte schon ein Erlebnis dar. Ein bisschen wie im Zoo.
In unserer Schwarzwohnung ging das Leben seinen normalen Gang. Immerhin bezogen wir nun legal Strom, Gas und Wasser. Malte und Mia besuchten wieder die Uni, die Sammlung der leeren Flaschen auf dem Flur wuchs stetig weiter an und der Hygienestandard von Küche und Klo bewegte sich hart am Rande des Zumutbaren. Freitag ließ Malte eine kleine Party steigen. Horst und ich hatten leider mal wieder Infoabend und würden so einen Teil des Festes verpassen. Inzwischen waren wir mit den Schulungen übrigens umgezogen in das einstige Klubhaus der Gewerkschaften, ein riesiges ehemaliges Gesellschaftshaus an der Magistrale nach HaNeu, das nun ziemlich brachlag und einstaubte. Nur ein winziger Teil des weitläufigen Gebäudes wurde noch gastronomisch genutzt. Überdauert hatten die Kakerlaken, die hin und wieder über die breite weiße Fensterbank des Schulungsraums flitzten. Deshalb achtete ich immer darauf, meinen Koffer geschlossen zu halten. Kakerlaken hätten uns in der Wohnung gerade noch gefehlt.
Am frühen Abend waren Horst und ich, wie immer im Anzug, mit Aktenkoffer und dem Overheadprojektor aus der Wohnung zu unserem Infoabend aufgebrochen. Wegen unseres Outfits hatten wir noch ein paar lästerliche Kommentare von Malte und Mia mit auf den Weg bekommen. Zur Sicherheit sperrten wir unsere Zimmertür mit einem dieser osttypischen Einsteckschlösser ab. Man wusste ja nicht, wer alles zum Fest kam.
Als wir gegen zweiundzwanzig Uhr zurückkehrten, hörten wir die Musik bereits unten auf der Straße. Drinnen ging es hoch her. Auf den ersten Blick erkannte ich kaum jemanden und wir gingen über den Flur zu unseren Zimmern. Dort machten wir uns erst einmal ein Feierabendbier auf und zogen wieder Zivilkleidung an, bevor wir uns ins Getümmel stürzen wollten. Der Lärm im vorderen Teil der Wohnung schwoll noch einmal an. Die Musik wurde plötzlich überlagert durch heftiges Geschrei, wohl aus der Küche.
»Cool, da geht es aber ab«, meinte Horst.
Und so plötzlich, wie es anfing, endete der Krach auch wieder. Erst verstummte das Geschrei, dann ging die Musik aus. Ich meinte, noch das Zuschlagen einer Tür zu hören. Danach herrschte Ruhe. Aber totale Ruhe. Hielten jetzt alle auf Kommando die Luft an oder war die Party vorbei? Als wir nach einigen Minuten immer noch keinen Laut hörten, musste ich doch mal nachsehen, was los beziehungsweise nicht mehr los war. Ich ging über den leeren Flur zum Wohnzimmer. Es war einigermaßen verwüstet, aber leer. Dann öffnete ich die Küchentür. Es brannte kein Licht, offenbar befand sich hier auch niemand mehr. Als die nackte Glühbirne die Küche schlagartig in helles Licht tauchte, traf mich fast der Schlag. Was war denn das? Es waren nicht die leeren Flaschen, Gläser und Tassen, die mir ins Auge sprangen, sondern die bräunlichen Plocken, die auf dem Fußboden, an den Schränken, auf dem Tisch, an den Wänden, einfach überall klebten. Was war das?
Während ich noch einigermaßen fassungslos auf das Schlachtfeld starrte, hatte sich Horst von hinten genähert und schaute mir über die Schulter in die Küche.
»Cool, die haben hier ’ne Tortenschlacht gemacht«, stellte er fest. Richtig, es handelte sich um Torte. Braune Plocken, mit Sahne versetzt. Und die ganze Küche hatten sie damit eingesaut.
»Ich glaubs ja nicht. Was ist denn das für eine Sauerei. Und wo sind die jetzt alle hin?«, fragte ich in die leere Küche hinein.
»Keine Ahnung, das ist ja krass«, staunte Horst ob des Chaos’ vor uns. Glücklicherweise hatten wir bei uns hinten noch eine Kiste Bier stehen, denn dass wir hier vorne in der Wohnung noch etwas Verwertbares fänden, konnten wir nicht erwarten.
»Bin mal gespannt, wer die Sauerei wieder wegmacht«, meinte ich genervt, machte das Licht aus und die Küchentür wieder zu. Wir tranken noch ein, zwei Bier bei Horst im Zimmer und gingen dann ins Bett. Am nächsten Morgen hatten wir um zehn Uhr Tagesseminar und da mussten wir fit sein.
Ein ohrenbetäubender Knall, gefolgt von einer gewaltigen Lärmwelle ließ mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf hochfahren und senkrecht im Bett stehen. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was passiert war. Oh nein! Malte ist zurück. Es waren unverkennbar seine noch etwas ungelenken ersten Griffe auf der Gitarre bei voll aufgedrehtem Verstärker. Ein Blick auf den Wecker brachte mir die Erkenntnis, dass es kurz vor vier Uhr morgens war. Tat das jetzt not?
Malte nahm seit einiger Zeit Gitarrenunterricht und hatte sich in der letzten Woche einen kleinen Gitarrenverstärker gekauft, einen quietsch-orangefarbenen Brüllwürfel. So klein der war, so viel Lärm konnte er machen. Und jetzt, zu dieser vorgerückten Stunde, stand dem guten Malte der Sinn scheinbar nach Üben. Warum kann er es dann nicht mal akustisch versuchen? Plötzlich stoppte der Lärm so abrupt, wie er begonnen hatte. Dafür ging aber auch mein Licht aus. Aus dem Treppenhaus hörte man eine Stimme, die schrie:
»Das reicht, ich glaube, du spinnst!«
Das war Ralf Kramer, der Philosophiestudent, dessen Zimmer genau über dem von Malte lag. Ralf hatte sich letzte Woche schon einmal beschwert, als Malte zu nachtschlafender Zeit den Regler des Brüllwürfels auf zehn hochdrehte. Nun war er offensichtlich heruntergekommen und hatte im Treppenhaus unsere Hauptsicherung herausgedreht.
Ich hörte Malte noch kurz irgendwas grummeln und an der Wohnungstür hantieren, dann schlief ich wieder ein. Am nächsten Morgen konnten Horst und ich nur den Kopf schütteln über das in der letzten Nacht erlebte. Doch damit noch nicht genug. Zu allem Übel war das ohnehin schon eklige Klo jetzt auch noch verstopft. Diesen Zustand ignorierend setzte ich noch einen drauf in die halb volle Schüssel. Ihr könnt mich alle mal, fluchte ich. Wir verließen die Wohnung ohne Frühstück, nur einen Kaffee hatten wir uns in der versifften Küche noch auf die Schnelle gekocht und machten uns auf zu dem anstehenden Tagesseminar.
Von den Teilnehmern des gestrigen Infoabends erschienen immerhin sechs im Klubhaus der Gewerkschaften. Na, wenigstens das war positiv. So hatten Horst und ich einen intensiven Schulungstag. Wir gönnten uns im Anschluss ein leckeres Essen im Roten Ross und fuhren dann zusammen ins Büro. In die versiffte Wohnung zog es uns beide nicht zurück. So nahmen wir uns ein Bier aus dem Kühlschrank, losten aus, wer zuerst in die Wanne durfte, und entspannten uns langsam.
Wieder zu Hause in der Wohnung trafen wir Malte in der Küche, die tatsächlich schon wieder halbwegs benutzbar aussah. Lediglich auf den Wänden fanden sich noch Zeugnisse der Kuchenschlacht. Mia sei es gewesen, die angefangen hätte, mit Kuchen zu werfen, und andere hätten zurückgeworfen, so berichtete es Malte. Nun lag sie mit einem dicken Kopf im Bett und zog sich so elegant aus der Affäre. Zu der Lärmorgie in der letzten Nacht meinte Malte nur entschuldigend schüchtern, dass er einfach noch Lust hatte, etwas Gitarre zu spielen.
»War der Ralf wohl sauer auf mich?«, fragte er uns überflüssigerweise.
»Wird er wohl«, antwortete ich kurz.
Nachdem unsere Mitbewohner gestern gefeiert hatten, war uns heute nach Bier trinken. Spät am Abend kehrten wir, schwer angeheitert aus dem Nöö zurück in die Wohnung. Mist, wir hatten nichts mehr zu rauchen. Da es noch keine Zigarettenautomaten wie im Westen, damals an jeder Straßenecke gab, stellte sich die Frage, wo man jetzt in Halle um diese Uhrzeit noch Rauchwaren herbekommen konnte. Da fiel uns eigentlich nur eine Nachtbar oben auf der Reilstraße ein. So weit war es nicht, aber noch zu Fuß dahin?
»Nee, ich fahr noch«, erklärte Horst und schon waren wir unterwegs. Wenig später hatten wir in der Nachtbar frische Zigaretten erstanden und kehrten rauchend zu Horsts Auto zurück. Kaum losgefahren überholte uns ein Lada, aus dem auch schon eine Kelle zum Vorschein kam, die uns rechts ran winkte.
»Scheiße! Die Bullen«, bemerkten wir beide unisono. Horst hatte sich zwar eben noch ein Fisherman in den Mund gesteckt, würde aber sicher noch eine ordentliche Fahne haben. Schon stiegen die beiden Vopos aus, setzten sich die Mützen auf und kamen auf unser Auto zu. Mit einem gewichtigen Griff an die Mütze stellte sich der Erste vor:
»Gudn Nobend. Wolksbollizei. Vergehrsgondrolle. Gönntsch mal Ihre Bapiere sehn?«, wandte er sich höflich an Horst. Der grüßte schüchtern-freundlich zurück und reichte die gewünschten Unterlagen hinaus. Der Vopo musterte diese, schaute über das Auto, beugte sich dann zu Horst herunter und fragte ihn, ob er etwas getrunken hätte. Was Horst bestritt.
»Nu, vielleicht ’nen gleinen Pfeffi?«, hakte der nach. Ich bemerkte, wie Horst der Schweiß auf die Stirn trat. Oh scheiße, dachte ich. Warum wir ohne Licht fahren, wollte er wissen. Äh, ja, Horst erklärte ihm sichtlich nervös, wir hätten in der Bar gar nichts getrunken, sondern nur kurz Zigaretten gekauft und wollten wieder nach Hause. Und da hätte er beim Losfahren wohl vergessen, das Licht anzumachen. Daraufhin reichte der Volkspolizist Horst seine Papiere zurück, meinte, er solle das Licht anmachen, und wünschte uns noch gute Fahrt und einen schönen Abend.
Während wir uns noch sprachlos anschauten, stiegen die beiden Gesetzeshüter in ihren Lada und verschwanden in der Nacht. Eigentlich hatte es sich bei den beiden ja gar nicht mehr um Vopos gehandelt, sondern um bundesdeutsche Polizisten, aber daran mussten die sich auch erst noch gewöhnen. Zumal sie auch noch die alten Uniformen trugen. So war das damals. Die wollten gar keinen Ärger, sondern nur freundlich darauf hinweisen, dass wir doch bitte das Licht anschalteten. Wahrscheinlich waren die sogar froh, dass wir freundlich geblieben waren. Der einst so große Respekt vor der Obrigkeit ging, zumindest bei der Jugend, völlig verloren. Das spiegelte sich auch darin wider, dass in zunehmendem Maß junge Leute in Halle ganze Häuser besetzten und diese als Kulturzentren propagierten. Auch die sogenannten Wohnzimmerkneipen, die wild ohne Lizenz oder Gewerbeanmeldung entstanden, waren ein Beispiel dafür. Es herrschte in gewisser Hinsicht Anarchie. Die Obrigkeit wusste nicht, traute sich nicht oder zeigte sich schlichtweg überfordert, und die Jugend probierte die neue Freiheit aus.
Dies führte auch dazu, dass durch immer mehr Kneipen, erst nur durch die alternativen, bald aber auch durch ganz normale Lokale, der Geruch von Marihuana zog. Waren die Ossis damit früher höchstens mal in Ungarn oder in Ostberliner Künstlerkreisen in Kontakt gekommen, so breitete es sich jetzt zunehmend in den neuen Bundesländern aus. Der Stoff kam zu Beginn noch aus Holland, aber bald auch schon direkt aus Berlin, wo er im Umland angebaut wurde. Man sah immer häufiger junge Leute, die sich völlig ungeniert in der Kneipe einen Joint drehten und diesen dann rauchten. Und es störte niemanden. Eher musste man damit rechnen, dass einen der Wirt mal fragte, ob er denn auch mal ziehen könne.
Im Westen völlig unvorstellbar. Hatte ich doch selber Anfang der 80er in Hannover eine Kneipe besessen und wusste daher, wie das war. Traute sich damals wirklich mal jemand, in der Kneipe zu kiffen wurde der umgehend rausgeschmissen. Es konnte einen Wirt ganz schnell die Konzession kosten. Und man konnte auch nie wissen, ob nicht ein Zivilbulle anwesend war. Damals in Halle hat das niemanden interessiert. Dazu kam, dass der Normalbürger im Osten das alles auch gar nicht kannte. Nicht wusste, was Haschisch oder Marihuana ist, wie es aussieht, wie es riecht und wie es konsumiert wird.
Es war eine verrückte Zeit damals im Osten. Alles ging irgendwie. Man machte es einfach. So wie man zum Beispiel keine Angst zu haben brauchte, dass einen die früher so gefürchtete Volkspolizei anhielt und auf Alkohol kontrollierte. Die hatten so viel Angst davor, dass ihnen der Bürger etwas antat, das sie Kontrollen möglichst umgingen. Wenn man die ehemalige Volkspolizei, jetzt nur noch Polizei ohne Volk, doch mal sah, dann meist sogar zu dritt und so handzahm, dass es kaum zu glauben war. Ich denke, da zeigten sich immer noch die Nachwehen der Revolution von 1989, wo die Volkspolizei unter anderem beim Sturm auf die Stasizentralen, dem Druck des Volkes nachgegeben hatte. Seitdem herrschte eine tiefe Verunsicherung bei der Polizei. Und die Stasi war ohnehin, zumindest nach außen, völlig in der Versenkung verschwunden. Man hatte sie offiziell für aufgelöst erklärt und ohnehin hatte niemand für sie gearbeitet.
Zu der verrückten Zeit damals passte, was ich am nächsten Tag erlebte. Ich saß mit Eduard, beim Kaffee in der Küche und wir hörten DT 64, das ehemalige Jugendradio der DDR. Die machten jetzt die beste Musik und hatten obendrein tolle Beiträge. Heute ging es um ein Kuriosum. In Halle sollte das Fahnenmonument am Hansering angeblich nach Nordkorea verkauft werden. Die DDR war Geschichte und ihren Denkmälern blühte häufig das gleiche Schicksal, sprich: Sie wurden abgerissen. Es stellte sich ja wirklich die Frage, ob man hier in Halle noch an die Oktoberrevolution im fernen Russland erinnern musste. Nun war das ja mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft ohnehin so eine Sache. Zu DDR-Zeiten eher ein Kunstprodukt als gelebtes Miteinander hatte diese Freundschaft im Zuge von Glasnost eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und da passten sowohl die überall noch vorhandenen Lenindenkmäler wie auch die rote Fahne nicht mehr so recht ins Bild. Dazu kam, dass die siegreiche Sowjetarmee ihre Garnison in Halle ohnehin auflösen würde. Wozu dann noch die Fahne?
Also wurde in Halle bereits diskutiert, die Fahne abzureißen. Und vor diesem Hintergrund ging der Reporter von DT 64 mit seinem Aufnahmegerät los und befragte die halleschen Bürger, was sie denn davon hielten, dass die Fahne nach Nordkorea verkauft werden solle. Eduard und ich saßen in der Küche vor dem Radio und amüsierten uns köstlich. Wer sollte in der heutigen Zeit auch sonst so ein rotes Monstrum kaufen, außer Nordkorea.
»Was, nach Nordkorea?«, fragte ein Hallenser ungläubig ins Mikro des Reporters.
»Nur zu, weg mit dem Mist.«
»Was, die wollen die Fahne verkaufen? Nee, das geht ja gar nicht. Die gehört doch hierher.«
»Was, nach Nordkorea? Na, dafür haben die Kommunisten noch Geld.«
»Na klar, bloß weg damit.«
Die meisten der Befragten waren erst einmal völlig überrascht und die Meinungen gingen weit auseinander.
Wie es weiterging, erfuhren Eduard und ich nicht mehr, da sich die Küchentür öffnete und Horst hereinkam. Eigentlich war er gerade zum Termin aufgebrochen. Nun stand er völlig niedergeschlagen in der Tür und sah aus, als wenn er gleich losheulen würde. »Was ist denn mit dir passiert?«, wollten wir von ihm wissen. Ein Dachziegel wäre ihm auf das Autodach gekracht, erzählte er, was Eduard lauthals loslachen ließ.
»Was, dir ist ein Ziegel aufs Dach gefallen? Da hast du jetzt einen Dachschaden«, brüllte er los und schlug sich vor Lachen auf den Schenkel. Horst konnte darüber nicht lachen.
Wir überließen das Fahnenmonument seinem weiteren Schicksal und verließen die Wohnung, um uns Horsts Dachschaden anzusehen. Er hatte sein Auto wie so oft in der kleinen Seitenstraße neben einem alten, halbverfallenen, leer stehenden Haus geparkt. Solche Häuser waren in Halle eher die Regel als die Ausnahme und so dachten wir nicht über mögliche Risiken nach. Und irgendwo mussten wir ja schließlich auch parken. Horsts alter Passat hatte dort eine beträchtliche Delle abbekommen. Doch damit nicht genug. Durch die Federung des Blechs war er nicht liegen geblieben, sondern weiter auf den Kofferraumdeckel gehüpft. Auch dort hatte er eine stattliche Beule hinterlassen, bevor er abschließend auf das Straßenpflaster aufschlug und in zahllose rötliche Brocken zerschellte. Horst kämpfte sichtlich mit den Tränen.
»Na da kannst du ja froh sein kein richtiges Loch im Dach zu haben. Da regnet es ja sonst noch rein«, versuchte Eduard Horst vergeblich zu trösten. Darüber konnte Horst auch nicht lachen. Die Beule im Dach sollte ihm noch lange erhalten bleiben. Wen hätte er dafür haftbar machen sollen, wie einen potenziellen Eigentümer auftreiben? Die Eigentumsfrage dieses Gebäudes dürfte wahrscheinlich völlig ungeklärt sein, und bis sich dies einmal änderte, würden sicher noch etliche Ziegel, wenn nicht irgendwann das ganze Dach auf die Straße stürzen. Die einzige Lehre, die wir aus diesem Vorfall ziehen konnten, bestand darin, besser zu gucken, wo wir unser Auto abstellten.