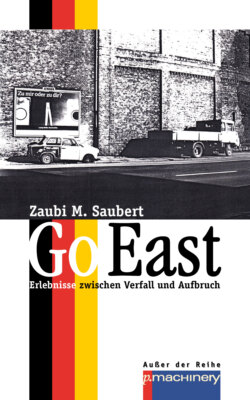Читать книгу GO EAST - Zaubi M. Saubert - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vier
ОглавлениеIn der Zweiraumwohnung in HaNeu zeichnete sich ein Problem ab. Anita plante, im Herbst zum Studieren nach Hannover zu ziehen, passenderweise zur Untermiete in Rolfs Wohnung. Und ihre dann frei werdende Wohnung wollte ihre Schwester übernehmen. Eine eigene Wohnung war damals, gerade für junge Menschen in der DDR, ein wahrer Schatz, an den man nicht so leicht herankam, und so war es völlig klar, dass Anitas Schwester ihre Wohnung beziehen wollte. Und die hatte natürlich keine Lust, die kleine Gruppe Untermieter, die sich inzwischen dort eingerichtet hatte, zu übernehmen. Rolf ließ dies ziemlich kalt, der hatte beschlossen, das Abenteuer DDR mit dem Untergang selbiger zu beenden und nach Hannover zurückzukehren. Aber was wurde aus Horst und mir?
Eine Wohnung musste umso dringender her. Wir hatten ja schon eine Menge Leute kennengelernt und unsere Finger ausgestreckt. Nun war es zu DDR-Zeiten fast schier unmöglich, eben mal eine Wohnung zu mieten. Allein schon, weil es keinen freien Wohnungsmarkt gab und der Großteil der Wohnungen genossenschaftlich organisiert war. Ein WG-Zimmer würde es ja auch schon tun. Aber so, wie ich das aus Hannover kannte, eben mal in die Tageszeitung oder in den »Heißen Draht« geschaut und angerufen, ging das hier nicht. Obwohl es offensichtlich genug freien Wohnraum gab. Es hatten schließlich seit der Grenzöffnung bereits viele Menschen Halle Hals über Kopf verlassen und waren in den Westen »rübergemacht«. Aber wie sollte man an diese Wohnungen rankommen?
In der DDR hieß das Zauberwort für die Chance auf eine Wohnungszuteilung: »Wohnberechtigungsschein«. Und so einer musste her. Ich beschloss daher, zum Magistrat der Stadt Halle und dort zur kommunalen Wohnungsverwaltung zu gehen, um einen solchen Schein zu beantragen. Unsere Freunde hatten mir schon gesagt, dass das nicht so einfach wäre, noch dazu war ich ja auch gar nicht in Halle gemeldet. Und dann noch als Wessi. Aber davon wollte ich nichts wissen und machte mich eines Vormittags guter Dinge auf den Weg zum Magistrat. Um auch einen guten Eindruck zu machen, hatte ich extra einen Anzug angezogen, was ich sonst privat nie machte.
Im Magistrat schlug mir schon beim Betreten des Gebäudes dieser typische, leicht stechende Geruch nach Reinigungsmittel und Ammoniak entgegen, der allen öffentlichen Gebäuden der DDR anhaftete und den ich mein ganzes Leben nicht vergessen werde. Nach einigem Suchen und Fragen kam ich schließlich vor dem entsprechenden Zimmer an, das die Vergabe der Wohnberechtigungsscheine bearbeitete. Davor warteten bereits etliche Leute geduldig auf alten, durchgewetzten Stahlrohrstühlen. Brav reihte ich mich in die Schlange der Wartenden ein, nahm auf einem freien Stuhl Platz und übte mich in Geduld. Nachdem der letzte Wartende, der vor mir an der Reihe gewesen war, bereits vor einer Weile herausgekommen und gegangen war, beschloss ich, doch einmal zu klopfen. Vielleicht hatte man ja übersehen, dass draußen noch jemand wartete.
Doch kaum hatte ich nach dem Klopfen die Tür geöffnet und mir erlaubt, den Kopf hineinzustecken, wurde ich von drinnen auch schon unmissverständlich angefahren, was ich denn wolle und man würde mich aufrufen. Also schloss ich die Tür hastig wieder und eilte über das alte, quietschende Linoleum zurück zu meinem Platz. Wenig später durfte ich tatsächlich eintreten. Hinter einem alten, vollgerümpelten Schreibtisch, schön unter dem Bild des großen Staatsratsvorsitzenden, saß eine blonde, füllige Frau Anfang fünfzig, mit weißer Bluse, und starrte mich feindselig an. Ihre grimmige Erscheinung wurde noch durch einen strengen Dutt unterstrichen. Ich musste unwillkürlich an Udo Lindenberg denken, »Das ist die Olga von der Wolga«, ging mir sein Lied durch den Kopf. Doch das Grinsen verkniff ich mir.
Was ich denn für ein Anliegen hätte, herrschte sie mich an. Als ich erzählte, dass ich aus Hannover käme und jetzt hier in Halle eine Wohnung suchte, konnte ich verfolgen, wie ihr langsam die Gesichtszüge entglitten. Dabei schwoll ihr ohnehin schon gewaltiger Busen noch weiter an. Ich bekam Angst, dass ihr gleich die Bluse platzen würde und mir die Knöpfe derselben um die Ohren flögen. In energischem Tonfall legte sie mir dann dar, dass Halle erstens eine Zuzugssperre hätte und zweitens, dass ich nicht Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sei und somit Ausländer. Und als Ausländer hätte ich ohnehin kein Recht auf Zuzug. So einfach ging das. Und damit war die Angelegenheit für sie erledigt.
Ehe ich mich versah, fand ich mich draußen auf dem Flur wieder. Kopfschüttelnd stand ich da und fühlte mich irgendwie wie frisch geföhnt. Hm, Ausländer, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Bislang war ich immer davon ausgegangen, dass es zwei deutsche Staaten gab, aber dass es sich bei allen Bürgern dieser Staaten um Deutsche handelte. Nun hatte sie mich eines Besseren belehrt. Ich war also sowohl Deutscher als auch Ausländer im anderen Teil von Deutschland. Jetzt guckte ich wirklich dumm und so schlich ich frustriert von dannen. Die Tage der DDR bis zur Wiedervereinigung waren zwar inzwischen gezählt, aber auch nach der Einheit würde man wohl nicht so ohne Weiteres eine Wohnung finden. Also mussten wir uns selber »drehen«, wie der Ossi sagte. Zum einen fragte ich meine neuen Mitarbeiter, ob sie nicht eine Wohnung für uns wüssten, und zum anderen hörten wir uns weiter bei unseren zahlreichen neuen Bekannten um. Und wurden schließlich fündig.
Walter, der alte Schulfreund meines Vaters und nun neuer Mitarbeiter von mir in Leipzig, verkündete bei einem Treffen, dass er eine Wohnung für Horst und mich hätte. Hm, in Leipzig? Aber interessiert fuhren wir trotzdem hin, um uns die Wohnung anzusehen. Der Euphorie folgte die Ernüchterung. Was hatte ich denn erwartet? Als gelernter Wessi hatte man so seine Vorstellungen. Aus meinen bisherigen Erfahrungen im Osten hätte ich aber wissen müssen, dass man hier Abstriche machen musste. Musste man wirklich. Es handelte sich um eine schmucklose Zweiraumwohnung, in einem schmucklosen grauen Altbau, im schmucklosen Leipziger Osten.
Vom Zustand sah die Wohnung gar nicht mal so schlecht aus. Hauptsächlich musste tapeziert werden. Das war noch das Wenigste. Ich sollte noch ganz andere Wohnungen zu sehen bekommen. Aber diese wirkte halt schon sehr ernüchternd. Lediglich zwei Kachelöfen, eine alte Spüle und ein Kohleherd standen hier auf altem abgetretenem Linoleum. Es gab auch ein Badezimmer mit einer Badewanne, die noch richtig auf eisernen Füßen stand, und dazu einen rustikalen Badeofen. Hatte ich lediglich zu Studienzeiten mal ein Zimmer mit einem Ölofen gehabt, so war mir diese Art der Heizung bislang erspart geblieben. Aber hier im Osten? Der Plattenbau wäre wohl die einzige Chance, dem Kohleofen zu entkommen.
Ich habe die Wohnung letztlich nicht genommen, aber aus einem ganz anderen Grund: Das Zentrum meiner beruflichen Aktivitäten lag bislang in Halle, wenngleich ich auch in Leipzig immer aktiver wurde. Die Überlegung bestand zwar, nach Leipzig zu expandieren, doch auf alle Fälle wollte ich meine Basis in Halle erst einmal festigen und ausbauen und dazu brauchte ich dort eine Wohnung und auch ein Büro. Eine Wohnung in Leipzig würde noch mehr Fahrerei bedeuten, was bei den damaligen Straßenverhältnissen im Osten kein wirkliches Vergnügen wäre.
Es kam einem Wunder gleich, dass wir noch im August sowohl zu einer Wohnung, als auch zu einem eigenen Büro kommen sollten. Über eine gewisse Karin hatte ich ihre Freundin Mia kennengelernt. Die meinte, bei ihr in der WG wären zwei Zimmer frei geworden. Horst und ich sollten doch mal vorbeikommen und uns die Zimmer anschauen, zentral, mitten in Halle in der Großen Ulrichstraße gelegen. Ja, super. Das wäre doch was, dachten Horst und ich voller Begeisterung. Wir verabredeten uns gleich für den übernächsten Tag.
Aufgeregt gingen wir also zwei Tage später pünktlich hin, diesmal ganz normal angezogen. Die Wohnung in der Großen Ulrichstraße 36 lag im zweiten Stock eines etwas heruntergekommenen Altbaus. Das Treppenhaus wirkte ziemlich gammelig und staubig. Der Blick aus den milchigen Fenstern ging im Hof auf hohe alte Ziegelwände, soweit das Auge reichte. Im ersten Stock verkündete ein Metallschild, dass hier die Kammer für Außenhandel der DDR residierte. Na, dann kann es so schlimm ja nicht sein, dachte ich. Im zweiten Stock trafen wir einen freundlich dreinschauenden, blonden jungen Mann, der gerade vor der Wohnungstür fegte, sich als Malte vorstellte und Bescheid wusste, dass wir kämen. Der Mitbewohner von Mia, die gar nicht da war.
»Jaja, die Zimmer sind frei, könnt ihr euch gerne anschauen. Ihr seid Wessis, nicht?«, fragte er uns entlarvend.
Die Wohnung entpuppte sich als ein ziemlicher Hammer. Sie war riesig. Ich habe sie später einmal auf etwa hundertfünfzig Quadratmeter geschätzt. Durch die hohe, zweiflügelige Eingangstür gelangte man auf einen bestimmt zehn Meter langen, geraden Flur. Raumhöhe, na, knappe vier Meter etwa. Zur Linken gingen drei Türen ab, nach rechts zwei große, doppelflügelige Türen und am Ende des Ganges befand sich noch eine große, ebenfalls doppelflügelige Kassettentür. Auffällig fand ich, dass der Fußboden des Flurs fast bis zur Hälfte mit großen, leeren Flaschen vollgestellt war. Bei den meisten handelte es sich um Weinflaschen.
Die freien Zimmer befanden sich hinter der Tür am Ende des Flurs. Das erste Zimmer war nicht besonders groß und mehr als die Hälfte davon nahm ein fast hüfthohes Podest ein, das mit einem knalligen, pinkfarbenen Teppichboden belegt war. Die Wände waren dazu passend in kräftigem Rosa gestrichen. Grässlich. Ein kleiner Kohleofen stand in der Ecke. Eine Wand zierte eine riesige Werner-Comicfigur, die kichernd auf einem Bierfass saß, mit einer weiteren Figur davor, die einen Regenschirm hochhielt, auf dem eine Lachmöwe hockte. Witzig, ein Werner hier im Osten. Der Ausblick aus dem Fenster ging in den Hinterhof und wirkte ziemlich ernüchternd. Nur alte, grau-rote Ziegelwände, kein Grün, kein Himmel. So stellte ich mir den Ausblick aus einem DDR-Gefängnis vor.
Eine große Flügeltür führte aus diesem Raum weiter in ein geräumiges Eckzimmer, das mit drei Fenstern auf die Große Ulrichstraße hinausging. Kam das erste Zimmer eher dunkel daher, so war dieses sehr groß und hell. Wer würde denn welches Zimmer bekommen, sofern wir hier überhaupt einziehen würden, fragte ich mich. Ich hatte die Wohnung aufgerissen und könnte daher das schönere Zimmer für mich beanspruchen und Horst ins Durchgangszimmer verbannen. Während ich noch darüber nachdachte, setzte draußen plötzlich ein Rumpeln und Knarren ein, das immer lauter wurde und in ein metallisches Quietschen überging. Gleichzeitig begann der Boden leicht zu vibrieren und zu zittern.
»Ach, das ist nur die Straßenbahn«, beschwichtigte Malte, als er unsere erschrockenen Gesichter sah. Das Geräusch erreichte seinen Höhepunkt und ebbte dann wieder ab. Es klang, als ob die Bahn mitten durch das Zimmer führe. Nöö, dann nehme ich doch das Durchgangszimmer, dachte ich gönnerhaft und hatte die Frage der Zimmerverteilung bereits für mich geklärt. Nun machte sich Malte auf, uns den Rest der Wohnung zu zeigen.
»Ja, das ist die Toilette«, verkündete er und öffnete die Tür. Wir blickten in einen Raum, etwa fünf Meter lang, fast genauso hoch, aber nur wenig mehr als einen Meter breit. Tapeziert mit einer leicht psychedelischen Tapete aus beige-braunen, ineinander gesetzten Herzen. Ein Affront für das Auge. Gleich am Eingang ragte ein altes, ziemlich versifftes, kleines Waschbecken aus der Wand und am anderen Ende des Raumes befand sich die Toilette unter einem schmalen Fenster. Passend zur orangefarbenen Toilettenbrille ragte daneben ein Toilettenpapierhalter im gleichen knalligen Farbton aus der Wand. Hm, wie anheimelnd. Design made in GDR.
Gegenüber dem Klo hatte Mia ihr Zimmer, verkündete Malte und steuerte auf die Tür neben dem Klo zu.
»Habt ihr das Bad extra?«, fragte Horst, als Malte die nächste Tür öffnete.
»Nee, nee, ein Bad haben wir leider gar nicht«, meinte er und gab den Blick in den nächsten Raum frei.
»Äh, ja, das ist unsere Rumpelkammer«, bemerkte er leicht verlegen.
Das traf es. Eine Rumpelkammer im wahrsten Sinne des Wortes. Das Zimmer war nicht klein, aber komplett knie- bis hüfthoch mit alten Sachen zugestellt. Ein Schrank, ein paar alte Stühle, Schachteln, Koffer, Kartons und tausend andere Dinge, bunt auf- und übereinandergestapelt. Weiter als bis in den Türrahmen kam man erst gar nicht hinein.
Die Küche gestaltete sich wiederum anders originell. Zunächst eine Küchenzeile Marke »DDR einfach« auf der rechten Seite und ein dazu gehörender Besenschrank, ein Sideboard und ein Tisch mit vier Stühlen auf der Linken. Die Wände waren mit einer inzwischen nikotinfarbenen Papiertapete bekleidet, die nur partiell Kontakt zum darunter liegenden Putz zu haben schien. Dafür hatte man sie aber großflächig, mit im Wesentlichen schwarzer Wachsmalkreide, künstlerisch verziert. Über einem ausziehbaren alten Waschtisch, auf dem sich ein Berg Geschirr stapelte, prangte ein vermeintliches Plakat der CDU, das verkündete »Wir machen die meisten Schulden, Ihre CDU«. Von der Decke baumelte eine nackte Glühbirne.
»Cool«, entfuhr es Horst.
»Na ja«, dachte ich.
Weiter ging es mit der Wohnungsbesichtigung. Malte zeigte uns das »Wohnzimmer« und sein Zimmer, was von diesem abging. Das Wohnzimmer war ebenfalls ziemlich geräumig, mit drei Flügeltüren und zwei Fenstern zur Straße. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch mit vier Stühlen. Holzleisten auf Stahlrahmen, die klassischen DDR-Gartenmöbel. Irgendwie kamen die mir bekannt vor und ich musste an meinen letzten Besuch auf dem Markt denken. Auf meine Nachfrage räumte Malte tatsächlich ein, dass die einmal vor einer Gaststätte auf dem Markt gestanden hätten. Und von dort wären sie in einer nächtlichen Aktion hierher gelangt. Näher hat er das dann nicht erläutert. Aha.
Wenig später saßen wir drei in der Küche und Malte kochte Kaffee. Dazu spülte er aus dem Berg benutzten Geschirrs drei Becher ab, füllte in jeden Kaffeepulver und übergoss dieses schließlich mit heißem Wasser. Türkisch halt, wie es hier im Osten weit verbreitet war. Wie uns denn die Wohnung gefalle, wollte er dann wissen.
»Na ja, es müsste mal wieder etwas sauber gemacht werden«, räumte er noch ein. Horst meinte mal wieder »Cool«.
Ich war mir da nicht so sicher, ob ich hier einziehen wollte. Was die Zimmer denn kosten sollten, fragte ich.
»Nischt«, antwortete Malte in unverwechselbarem halleschem Dialekt, worauf wir ihn fragend anguckten.
»Ja, hm, das ist so«, setzte er etwas unsicher an, »das ist eine Schwarzwohnung. Wisst Ihr, was das ist?«
»Klar, cool«, kommentierte Horst.
Im Westen hätte man gesagt eine besetzte Wohnung. Da hätten dann Transparente mit schwarzem Stern und Anarcho-A aus dem Fenster gehangen und so weiter. Hier war davon nichts zu sehen. Es machte einen völlig unpolitischen Eindruck.
Ich wusste, dass es solche Häuser gab, wo das ganze Gebäude oder einzelne Wohnungen besetzt waren, im DDR-Jargon sogenannte Schwarzwohnungen. Meist befanden sie sich in mehr oder weniger sanierungsbedürftigen Altbauten und die Bewohner waren junge Leute. Der Staat und die Wohnungsgenossenschaften duldeten dies in den meisten Fällen und bemühten sich, dass die Angelegenheit nicht bekannt wurde. Es wäre ja auch peinlich gewesen, wenn sich der Staat auf der einen Seite mit dem Kampf der Hausbesetzer in West-Berlin solidarisierte und auf der anderen Seite einräumen musste, dass man mit dem gleichen Problem im eigenen Staat zu kämpfen hatte.
Gab es auf der einen Seite Wohnungsmangel in der DDR, so standen auf der anderen Seite viele Altbauten leer. Die Menschen versuchten eine Wohnung in den neuen Plattenbausiedlungen zu bekommen, weil diese einen deutlich höheren Komfort zu bieten hatten. Dort gab es Fernheizung, warmes Wasser, Aufzug, Müllschlucker und oft sogar Telefon. Beliebt waren auch die sogenannten Altneubauten – welch ein Begriff –, meist viergeschossige Mietshäuser, die nach dem Krieg hochgezogen worden waren.
Dagegen verfielen die Altbauten. Den Genossenschaften fehlte es an Geld und Baumaterial, um diese oft wunderschöne alte Bausubstanz halbwegs in Schuss zu halten. So drückten sie oft beide Augen zu, wenn sich junge Leute einfach eine Wohnung oder ein ganzes leer stehendes Haus aneigneten. Diese nicht legalen Bewohner kümmerten sich zumindest etwas um den Erhalt dieser Häuser und bewahrten sie so oft vor dem endgültigen Verfall. Denn spätestens, wenn im Winter der Frost in ein leer stehendes Haus kroch und die erste Wasserleitung platzen ließ, entstand immenser Schaden, der schnell das ganze Gebäude unbewohnbar machen konnte.
Und wir? Konnten wir als seriöse Finanzkaufleute in eine Schwarzwohnung einziehen? Was würden unsere Kunden und Mitarbeiter dazu sagen, wenn sie dies erfahren würden? Doch wir hatten keine Wahl. Anita hatte uns unmissverständlich klar gemacht, dass wir in Kürze aus ihrer Wohnung raus müssten. Alternativen waren weit und breit nicht zu sehen. Da bliebe nur ein Hotel und das wäre teuer. Also, was tun? Irgendwann würden wir schon was Richtiges finden, aber wann? Nach kurzem Überlegen entschieden wir uns dazu, einzuziehen, nachdem Malte vorher bereits signalisiert hatte, er hätte nichts dagegen und Mia sicher auch nicht.
Er erzählte uns, dass er schon über ein Jahr hier wohne und Mia sogar noch länger. Keiner von beiden kannte die Vormieter oder hatte jemals Kontakt mit dem Eigentümer der Wohnung gehabt. Doch in der Wohnung drüber, ebenfalls einer Schwarzwohnung, wohne der Ralf und der würde die ursprüngliche Mieterin seiner Wohnung kennen. Die hätte auch schon vor Längerem »rübergemacht« und in ihrer Wohnung würden jetzt übrigens auch zwei Wessis wohnen. Bevor wir uns verabschiedeten, fiel mir noch ein, nach den Nebenkosten für Strom und Gas zu fragen.
»Auch nischt«, antwortete Malte kichernd. Da hätte sich noch nie jemand gemeldet. Und in der Wohnung oben, die hätten sogar Telefon. Da würde er manchmal hochgehen, wenn er zu Hause bei seinen Eltern anrufen wolle. Verrückt. Wir verabredeten den Einzug zum Wochenende und verließen, um eine Erfahrung reicher, gut gelaunt unsere zukünftige neue Bleibe.
Am 19. August 1990 bezogen Horst und ich unser neues Domizil. Viel brachten wir nicht mit. Horst zog mit seiner Luftmatratze und einer Reisetasche ein. Ich hatte mir zumindest eine gescheite Matratze aus Hannover eingepackt und meinen stummen Diener, der dafür sorgte, dass die Bügelfalte meines Anzugs immer korrekt saß. Wir freuten uns beide wie die Schneekönige, endlich eine richtige Bleibe zu haben, auch wenn die nicht ganz offiziell war. Gemeinsam mit Mia, Malte und etlichen Flaschen halleschen Meisterbräus feierten wir dies abends in der Küche.
Dabei erfuhren wir auch, wo der große Fleck über dem Herd herrührte. Im Gegensatz zu den übrigen Wänden der Küche wies dieser Bereich keine »künstlerischen Verzierungen« auf. Stattdessen prangte, etwa einen halben Meter unter der Decke, ein großer, unappetitlicher Fleck, der in Streifen auf der ohnehin schon nicht mehr taufrischen Tapete nach unten verlief. Mia meinte, der Klaus, unser Vormieter, hätte sie einmal so geärgert, dass sie mit einem Ei nach ihm geworfen hätte. Und offenbar hatte sie nicht getroffen, denn das Ei war eindeutig gegen die Wand geflogen, zerplatzt und auf der Tapete heruntergelaufen. Und scheinbar hielt es auch niemand für nötig, die Sauerei wieder wegzumachen. So entstand dieser unschöne Fleck auf der Wand. Na ja, das eine will man, das andere muss man, sagte ich mir.