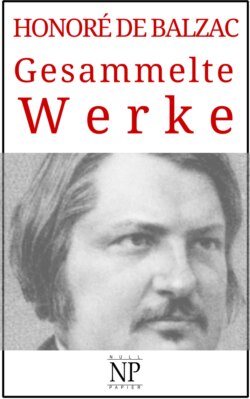Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 15
5
ОглавлениеWas Frau Konstanze anlangt, so war sie damals siebenunddreißig Jahre alt und glich vollkommen der Venus von Milo, so daß alle, die sie kannten, in ihr das Abbild jener schönen Statue sahen, als der Herzog von Rivière diese nach Paris gebracht hatte. Aber in wenigen Monaten färbte dann der Kummer die blendende Weiße ihres Teints gelb und runzelte und schwärzte den bläulichen Kreis, aus dem ihre schönen grünlichen Augen hervorstrahlten, so grausam, daß sie das Ansehen einer alten Madonna bekam; denn sie bewahrte sich selbst mitten in ihrem Elend ihre anmutige Unberührtheit, ihren reinen, wenn auch traurigen Blick, und man mußte sie immer noch als eine schöne Frau von zurückhaltendem, dezentem Wesen ansehen. Bei dem von Cäsar geplanten Balle sollte sie zum letztenmal sich des allgemein auffallenden Glanzes ihrer Schönheit zu erfreuen haben.
Eine jede Existenz hat ihren Höhepunkt, die Zeit, da die wirksamen Ursachen genau im richtigen Verhältnis zu den erzielten Resultaten stehen. Dieser Mittag des Lebens, wo die lebendigen Kräfte sich im Gleichgewicht halten und ihre volle Macht zeigen, ist nicht allein allen Lebewesen, sondern auch den Städten, den Nationen, den Ideen, den Institutionen, dem Handel und den Unternehmungen gemeinsam, die ähnlich wie edle Rassen und Dynastien entstehen, in die Höhe kommen und zu Boden sinken. Woher rührt die Gewalt, mit der dieses Wesen des Aufstiegs und Niedergangs allem Organischen hienieden anhaftet? Selbst der Tod hat in Pestzeiten sein Ansteigen, sein Abschwellen, sein Wiederausbrechen und sein Einschlafen. Unsere Erde selbst ist vielleicht nur eine etwas dauerhaftere Leuchtkugel als andere. Die Geschichte, die die Ursachen von Größe und Niedergang aller Dinge hienieden erzählt, könnte dem Menschen den Moment anzeigen, da er mit der Entfaltung aller seiner Kräfte innehalten sollte; aber weder die Eroberer, noch die Schauspieler, noch die Frauen, noch die Schriftsteller hören auf ihre warnende Stimme.
Cäsar Birotteau, der hätte fühlen müssen, daß er den Höhepunkt seines Glücks erreicht habe, betrachtete diesen Ruhepunkt nur wie ein neues Sprungbrett. Er begriff nicht, was übrigens weder die Völker noch die Könige in unverwischbaren Lettern aufzuzeichnen versucht haben, die Ursache dieser Umschwünge, von denen die Geschichte voll ist, und von denen die souveränen und die Handelshäuser so gewaltige Beispiele darbieten. Warum können nicht neue Pyramiden immerfort diesen Grundsatz, der die Politik der Völker wie des einzelnen beherrschen sollte, wiederholen: »Wenn die Wirkung nicht mehr in richtiger Beziehung und in gleichem Verhältnis zur Ursache steht, dann beginnt die Auflösung?« Aber diese Monumente sind ja überall vorhanden, es sind die Überlieferungen und die Steine, die zu uns von der Vergangenheit reden, die die Launen des unentrinnbaren Geschicks bestätigen, dessen Hand unsere Träume vernichtet und uns beweist, daß die schwerwiegendsten Ereignisse sich auf einen Grundgedanken zurückführen lassen. Troja und Napoleon sind beides nur Gedichte. Möge diese Erzählung das Gedicht der bürgerlichen Umschwünge sein, derer noch keine Stimme gedacht hat, obwohl sie mit demselben Recht ungeheure genannt werden können; es handelt sich hier nicht um einen einzelnen Menschen, sondern um ein ganzes leidendes Volk.
Beim Einschlafen fürchtete Cäsar, daß seine Frau ihm am andern Morgen noch entscheidende Einwürfe machen würde, und nahm sich vor, sehr früh aufzustehen, um alles zum Abschluß zubringen. Mit Tagesgrauen verließ er daher das Bett, zog sich schnell an und ging in den Laden hinunter, als der Hausknecht die numerierten Fensterläden abnahm. Da Birotteau allein war, wartete er, bis seine Kommis aufgestanden waren, stellte sich an die Türschwelle und paßte auf, wie der Hausknecht Raguet seine Arbeit tat, und Birotteau verstand sich auf solche Arbeit! Trotz der Kälte war das Wetter herrlich.
»Popinot, nimm deinen Hut, zieh dir Schuhe an und rufe Herrn Cölestin herunter; wir beide wollen in den Tuilerien miteinander reden«, sagte er, als er Anselm herunterkommen sah.
Popinot, dieses ausgesprochene Gegenstück zu du Tillet, den einer jener glücklichen Zufälle, die an eine Spezialvorsehung glauben lassen, Cäsar zur Seite gestellt hatte, spielt eine so wichtige Rolle in dieser Erzählung, daß es nötig ist, ihn hier genauer zu zeichnen. Frau Ragon war eine geborene Popinot. Sie hatte zwei Brüder. Der eine, das jüngste Kind, war damals Hilfsrichter am Seinetribunal erster Instanz. Der Ältere hatte einen Handel mit roher Wolle angefangen, dabei sein Vermögen zugesetzt und war gestorben, indem er den Ragons und seinem Bruder, dem Richter, der kinderlos war, seinen einzigen Sohn zur Versorgung hinterließ, der schon bei seiner Geburt die Mutter verloren hatte. Um ihren Neffen einem Beruf zuzuwenden, hatte Frau Ragon ihn in das Parfümeriegeschäft gebracht, in der Hoffnung, daß er einmal der Nachfolger Birotteaus werden würde. Anselm Popinot war klein und hatte einen Klumpfuß, ein Gebrechen, das das Geschick auch Lord Byron, Walter Scott und Herrn von Talleyrand hat zuteil werden lassen, um die andern damit Behafteten zu trösten. Er hatte den blühenden, sommersprossigen Teint der Rothaarigen; aber seine reine Stirn, seine Augen von der Farbe graugeäderten Achats, sein hübscher Mund, die Reinheit und Grazie keuscher Jugend, die Ängstlichkeit, die er seines körperlichen Gebrechens halber empfand, trugen ihm hilfreiche Sympathien ein: man beweist gern den Schwachen Liebe. Popinot interessierte. Der kleine Popinot, wie ihn alle Welt nannte, gehörte zu einer streng religiösen Familie, in der die Tugenden aus Einsicht geübt wurden, und deren Leben bescheiden und reich an guten Taten war. So zeigte auch das von seinem Onkel, dem Richter, erzogene Kind alle jene Eigenschaften, die die Jugend so schön erscheinen lassen: keusch und liebevoll, etwas schüchtern, aber voller Eifer, sanft wie ein Lamm, aber fleißig bei der Arbeit, hingebend und mäßig, besaß er alle Tugenden eines Christen aus den ersten Zeiten der Kirche.
Als er von einem Spaziergang nach den Tuilerien reden hörte, dem ungewöhnlichsten Vorschlage, den zu solcher Stunde sein erhabener Chef machen konnte, glaubte Popinot, daß dieser mit ihm vom Heiraten reden wollte, und dachte sofort an Cäsarine, die wahre Königin der Rosen, das lebende Wahrzeichen des Hauses, in die er sich an demselben Tage, an dem er, zwei Monate vor du Tillet, bei Birotteau eingetreten war, verliebt hatte. Beim Hinaufgehen mußte er stehen bleiben, so sehr schwoll ihm und so stark schlug ihm das Herz; bald kam er mit Cölestin, dem ersten Kommis Birotteaus, zurück. Anselm und sein Chef gingen nun, ohne ein Wort zu reden, nach den Tuilerien. Popinot war jetzt einundzwanzig Jahr alt, in welchem Alter sich auch Birotteau verheiratet hatte. Anselm sah daher hierin kein Hindernis für seine Heirat mit Cäsarine, obgleich das Vermögen des Parfümhändlers und die Schönheit des Mädchens der Verwirklichung so ehrgeiziger Wünsche sehr bedenklich entgegenstanden; aber die Liebe wiegt sich gern in den größten Hoffnungen und je ausschweifender sie sind, um so mehr glaubt sie an ihre Verwirklichung; je ferner daher seine Geliebte ihm zu stehen schien, desto lebhafter begehrte er sie. Glückliches Kind, das in einer Zeit der allgemeinen Gleichmacherei, wo alle dieselben Hüte tragen, noch eine Distanz zwischen einem Parfümhändler und sich, dem Nachkommen einer alten Pariser Familie, anerkennen zu müssen glaubte! Aber trotz aller Zweifel, aller Unruhe war er glücklich; er saß ja alle Tage bei Tisch neben Cäsarine! In der Art, wie er sich den Geschäften des Hauses widmete, bewies er einen Eifer und eine Begeisterung, die der Arbeit jede Bitterkeit nahmen; da er alles für Cäsarine tat, war er niemals müde. Bei einem Jüngling von zwanzig Jahren lebt die Liebe von der Hingebung.
»Der wird mal ein richtiger Kaufmann, der kommt in die Höhe«, hatte Cäsar von ihm zu Frau Ragon gesagt, als er Anselms Tüchtigkeit im Fabrikgeschäft und sein Verständnis für die Finessen der Kunst rühmte und seinen Arbeitseifer beim Expedieren erwähnte, wo der Hinkende mit aufgekrempelten Ärmeln und bloßen Armen mehr Kisten packte und zunagelte als die übrigen Kommis.
Die bekannte und kundgegebene Bewerbung Alexander Crottats, des ersten Notariatsschreibers bei Roguin, das Vermögen seines Vaters, eines reichen Pächters aus der Brie, legten dem Siege des Verwaisten starke Hindernisse in den Weg; aber das waren nicht die stärksten Schwierigkeiten, die zu überwinden waren; Popinot trug tief im Herzen noch ein trauriges Geheimnis begraben, das die Entfernung zwischen Cäsarine und ihm noch vergrößerte. das Vermögen der Ragons, auf das er hätte rechnen können, war stark erschüttert; er war glücklich, zu ihrem Lebensunterhalt mit beitragen zu können, indem er ihnen sein bescheidenes Gehalt überließ. Und trotz alledem glaubte er an seinen Erfolg! Mehrmals hatte er Blicke aufgefangen, die Cäsarine mit offenbarem Stolz auf ihn geworfen hatte: in der Tiefe ihrer blauen Augen hatte er eine heimliche Regung voll süßer Hoffnungen lesen zu können gemeint. So schritt er dahin, erregt von seiner augenblicklichen Hoffnung, zitternd, schweigsam und tief bewegt, gleich all den Jünglingen in ähnlicher Lage, für die das Leben noch im Aufblühen ist.
»Popinot,« sagte endlich der Kaufmann zu ihm, »geht es deiner Tante gut?«
»Jawohl, Herr Birotteau.«
»Sie erscheint mir aber seit einiger Zeit so sorgenvoll, gibt es etwas, das sie bedrückt? Höre, mein Sohn, du brauchst vor mir nicht den Geheimnisvollen zu spielen, ich gehöre doch gewissermaßen zur Familie, es sind jetzt fünfundzwanzig Jahre, daß ich deinen Onkel Ragon kenne. Ich bin zu ihm mit eisenbeschlagenen Schuhen von meinem Dorfe hergekommen. Obgleich dieser Ort Les Trésorierès heißt, bestand mein ganzes Vermögen aus einem Louisdor, den mir meine Patin geschenkt hatte, die selige Frau Marquise d’Uxelles, eine Verwandte des Herrn Herzogs und der Frau Herzogin von Lenoncourt, die unsre Kunden sind. Dafür habe ich auch jeden Sonntag für sie und ihre ganze Familie gebetet; wir schicken in die Touraine an ihre Nichte, die Frau von Mortsauf, alle ihre Parfümerien. Ich bekomme immer neue Kundschaft durch sie, zum Beispiel den Herrn von Vandenesse, der jährlich für zwölfhundert Franken kauft. Wenn man ihnen nicht schon von Herzen dankbar wäre, so müßte man es aus Berechnung sein. Dir aber bin ich ohne jeden Hintergedanken gut und um deiner selbst willen.«
»Ach, Herr Birotteau, Sie haben, wenn ich mir erlauben darf, Ihnen so etwas zu sagen, einen höllischen Kopf.«
»Nein, mein Junge, nein, damit allein hätte ich es nicht geschafft. Ich will nicht behaupten, daß ich nicht einen ebenso guten Kopf hätte wie andere, aber ich besaß auch noch Ehrlichkeit, so wahr Gott lebt, ich verstand, mich zu benehmen, und ich habe nie eine andere Frau geliebt als meine. Und die Liebe, die ist ein großartiges Vehikel, ein sehr glücklicher Ausdruck, den gestern Herr von Villèle auf der Tribüne gebraucht hat.«
»Die Liebe!« sagte Popinot. »Ach, Herr Birotteau, sollte ich …«
»Sieh mal, da kommt der alte Roguin zu Fuß dort hinten von der Place Louis XV., früh um acht Uhr. Was macht der Mann denn hier?« sagte Cäsar und vergaß Anselm Popinot und das Nußöl vollständig.
Er erinnerte sich an den Verdacht seiner Frau, und statt in den Garten der Tuilerien hineinzugehen, schritt Birotteau auf den Notar zu. Anselm folgte seinem Prinzipal in einiger Entfernung, ohne sich erklären zu können, welches Interesse dieser an einer anscheinend so unwichtigen Sache haben könnte; aber er war glücklich, weil er in dem, was Cäsar über seine eisenbeschlagenen Schuhe, seinen Louisdor und die Liebe gesagt hatte, eine Ermutigung sah.
Roguin, ein großer dicker Mann mit finnigem Gesicht, sehr weit hinaufreichender Stirn und schwarzem Haar, hatte früher kein übles Äußeres; jung und hochstrebend, hatte er sich vom kleinen Schreiber bis zum Notar hinaufgearbeitet; aber jetzt zeigte sein Gesicht dem scharfen Beobachter deutlich die verzerrenden und erschlaffenden Spuren raffinierter Genüsse. Wenn ein Mann in den Schlamm geschlechtlicher Exzesse taucht, wird man fast immer etwas von diesem Schlamm an irgendeiner Stelle seines Antlitzes finden; so hatte auch bei Roguin die Zeichnung der Falten und die Gesichtsfärbung einen gemeinen Ausdruck bekommen. An Stelle des reinen Glanzes, der unter der Haut enthaltsamer Männer hervorleuchtet und eine blühende Gesundheit anzeigt, verriet sich bei diesem das unreine, von Gelüsten, gegen die der Körper sich wehrt, aufgepeitschte Blut. Er hatte eine widerwärtig aufgestülpte Nase, wie man sie bei Leuten findet, bei denen der Schleim, wenn er dieses Organ durchzieht, ein verstecktes Übel verursacht, das eine tugendhafte französische Königin naiv für ein dem andern Geschlecht gemeinsames Übel hielt, da sie andern Männern als dem Könige niemals nahe genug gekommen war, um ihren Irrtum zu erkennen. Roguin hatte gehofft, durch starkes Schnupfen von Spaniol diese Unannehmlichkeit verbergen zu können, aber er hatte damit die nachteiligen Folgen nur verschlimmert, die die Hauptursache seines Unglücks wurden.
Ist es nicht eine soziale Beschönigung, die schon allzu lange gedauert hat, wenn die Menschen immer wieder mit falschen Farben abgebildet und die wahren Ursachen ihrer Laster nicht enthüllt werden, die so häufig in einer Krankheit wurzeln? Die Sittenschilderer haben bis jetzt wohl allzusehr unterlassen, das physische Übel in seinen Verheerungen auf moralischem Gebiet und in seinem Einfluß auf den ganzen Mechanismus des Lebens darzustellen. Das Geheimnis dieser Ehe hatte Frau Konstanze richtig erkannt.
Seit ihrer Hochzeitsnacht hatte die reizende einzige Tochter des Bankiers Chevrel gegen den armen Notar eine unüberwindliche Abneigung gefaßt und wollte sich sofort scheiden lassen. Da Roguin das Glück des Besitzes einer Frau mit einem Vermögen von fünfhunderttausend Franken, nicht gerechnet, was sie noch zu erwarten hatte, nicht fahren lassen wollte, so hatte er seine Frau angefleht, die Scheidungsklage nicht anzustrengen, indem er ihr völlige Freiheit zusagte und sich allen Konsequenzen dieses Versprechens unterwarf. Frau Roguin benahm sich nun als unumschränkte Herrin gegen ihren Mann, wie eine Kurtisane gegen einen alten Liebhaber. Roguin merkte bald, daß ihm seine Frau zu teuer wurde, und schaffte sich, wie viele Pariser Ehemänner, einen zweiten Haushalt in der Stadt an. Da sich die Ausgabe dafür anfangs in mäßigen Grenzen hielt, so kam sie nicht sehr in Betracht.
Zunächst fand Roguin ohne große Kosten Grisetten, die sehr glücklich waren, daß er sie protegierte; aber seit drei Jahren wurde er von einer jener unbezähmbaren Leidenschaften verzehrt, von denen Männer zwischen fünfzig und sechzig Jahren manchmal befallen werden und die ihm von einem der entzückendsten Wesen dieser Zeit eingeflößt wurde, die in den Annalen der Prostitution unter dem Namen der schönen Holländerin bekannt wurde, als sie in den Abgrund versank und ihr Tod sie berühmt machte. Sie war einst von einem Klienten Roguins von Brüssel nach Paris gebracht worden, der sie, als er infolge der politischen Ereignisse genötigt war, sich zu entfernen, im Jahre 1815 an Roguin abtrat. Der Notar hatte seiner Schönen ein kleines Haus in den Champs-Elysées gekauft, es reich möbliert und sich zu immer weiteren Ausgaben hinreißen lassen, ohne die kostspieligen Launen dieses Weibes befriedigen zu können, dessen Verschwendung sein Vermögen aufzehrte.
Das bedrückte Gesicht Roguins, das sich erst aufhellte, als er seinen Klienten erblickte, hing mit geheimnisvollen Ereignissen zusammen, die den verborgenen Grund von du Tillets so schnell erworbenem Vermögen bildeten. Du Tillets ursprünglicher Plan wurde schon am ersten Sonntag geändert, als er das Verhältnis zwischen Herrn und Frau Roguin beobachten konnte. Er war zu Birotteau gegangen, weniger um seine Frau zu verführen, als um sich Cäsarines Hand als Entschädigung für eine zurückgedrängte Leidenschaft anbieten zu lassen; aber es wurde ihm um so leichter, auf diese Heirat zu verzichten, als er Cäsar für reich gehalten hatte und ihn nur mäßig begütert fand. Nun spionierte er den Notar aus, wußte sich in sein Vertrauen einzuschleichen, ließ sich der schönen Holländerin vorstellen, bekam heraus, wie sie mit Roguin stand und daß sie damit drohte, ihren Liebhaber zu verabschieden, wenn er ihr ihren Luxus beschneiden wollte. Die schöne Holländerin war eins jener tollen Weiber, die sich niemals darum kümmern, woher das Geld kommt und wie es erworben ist, und die mit den Talern eines Vatermörders ein Fest geben würden. Niemals dachte sie am Abend an den nächsten Tag. Die Zukunft bedeutete für sie soviel wie der Nachmittag, und das Ende des Monats soviel wie die Ewigkeit, selbst wenn sie Rechnungen zu bezahlen hatte. Entzückt darüber, daß ihm hier zuerst die Gelegenheit sich bot, den Hebel ansetzen zu können, begann du Tillet damit, die schöne Holländerin dazu zu bringen, daß sie sich mit dreißig-, statt mit fünfzigtausend Franken, die ihr Roguin gab, begnügte: ein Dienst, den verliebte Greise nur selten zu vergessen pflegen. Schließlich schüttete Roguin nach einem stark mit Wein begossenen Souper du Tillet sein Herz über seine bedrängten finanziellen Verhältnisse aus. Sein Grundbesitz war mit der gesetzlichen Hypothek seiner Frau belastet, und seine Leidenschaft hatte ihn dazu geführt, von den bei ihm hinterlegten Fonds seiner Klienten einen Betrag zu entnehmen, der schon mehr als die Hälfte des Wertes seines Notariats betrug. Wenn der Rest auch noch verschlungen sein würde, dann müsse er, der unglückliche Roguin, sich erschießen, denn so meinte er den Abscheu über einen solchen Bankerott durch das dadurch erregte öffentliche Mitleid mildern zu können. Hierbei sah du Tillet, wie einen Strahl in der Nacht der Trunkenheit, die Möglichkeit aufblitzen, rasch zu einem Vermögen zu kommen; er beruhigte Roguin und erwiderte dessen vertrauliches Bekenntnis mit dem Rat, sich das Erschießen zu ersparen. – »Wenn ein Mann von Ihren Fähigkeiten soweit gekommen ist, dann darf er sich nicht töricht und unsicher herumtappend benehmen, sondern er muß mit Kühnheit vorgehen«, sagte er zu ihm; er riet ihm, sofort noch einen erheblichen Betrag zu entnehmen und ihn ihm anzuvertrauen, um damit irgendein gewagtes Geschäft zu unternehmen, sei es an der Börse, oder bei irgendeiner andern Spekulation und den tausend Möglichkeiten, die sich damals boten. Hätten sie Glück damit, so wollten sie beide ein Bankhaus gründen, das aus den Depots Nutzen ziehen könnte, und dessen Überschüsse ihm zur Befriedigung seiner Leidenschaft dienen würden. Hätten sie aber Pech, dann sollte Roguin ins Ausland fliehen, anstatt sich zu erschießen; »sein« du Tillet würde bis zum letzten Sou treu zu ihm halten. Das war ein Rettungsseil für einen Mann, der am Ertrinken ist, und Roguin merkte nicht, daß der Parfümeriekommis ihm dieses Seil um den Hals schlang.