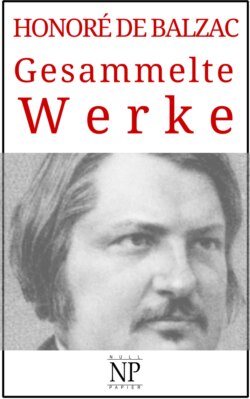Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 8
Оглавление»Vorwärts, du Deputierter der Mitte, immer vorwärts! Wir müssen eilig weiter, wenn wir zusammen mit den andern bei Tisch sein wollen. Heb die Beine! Spring, Marquis! Hierher! So ist’s gut! Sie springen über die Gräben wie ein richtiger Hirsch!«
Diese Worte wurden von einem friedlich am Waldesrande von Ile-Adam sitzenden Jäger gesprochen, der eine Havannazigarre zu Ende rauchte und auf seinen Genossen wartete, der jedenfalls schon seit langem in dem Buschwerk des Waldes herumgeirrt war. An seiner Seite sahen vier jappende Hunde ebenso wie er die Person, an die er sich wandte, an. Um zu verstehen, wie spöttisch diese Anreden, die mit Pausen wiederholt wurden, gemeint waren, muß erwähnt werden, daß der Jäger ein dicker kurzer Mann war, dessen hervorstehender Bauch eine wahrhaft ministerielle Fettleibigkeit verriet. Mühselig übersprang er die Furchen eines großen, frisch abgeernteten Feldes, dessen Stoppeln sichtlich sein Vorwärtskommen hinderten; um sein Unbehagen noch zu steigern, trieben die Sonnenstrahlen, die sein Gesicht schräg trafen, dicke Schweißtropfen darauf hervor. Bemüht, sein Gleichgewicht zu bewahren, wankte er bald nach vorn, bald nach rückwärts und ahmte so die Sprünge eines stark geschüttelten Wagens nach. Es war einer der Septembertage, wo die Weintrauben bei südlicher Glut reifen. Die Luft kündigte ein Gewitter an. Obgleich sich mehrfach große Strecken blauen Himmels noch am Horizont von dicken schwarzen Wolken abhoben, sah man doch einen blassen Dunst mit erschreckender Schnelligkeit vordringen, der sich von Westen nach Osten ausbreitete wie ein leichter grauer Vorhang. Der Wind bewegte sich nur in den oberen Regionen der Luft, die Atmosphäre drückte nach unten hin die glühenden Ausdünnungen der Erde zusammen. Heiß und schweigend schien der Wald zu dürsten. Die Vögel und Insekten waren verstummt, die Wipfel der Bäume rührten sich kaum. Diejenigen, die noch eine Erinnerung an den Sommer 1819 haben, müssen also Mitleid empfinden mit den Leiden des armen Deputierten, der Blut und Wasser schwitzte, um seinen boshaften Gefährten wieder zu erreichen. Während er seine Zigarre rauchte, hatte dieser aus der Stellung der Sonne berechnet, daß es etwa fünf Uhr nachmittags sein müsse.
»Wo zum Teufel sind wir denn? sagte der dicke Jäger, während er sich die Stirn abtrocknete und sich an einen Baumstamm, fast gegenüber seinem Gefährten, stützte, denn er verspürte nicht mehr die Kraft in sich, den breiten Graben, der ihn von ihm trennte, zu überspringen.
»Und das fragst du mich? antwortete lachend der Jäger, der sich in dem hohen gelben Grase gelagert hatte, das den Abhang bekrönte. Er warf den Rest seiner Zigarre in den Graben und rief: »Ich schwöre bei Sankt Hubertus, daß man mich nicht wieder dabei erwischen wird, wie ich mich in unbekannter Gegend mit einer Amtsperson herumtreibe, und wärst du es selbst, mein lieber d’Albon, ein alter Schulkamerad!«
»Aber Philipp, verstehst du denn nicht mehr Französisch? Du hast jedenfalls deinen Geist in Sibirien gelassen«, entgegnete der dicke Mann und warf einen komischen Schmerzensblick auf einen Pfosten, der hundert Schritte davon sich erhob.
»Ich verstehe«, erwiderte Philipp, nahm seine Flinte, erhob sich plötzlich, sprang mit einem einzigen Satz in das Feld hinüber und eilte zu dem Pfosten hin. »Hierher, d’Albon, hierher! Halblinks!« rief er seinem Gefährten zu und zeigte ihm mit einer Handbewegung einen breiten gepflasterten Weg. »Von Baillet nach Ile-Adam« fuhr er fort; »dann werden wir also in dieser Richtung den Weg nach Cassan finden, der sich von dem nach Ile-Adam abzweigen muß.
»Das stimmt, mein lieber Oberst , sagte Herr d’Albon und setzte seine Mütze, mit der er sich Luft zugefächelt hatte, wieder auf den Kopf.
»Also vorwärts, mein verehrungswürdiger Rat, erwiderte der Oberst Philipp und pfiff den Hunden, die ihm schon besser zu gehorchen schienen als dem Beamten, dem sie gehörten.
»Wissen Sie, mein Herr Marquis,« begann der Offizier spottend, »daß wir noch mehr als zwei Meilen vor uns haben? Das Dorf, das wir dort unten sehen, muß Baillet sein.
»Großer Gott!« rief der Marquis d’Albon aus, »gehen Sie nach Cassan, wenn Ihnen das Vergnügen macht, aber Sie werden dann ganz allein gehen. Ich ziehe vor, hier trotz des Gewitters ein Pferd abzuwarten, das Sie mir aus dem Schloß schicken werden. Sie haben sich über mich mokiert, Sucy. Wir hätten einen netten kleinen Jagdausflug machen, uns nicht von Cassan entfernen, die Terrains, die ich kenne, absuchen sollen. Na, anstatt daß wir unsern Spaß dabei haben, lassen Sie mich wie einen Jagdhund seit vier Uhr morgens laufen, und wir haben als ganzes Frühstück nur zwei Tassen Milch gehabt! Ach, wenn Sie jemals einen Prozeß bei Gericht haben sollten, dann werde ich Sie ihn verlieren lassen, wenn Sie auch hundertmal Recht hätten!«
Und mutlos setzte sich der Jäger auf einen der Steine am Fuße des Pfostens, legte seine Flinte und seine leere Jagdtasche ab und stieß einen langen Seufzer aus.
»So sind deine Deputierten, Frankreich!« rief der Oberst von Sucy lachend. »Ach, mein armer Albon, wenn Sie, wie ich, sechs Jahre tief in Sibirien gewesen wären! …
Er vollendete den Satz nicht und blickte zum Himmel auf, als ob seine Leiden ein Geheimnis zwischen Gott und ihm wären.
»Vorwärts! Weiter!« fügte er hinzu. »Wenn Sie hier sitzen bleiben, sind Sie verloren.«
»Was wollen Sie, Philipp? Das ist so eine alte Gewohnheit bei einem Beamten! Auf Ehre, ich bin vollkommen erschöpft! Wenn ich wenigstens noch einen Hasen geschossen hätte!«
Die beiden Jäger boten einen seltenen Gegensatz dar. Der Deputierte war ein Mann von zweiundvierzig Jahren und schien nicht älter als dreißig zu sein, während der dreißigjährige Offizier wenigstens vierzig alt zu sein schien. Beide trugen die rote Rosette, das Abzeichen der Offiziere der Ehrenlegion. Etliche Locken, schwarz und weiß wie der Flügel einer Elster, stahlen sich unter der Jagdmütze des Obersten hervor; schöne blonde Haarwellen schmückten die Schläfen des Richters. Der eine war von hohem Wuchs, mager, schlank, nervös, und die Runzeln seines weißen Gesichts deuteten auf furchtbare Leidenschaften oder schreckliche Leiden; der andere besaß ein von Gesundheit strahlendes Gesicht mit dem jovialen, eines Epikuräers würdigen Ausdruck. Beide waren stark von der Sonne verbrannt, und ihre hohen Wildledergamaschen trugen die Merkmale aller Gräben und Sümpfe, die sie passiert hatten, an sich.
»Los!« rief Herr de Sucy, »vorwärts! In einer kleinen Stunde werden wir an einem gut besetzten Tisch sitzen.«
»Sie können niemals geliebt haben,« erwiderte der Rat mit einem komischen Ausdruck von Mitleid, »denn Sie sind so unerbittlich wie der Artikel 304 des Strafgesetzbuchs!«
Ein heftiges Zittern überfiel Philipp; seine breite Stirn runzelte sich; sein Gesicht wurde ebenso düster, wie es der Himmel jetzt geworden war. Obgleich die Erinnerung an ein furchtbar bitteres Erlebnis alle seine Züge verzerrte, vergoß er keine Träne. Wie alle starken Männer vermochte er seine Aufregungen tief im Herzen zu begraben und empfand vielleicht, wie viele reine Seelen, eine Art Schamlosigkeit dabei, seine Schmerzen bloszulegen, wenn kein menschliches Wort ihre Tiefe ausdrücken kann und man den Spott der Leute fürchtet, die sie nicht verliehen wollen. Herr d’Albon war eine von den zartfühlenden Seelen, die Schmerzen zu ahnen wissen und ein lebhaftes Mitgefühl empfinden, wenn sie unbeabsichtigt durch irgendeine Ungeschicklichkeit Anstoß erregt haben. Er achtete das Schweigen seines Freundes, erhob sich, vergaß seine Müdigkeit und folgte ihm schweigend, ganz betrübt darüber, eine Wunde berührt zu haben, die wahrscheinlich nicht vernarbt war.
»Eines Tages, lieber Freund,« sagte Philipp zu ihm und drückte ihm die Hand, wobei er ihm mit einem herzzerreißenden Blick für sein stummes Mitgefühl dankte, »eines Tages werde ich dir mein Leben erzählen. Heute vermöchte ich es nicht.«
Schweigend setzten sie ihren Weg fort. Als der Schmerz des Obersten sich besänftigt hatte, empfand der Rat seine Müdigkeit wieder; und mit dem Instinkt oder vielmehr mit dem Willen eines erschöpften Mannes durchforschte sein Auge alle Tiefen des Waldes; er prüfte die Wipfel der Bäume, studierte die Wege, in der Hoffnung, irgendeine Herberge zu finden, wo er um Gastfreundschaft bitten konnte. An einem Kreuzweg angelangt, glaubte er einen leichten Rauch zu entdecken, der zwischen den Bäumen aufstieg. Er blieb stehen, sah aufmerksam hin und erkannte inmitten einer riesigen Baumgruppe die grünen dunklen Zweige etlicher Fichten. »Ein Haus! Ein Haus!« rief er mit demselben Vergnügen, mit dem ein Schiffer gerufen hätte: » Land, Land!«
Dann eilte er schnell durch eine dichte Baumgruppe, und der Oberst, der in eine tiefe Träumerei versunken war, folgte ihm mechanisch.
»Ich will mich lieber hier mit einer Omelette, Hausbrot und einem Stuhl begnügen, als nach Cassan weitergehen, um dort Diwans, Trüffeln und Bordeauxwein zu finden.«
Das war der begeisterte Ausruf des Rates beim Anblick einer Mauer, deren weißliche Farbe sich weithin von der braunen Masse der knorrigen Stämme des Waldes abhob.
»Ei, ei! Das sieht mir aus wie irgendeine alte Priorei«, rief der Marquis d’Albon von neuem, als er vor einem alten schwarzen Gitter anlangte, wo er inmitten eines ziemlich weiten Parks ein Bauwerk erblickte, das in dem einstmals den Klosterbauten eigentümlichen Stil errichtet war. »Wie diese Kerls von Mönchen es verstanden haben, eine Baustelle auszuwählen!« Dieser neue Ausruf war der Ausdruck des Erstaunens, das dem Beamten die schöne Einsiedelei verursachte, die sich seinen Blicken darbot. Das Haus lag halbseits auf dem Abhang des Berges, dessen Gipfel von dem Dorfe Nerville eingenommen wird. Die großen hundertjährigen Eichen des Waldes, der einen riesigen Kreis um diese Behausung zog, machten daraus eine richtige Einsiedelei. Der einst für die Mönche bestimmte Hauptflügel lag gegen Süden. Der Park schien vierzig Morgen zu umfassen. Nahe bei dem Hause breitete sich eine grüne Wiese aus, die in glücklicher Weise von mehreren klaren Bächen und von geschickt angebrachten Wasserfällen durchflossen war, all das anscheinend ohne Anwendung von Kunst. Hier und da erhoben sich grüne Bäume von eleganten Formen mit verschiedenartigem Laub. Dann gaben da geschickt ausgesparte Grotten, mächtige Terrassen mit beschädigten Treppen und rostigen Geländern dieser wilden Thebais einen besonderen Ausdruck. Die Kunst hatte gefällig ihre Bauten mit den malerischen Wirkungen der Natur vereinigt. Die menschlichen Leidenschaften schienen am Fuß der großen Bäume sterben zu müssen, die dieses Asyl vor dem Heranströmen des Lärms der Welt verteidigten, wie sie die Glut der Sonne mäßigten.
»Was für ein Verfall!« sagte sich Herr d’Albon, nachdem er den düsteren Ausdruck empfunden hatte, den die Ruinen der Landschaft verliehen, die wie mit einem Fluch geschlagen erschien. Es war wie ein von den Menschen verlassener verwünschter Ort. Der Efeu hatte überall seine gewundenen Ranken und seinen reichen Blättermantel ausgebreitet. Braunes, grünes, gelbes oder rotes Moos überzog mit seiner romantischen Färbung Bäume, Bänke, Dächer und Steine. Die wurmstichigen Fenster waren vom Regen verwaschen und vom Wetter durchlöchert, die Balkone zerbrochen, die Terrassen zerstört. Manche Jalousien hielten nur noch an einem Haken. Die nicht schließenden Türen schienen keinem Angreifer standhalten zu können. Behangen mit leuchtenden Tuffs von Misteln, breiteten sich die ungepflegten Äste der Fruchtbäume weithin aus, ohne eine Ernte zu geben. Hochgewachsenes Kraut überwucherte die Alleen. Diese Reste gaben dem Bilde den Ausdruck reizvoller Poesie und erregten in der Seele des Beschauers träumerische Gedanken. Ein Dichter wäre hier in lange währende Melancholie versunken, voller Bewunderung für diese harmonische Unordnung, für dieses reizvolle Bild der Zerstörung. In diesem Moment erglänzten einige Sonnenstrahlen mitten durch die Lücken der Wolken und beleuchteten mit tausend Farben diese halb wilde Szene. Die braunen Dachziegel erstrahlten, das Moos leuchtete, phantastische Schatten huschten über die Wiesen unter den Bäumen hin; die erstorbenen Farben lebten wieder auf, eigenartige Gegensätze machten sich geltend, das Blattwerk hob sich scharf in der Helligkeit ab. Plötzlich verschwand das Licht. Die Landschaft, die gesprochen zu haben schien, wurde stumm und wieder düster, oder vielmehr matt wie der matteste Schimmer eines Herbstnebels.
»Das ist Dornröschens Schloß,« sagte sich der Rat, der das Haus nur noch mit den Augen des Eigentümers ansah. »Wem mag es nur gehören? Man muß sehr töricht sein, wenn man einen so hübschen Besitz nicht bewohnt!«
Plötzlich sprang eine Frau unter einem rechts vom Gitter stehenden Nußbaum hervor und huschte, ohne Geräusch zu machen, so schnell wie der Schatten einer Wolke bei dem Rat vorbei; diese Erscheinung machte ihn stumm vor Staunen.
»Nun, d’Albon, was haben Sie?« fragte ihn der Oberst.
»Ich reibe mir die Augen, um zu wissen, ob ich schlafe oder wache«, antwortete der Beamte und drückte sich an das Gitter, um zu versuchen, das Phantom nochmals zu erblicken.
»Sie ist jetzt wahrscheinlich unter dem Feigenbaum«, sagte er und zeigte Philipp die Blattkrone eines Baumes, der links vom Gitter über der Mauer emporragte.
»Wer denn, sie?«
»Ja, kann ich das wissen?« entgegnete Herr d’Albon. »Eben hat sich hier vor mir eine fremdartige Frauengestalt erhoben«, sagte er leise; »sie schien mir mehr dem Reich der Schatten als der Welt der Lebenden anzugehören. Sie erscheint so schlank, so leicht, so luftartig, daß sie durchsichtig sein muß. Ihr Gesicht ist weiß wie Milch. Ihre Kleidung, ihre Augen, ihre Haare sind schwarz. Sie hat mich im Vorbeikommen angeblickt, und obgleich ich nicht furchtsam bin, hat ihr unbeweglicher kalter Blick mir das Blut in den Adern erstarren lassen.«
»Ist sie hübsch?« fragte Philipp.
»Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Augen in ihrem Gesicht gesehen.«
»Also zum Teufel mit unserm Diner in Cassan!« rief der Oberst, »bleiben wir hier. Ich habe eine kindische Lust, in diese eigenartige Besitzung hineinzugehen. Siehst du diese rotgemalten Fenstereinfassungen und diese roten, auf das Gesims der Türen und Fensterläden gemalten Streifen? Scheint das dir nicht das Haus des Teufels zu sein? Er wird es vielleicht von den Mönchen geerbt haben. Vorwärts! Eilen wir hinter der schwarzweißen Dame her! Vorwärts!« rief Philipp mit gemachter Lustigkeit.
In diesem Augenblick hörten die beiden Jäger einen Schrei, der dem einer in der Falle gefangenen Maus ziemlich ähnlich war. Sie horchten. Das Geräusch der gestreiften Blätter einiger Büsche machte sich in dem Schweigen bemerkbar, wie das Gemurmel einer erregten Welle; aber obgleich sie angestrengt lauschten, um weitere Töne zu hören, blieb die Erde still und bewahrte das Geheimnis der Schritte der Unbekannten, wenn sie überhaupt welche gemacht hatte.
»Das ist seltsam«, rief Philipp und verfolgte die Linie, die die Mauer des Parks beschrieb.
Die beiden Freunde gelangten bald zu einer Allee des Waldes, die nach dem Dorfe Chauvry führte. Nachdem sie den Weg auf der Straße nach Paris zurückgegangen waren, befanden sie sich vor einem großen Gitter und erblickten nun die Hauptfassade der geheimnisvollen Behausung. Von dieser Seite erschien die Zerstörung auf ihrem Gipfel: ungeheure Risse durchfurchten die drei Flügel dieses rechtwinklig errichteten Bauwerks. Trümmer von Ziegeln und Schieferplatten waren auf der Erde angehäuft, und zerstörte Dächer zeigten eine vollkommene Unbekümmertheit an. Etliche Früchte waren unter den Bäumen abgefallen und verfaulten, ohne daß jemand sie aufsammelte. Eine Kuh ging quer über den Grasplatz und schnupperte in den Beeten herum, während eine Ziege die grünen Beeren und Ranken eines Weinstocks kaute.
»Hier ist alles in Übereinstimmung, und die Unordnung ist gewissermaßen organisiert«, sagte der Oberst und zog an der Schnur einer Glocke; aber die Glocke hatte keinen Klöpfel.
Die beiden Jäger hörten nur den eigenartigen scharfen Ton eines verrosteten Glockenzuges. Obgleich sehr verfallen, widerstand die kleine Tür in der Mauer doch jedem Druck.
»Ei, ei! Alles macht einen hier neugierig«, sagte er zu seinem Gefährten.
»Wenn ich kein Beamter wäre,« antwortete d’Albon, »würde ich das schwarze Weib für eine Hexe halten.«
Kaum hatte er diesen Satz beendet, als die Kuh an das Gitter kam und ihnen ihre warme Schnauze hinhielt, als ob sie das Bedürfnis fühlte, menschliche Wesen zu sehen. Jetzt wurde ein Weib sichtbar, falls man das unbeschreibbare Wesen, das sich unter einer Gruppe von Sträuchern erhob, mit diesem Namen bezeichnen kann, und zog die Kuh am Stricke. Die Frau hatte auf dem Kopfe ein rotes Tuch, aus dem blonde Flechten hervorsahen, die dem Hanf an der Spindel ziemlich ähnlich waren. Sie war ohne Halstuch. Ein Unterrock aus grober Wolle, abwechselnd schwarz und grau gestreift, der um einige Handbreit zu kurz war, ließ ihre Beine sehen. Man hätte glauben können, daß sie zu einem Stamme von Coopers berühmten Rothäuten gehörte, denn ihre Beine, ihr Hals und ihre nackten Arme schienen mit Ziegelfarbe angemalt zu sein. Kein Strahl von Intelligenz belebte ihr glattes Gesicht. Ihre bläulichen Augen waren ohne Wärme und ohne Glanz. Einige weiße dünne Haare deuteten Augenbrauen an. Ihr Mund endlich war so geschnitten, daß er schlecht gewachsene Zähne sehen ließ, die aber so weiß wie die eines Hundes waren.
»Halt da, Frau!« rief Herr de Sucy.
Sie kam langsam bis ans Gitter heran und betrachtete mit stumpfsinnigem Gesicht die beiden Jäger, bei deren Anblick ihr ein schmerzliches, gezwungenes Lächeln entschlüpfte.
»Wo sind wir denn? Was ist das für ein Haus? Wem gehört es? Wer sind Sie? Sind Sie von hier?«
Auf diese Fragen und eine Menge anderer, die die beiden Freunde nacheinander an sie richteten, antwortete sie nur mit einem aus der Kehle kommenden Knurren, das eher einem Tier als einem menschlichen Wesen zu gehören schien.
»Sehen Sie nicht, daß sie taub und stumm ist? sagte der Richter.
»Bons-Hommes!« rief die Bäuerin.
»Ah, sie hat recht! Dies könnte wohl das alte Kloster Bons-Hommes sein«, sagte Herr d’Albon.
Die Fragen begannen von neuem. Aber wie ein eigenwilliges Kind wurde die Bäuerin rot, spielte mit ihrem Pantoffel, drehte an dem Strick der Kuh, die wieder abzuweiden begonnen hatte, sah sich die beiden Jäger an und prüfte alle Teile ihres Anzugs; sie kreischte, sie knurrte, sie gluckste, aber sie brachte kein Wort heraus.
»Wie heißt du?« sagte Philipp und sah sie fest an, als wollte er sie hypnotisieren.
»Genovefa«, sagte sie mit einem dummen Lachen.
»Bis jetzt ist die Kuh die intelligenteste Kreatur, die wir hier gesehen haben«, rief der Rat. »Ich werde einen Schuß abfeuern, damit Leute kommen.«
Gerade als d’Albon seine Waffe ergriff, hielt ihn der Oberst mit einer Geste zurück und zeigte mit dem Finger auf die Unbekannte, die ihre Neugierde so lebhaft erregt hatte. Die Frau schien in tiefes Nachdenken versunken und kam mit langsamen Schritten aus einer ziemlich entfernten Allee, so daß die beiden Freunde Zeit hatten, sie genau zu betrachten. Sie war mit einem ganz abgetragenen schwarzen Seidenrock bekleidet. Ihre langen Haare fielen in zahlreichen Wellen über ihre Stirn, um ihre Schultern und reichten bis unter ihre Taille hinab, indem sie ihr als Schal dienten. An diese Unordnung offenbar gewöhnt, schob sie nur selten ihr Haar von beiden Schläfen hinweg; dann aber schüttelte sie das Haupt mit jäher Bewegung und brauchte sich nicht zweimal zu bemühen, um ihre Stirn oder ihre Augen von dem dicken Schleier zu befreien. Ihre Geste zeigte übrigens wie bei einem Tier die bewunderungswürdige mechanische Sicherheit, deren Schnelligkeit bei einer Frau wie ein Wunder erscheinen mußte. Die beiden Jäger sahen sie erstaunt auf einen Ast des Apfelbaums springen und sich hier mit der Leichtigkeit eines Vogels festhalten. Sie griff nach den Früchten, verspeiste sie, dann ließ sie sich mit zierlicher Lässigkeit, wie man sie an den Eichhörnchen bewundert, zur Erde fallen. Ihre Glieder besaßen eine Elastizität, die ihren geringsten Bewegungen jeden Anschein von Mühe oder Anstrengung nahm. Sie spielte auf dem Rasen, kugelte sich dort wie ein Kind herum; dann streckte sie plötzlich ihre Füße und Hände aus und blieb ausgebreitet auf der Wiese mit der Unbekümmertheit, der Grazie und der Natürlichkeit einer jungen Katze liegen, die in der Sonne eingeschlafen ist. Als der Donner in der Ferne grollte, wandte sie sich plötzlich und stellte sich mit bewundernswerter Geschicklichkeit auf alle viere wie ein Hund, der einen Fremden kommen hört. Durch diese merkwürdige Haltung schied sich ihr schwarzes Haar sogleich in zwei breite Flechten zu jeder Seite ihres Kopfes und erlaubte den beiden Zuschauern bei dieser seltsamen Szene ihre Schultern zu bewundern, deren weiße Haut wie die Gänseblümchen auf der Wiese leuchteten, und einen Hals, dessen Vollkommenheit auf all das übrige Ebenmaß ihres Körpers schließen ließ.
Sie ließ einen Schmerzensschrei hören und stellte sich ganz auf ihre Füße. Ihre Bewegungen folgten einander so graziös und wurden so leicht ausgeführt, daß sie kein menschliches Wesen, sondern eine der durch die Dichtungen Ossians berühmt gewordenen Töchter der Luft zu sein schien. Sie ging an eine der Wasserflächen heran, schüttelte leicht ein Bein, um ihren Schuh loszumachen, und schien ein Vergnügen daran zu finden, ihren alabasterweißen Fuß in die Quelle zu tauchen, während sie sich jedenfalls an den Wellenbewegungen ergötzte, die sie dabei erzeugte und die Edelsteinen glichen. Dann kniete sie an dem Rande des Bassins nieder und amüsierte sich wie ein Kind damit, ihre langen Flechten ins Wasser zu tauchen und sie dann schnell wieder herauszuziehen, um Tropfen für Tropfen das Wasser, von denen es voll war, hinablaufen zu lassen, das, von den Sonnenstrahlen durchleuchtet, einen förmlichen Rosenkranz von Perlen bildete.
»Das Weib ist irrsinnig!« rief der Rat aus.
Ein rauher Schrei, den Genovefa ausstieß, wurde laut und schien sich an die Unbekannte zu richten, die sich schnell umwandte und ihr Haar von beiden Seiten ihres Gesichtes wegstrich. In diesem Moment konnten der Oberst und d’Albon deutlich die Züge der Frau erkennen, die, als sie die beiden Freunde bemerkte, in mehreren Sprüngen mit der Leichtigkeit einer Hirschkuh auf das Gitter zueilte. »Adieu!« sagte sie mit sanfter, wohlklingender Stimme, aber ohne daß dieser, ungeduldig von den Jägern erwartete melodiöse Ton das geringste Empfinden oder das geringste Denken verriet.
Herr d’Albon bewunderte die langen Wimpern ihrer Augen, ihre schwarzen dichten Augenbrauen und ihre blendend weiße Haut ohne den geringsten Schimmer von Röte. Feine blaue Adern durchzogen allein ihren weißen Teint. Als der Rat sich umwandte, um seinem Freunde mitzuteilen, welches Erstaunen ihm der Anblick dieses seltsamen Weibes eingeflößt hatte, sah er diesen wie tot auf dem Grase liegen. Herr d’Albon schoß sein Gewehr in die Luft ab, um Leute herbeizurufen und schrie: »Zu Hilfe!« während er versuchte, den Obersten aufzurichten. Bei dem Knall des Schusses floh die Unbekannte, die bis dahin unbeweglich verharrt hatte, pfeilschnell davon, stieß Schreckensschreie wie ein verwundetes Tier aus und rannte über die Wiese mit allen Zeichen tiefsten Schreckens. Herr d’Albon vernahm das Heranrollen einer Kalesche auf der Landstraße von Ile-Adam und rief den Beistand der Spazierenfahrenden durch Winken mit seinem Taschentuch herbei. Sogleich lenkte der Wagen nach Bons-Hommes ein, und d’Albon erkannte Herrn und Frau von Grandville, seine Nachbarn, die sich beeilten, aus ihrem Wagen zu steigen und ihn dem Rat anzubieten. Frau von Grandville hatte zufälligerweise ein Flakon mit ätherischem Salz bei sich, das man Herrn de Sucy einatmen ließ. Als der Oberst die Augen wieder öffnete, wandte er sie der Wiese zu, auf der die Unbekannte nicht aufhörte zu rennen und zu schreien, und stieß einen undeutlichen Ruf aus, der aber doch eine Empfindung von Schrecken verriet; dann schloß er von neuem die Augen und machte eine Bewegung, als wolle er seinen Freund bitten, ihn diesem Schauspiel zu entreißen. Herr und Frau von Grandville überließen dem Rat die freie Verfügung über ihren Wagen, indem sie ihm entgegenkommenderweise erklärten, daß sie ihre Promenade zu Fuß fortsetzen wollten.
»Wer ist denn diese Dame?« fragte der Rat und zeigte auf die Unbekannte.
»Man vermutet, daß sie aus Moulins kommt«, antwortete Herr von Grandville. »Sie nennt sich Gräfin von Vandières. Man sagt, sie sei irrsinnig; aber da sie sich erst seit zwei Monaten hier aufhält, kann ich Ihnen nicht dafür einstehen, inwieweit alle diese Gerüchte auf Wahrheit beruhen.«
Herr d’Albon dankte Herrn und Frau de Grandville und fuhr nach Cassan.
»Sie ist es!« rief Philipp, als er wieder zum Bewußtsein gekommen war.
»Wer, sie?« fragte d’Albon.
»Stephanie. Ach, tot oder lebend, lebendig oder irrsinnig! Ich glaubte, ich müsse sterben.«
Der vorsichtige Rat, der die schwere Krisis begriff, in die sein Freund ganz verfallen war, hütete sich wohl, ihn auszufragen oder aufzuregen; es verlangte ihn ungeduldig danach, ins Schloß zu gelangen, denn die Veränderung, die in den Zügen und in der ganzen Persönlichkeit des Obersten sich geltend machte, ließ ihn befürchten, daß die Gräfin Philipp mit ihrer schrecklichen Krankheit angesteckt habe.
Sobald der Wagen die Einfahrt nach Ile-Adam erreicht hatte, schickte d’Albon den Diener zum Arzte des Fleckens; das geschah so, daß der Doktor sich schon an seinem Lager befand, als der Oberst zu Bett gebracht wurde.
»Wäre der Herr Oberst nicht fast nüchtern gewesen,« sagte der Chirurg, »so wäre er gestorben. Seine Mattigkeit hat ihn gerettet.«
Nachdem er die ersten Vorsichtsmaßregeln angeordnet hatte, entfernte sich der Doktor, um selbst einen beruhigenden Trank zu bereiten. Am andern Morgen befand sich Herr de Sucy besser, aber der Arzt wünschte selber, bei ihm zu bleiben.
»Ich muß Ihnen gestehen, Herr Marquis,« sagte der Doktor zu Herrn d’Albon, »daß ich an eine Verletzung des Gehirns geglaubt habe. Herr de Sucy ist das Opfer einer sehr heftigen Erregung geworden: seine Leidenschaftlichkeit ist schnell entflammt; aber bei ihm entscheidet sich alles auf den ersten Schlag. Morgen wird er vielleicht schon außer Gefahr sein.«
Der Arzt hatte sich nicht getäuscht; am andern Morgen erlaubte er dem Rat, seinen Freund wiederzusehen.
»Mein lieber d’Albon,« sagte Philipp und drückte ihm die Hand, »ich erwarte einen Dienst von dir! Eile schnell nach Bons-Hommes! Erkundige dich nach allem, was die Dame betrifft, die wir gesehen haben, und komm schnell zurück, denn ich zähle die Minuten.«
Herr d’Albon sprang auf ein Pferd und galoppierte nach der alten Abtei. Als er ankam, bemerkte er vor dem Gitter einen großen hageren Mann mit einnehmendem Gesicht, der bejahend antwortete, als der Rat ihn fragte, ob er dieses zerstörte Haus bewohne. Herr d’Albon teilte ihm den Grund seines Besuches mit.
»Wie, mein Herr,« rief der Unbekannte, »sollten Sie es gewesen sein, der den verhängnisvollen Flintenschuß hat losgehen lassen? Sie hätten beinahe meine arme Kranke getötet.«
»Oh, mein Herr, ich habe in die Luft geschossen.«
»Sie hätten der Frau Gräfin weniger Leid angetan, wenn Sie sie getroffen hätten.«
»Nun, wir haben uns nichts vorzuwerfen; denn der Anblick Ihrer Gräfin hat meinen Freund, Herrn de Sucy, beinahe getötet.«
»Sollte das der Baron Philipp de Sucy sein?« rief der Unbekannte und preßte die Hände zusammen. »War er in Rußland bei dem Übergang über die Beresina?«
»Jawohl,« erwiderte d’Albon; »er wurde von den Kosaken gefangen und nach Sibirien gebracht, von wo er erst vor etwa elf Monaten zurückgekehrt ist.«
»Kommen Sie herein, mein Herr«, sagte der Unbekannte und führte den Rat in einen im Erdgeschoß der Wohnung belegenen Salon, wo alles die Zeichen einer launenhaften Zerstörung zeigte.
Kostbare Porzellanvasen standen zerbrochen neben einer Kaminuhr, deren Gehäuse unberührt war. Die seidenen, an den Fenstern angebrachten Vorhänge waren zerrissen, während der doppelte Musselinvorhang unberührt war.
»Sie sehen«, sagte er beim Eintreten zu Herrn d’Albon, »die Zerstörungen, die das entzückende Wesen, dem ich mich gewidmet habe, verübt hat. Sie ist meine Nichte; trotz der Ohnmacht meiner Kunst hoffe ich, ihr eines Tages den Verstand wiedergeben zu können, indem ich eine Kur anwende, die unglücklicherweise nur den Reichen gestattet ist.« Dann erzählte er, wie alle Personen, die einsam leben und immer wieder an ihrem Schmerze zehren, dem Rat eingehend das nachfolgende Abenteuer, dessen Darstellung hier zusammengefaßt und von zahlreichen Abschweifungen, die der Erzähler und der Rat machten, befreit ist.
»Als er gegen neun Uhr abends die Höhen von Studzianka verließ, die er am 28. November 1812 während des ganzen Tages verteidigt hatte, ließ der Marschall Victor hier etwa tausend Mann zurück mit dem Befehl, bis zum letzten Augenblick diejenige der beiden Brücken über die Beresina zu decken, die noch standhielt. Diese Nachhut hatte sich aufgeopfert, um zu versuchen, eine furchtbare Menge von vor Frost erstarrten Nachzüglern zu retten, die sich hartnäckig weigerten, den Train der Armee im Stich zu lassen. Der Heroismus dieser edelmütigen Truppe sollte vergeblich sein. Die Soldaten, die in Massen den Ufern der Beresina zuströmten, fanden hier unglücklicherweise eine Riesenmenge von Wagen, Kasten und Möbelstücken jeder Art vor, die die Armee genötigt war, im Stiche zu lassen, als sie während des 27. und 28. November ihren Marsch ausführte. Als Erben unerwarteter Reichtümer brachten sich diese von der Kälte erstarrten Unglücklichen in den leeren Zelten unter, zerbrachen das dem Heer gehörige Material, um sich Hütten daraus zu bauen, machten Feuer an mit allem, was ihnen in die Hände fiel, zerlegten die Pferdekörper, um sich zu ernähren, zerrissen das Tuch und den Stoff der Wagen, um sich zu bedecken, und schliefen dann, anstatt ihren Marsch fortzusetzen und in Ruhe während der Nacht die Beresina zu überschreiten, die ein unglaubliches Verhängnis der Armee schon so verderblich gemacht hatte. Die Willenlosigkeit dieser armen Soldaten kann nur von denen begriffen werden, die sich erinnern werden, wie sie diese riesigen Schneewüsten durchwandert haben, ohne anderes Getränk als Schnee, ohne ein anderes Bett als Schnee, ohne einen andern Ausblick als auf einen Horizont von Schnee, ohne eine andere Nahrung als Schnee oder einige erfrorene Rüben und etliche Handvoll Mehl oder Pferdefleisch. Halbtot vor Hunger, Durst, Müdigkeit und Schlafsucht, langten die Unglücklichen an einem Ufer an, wo sie Holz, Feuer, Lebensmittel, unzählige verlassene Fuhrwerke und Zelte vorfanden, kurz eine ganze improvisierte Stadt. Das Dorf Studzianka war völlig zerlegt, verteilt und von den Höhen in die Ebene hinabgebracht worden. Wie kläglich und gefährlich diese Stadt war, ihr Elend und ihr Jammer lachten die Leute an, die nur die schrecklichen Wüsten Rußlands vor sich sahen. Es war nur ein ungeheures Krankenhaus, dem keine zwanzig Stunden Existenz beschieden waren. Die Mattigkeit ihrer Lebenskräfte oder das Gefühl eines unerwarteten Wohlbehagens ließ in dieser Menschenmasse keinen anderen Gedanken aufkommen als den der Ruhe. Obgleich die Artillerie des linken russischen Flügels ohne Unterlaß auf diese Menge schoß, die sich als ein großer, bald dunkler, bald flammender Fleck mitten auf dem Schnee abzeichnete, war der unermüdliche Kugelregen für die erstarrte Masse nur eine Unannehmlichkeit mehr. Es war wie ein Unwetter, dessen Blitze von aller Welt gering geschätzt wurden, weil sie hier oder dort nur auf Sterbende, Kranke oder vielleicht schon Tote trafen. Jeden Augenblick trafen Nachzügler in Gruppen ein. Diese Arten wandelnder Kadaver verteilten sich sogleich und bettelten von Herd zu Herd um einen Platz; dann, meistens zurückgetrieben, vereinigten sie sich von neuem, um mit Gewalt die verweigerte Gastfreundschaft zu erzwingen. Taub gegen die Stimmen etlicher Offiziere, die ihnen den Tod für den nächsten Tag voraussagten, verbrauchten sie das für das Überschreiten des Flusses erforderliche Quantum von Mut, um sich ein Asyl für die Nacht herzustellen und eine häufig verhängnisvolle Mahlzeit zu sich zu nehmen; der Tod, der sie erwartete, schien ihnen kein Unglück mehr zu sein, da er ihnen eine Stunde Schlaf vergönnte. Mit ›Unglück‹ bezeichneten sie nur den Hunger, den Durst, die Kälte. Wenn sie kein Holz, kein Feuer, keine Kleidung, kein Obdach fanden, entspannen sich fürchterliche Kämpfe zwischen denen, die von allem entblößt hinzukamen, und den Reichen, die eine Wohnung besaßen. Die Schwächeren unterlagen dabei. Schließlich trat der Moment ein, wo etliche von den Russen Verjagte nur noch Schnee als Lager hatten und sich darauf niederlegten, um sich nicht wieder zu erheben. Unmerklich schloß sich diese Menge fast lebloser Wesen so fest zusammen, wurde so taub, so stumpf oder vielleicht auch so glückselig, daß der Marschall Victor, ihr heldenmütiger Verteidiger, der zwanzigtausend von Wittgenstein befehligten Russen Widerstand geleistet hatte, genötigt war, sich mit schneller Gewalt einen Weg durch diesen Wald von Menschen zu bahnen, um mit fünftausend Tapferen, die er dem Kaiser zuführte, über die Beresina zu setzen. Diese Unglücklichen ließen sich lieber tottreten als sich zu rühren, und gingen stillschweigend zugrunde, indem sie ihren erloschenen Feuern zulächelten, ohne Frankreichs zu gedenken.
Erst um zehn Uhr abends befand sich der Herzog von Bellune am andern Ufer des Flusses. Bevor er sich auf die Brücken begab, die nach Zembin führten, vertraute er das Schicksal der Nachhut von Studzianka Eblé an, dem Retter aller derer, die das Unglück der Beresina überlebten. Es war ungefähr gegen Mitternacht, als dieser große General in Begleitung eines tapferen Offiziers die kleine Hütte verließ, die er nahe bei der Brücke bewohnte, und sich anschickte, das Schauspiel zu betrachten, welches das Lager zwischen dem Ufer der Beresina und dem Wege von Borizof nach Studzianka bot. Die russische Artillerie hatte aufgehört zu feuern; die unzähligen Feuer inmitten dieser Schneemassen, die herabgebrannt waren und kein Licht mehr zu verbreiten schienen, beleuchteten hier und da Gesichter, die nichts Menschliches mehr an sich hatten. Ungefähr dreißigtausend Unglückliche, zu allen Nationen gehörig, die Napoleon nach Rußland geworfen hatte, waren hier zusammen und kämpften mit brutaler Unbekümmertheit um ihr Leben.
›Retten wir diese alle‹, sagte der General zu dem Offizier. ›Morgen früh werden die Russen Herren von Studzianka sein. Man muß also die Brücke niederbrennen im Augenblick, wo die Russen erscheinen werden; also Mut, mein Freund! Schlage dich durch bis zur Höhe. Sag dem General Fournier, daß er kaum Zeit haben wird, seine Stellung aufzugeben, diese ganze Gesellschaft zu durchbrechen und die Brücke zu passieren. Sobald du siehst, daß er sich in Marsch setzt, wirst du ihm folgen. Mit Hilfe einiger kräftiger Leute wirst du mitleidlos die Lager, die Equipagen, die Kasten, die Wagen, alles niederbrennen! Treibe die ganze Gesellschaft über die Brücke; zwinge alles, was zwei Beine hat, auf das andere Ufer zu flüchten. Das Niederbrennen ist jetzt unsere letzte Rettung. Hätte Berthier mich diese verdammten Equipagen vernichten lassen, würde der Fluß niemanden fortgeschwemmt haben als meine armen Pioniere, die fünfzig Helden, die die armen gerettet haben und die man vergessen wird!‹
Der General führte die Hand an seine Stirn und verweilte schweigend. Er hatte die Empfindung, daß Polen sein Grab sein würde, und daß keine Stimme sich zugunsten dieser edelmütigen Männer erheben würde, die sich im Wasser hielten, im Wasser der Beresina!, um die Brückenpfähle festzumachen. Ein einziger von ihnen lebt, oder korrekter gesagt, leidet heute noch in einem Dorfe, ein Unbekannter! Der Adjutant entfernte sich. Kaum hatte dieser edelmütige Offizier hundert Schritte nach Studzianka hin gemacht, als der General Eblé mehrere seiner leidenden Pioniere aufweckte und sein Rettungswerk begann, indem er die Zelte, die um die Brücke herum errichtet waren, anzündete und so die Schläfer, die ihn umgaben, die Beresina zu überschreiten zwang. Inzwischen war der junge Adjutant nicht ohne Mühe bei dem einzigen Holzhause angelangt, das noch in Studzianka aufrecht stand.
›Ist denn diese Baracke sehr voll, Kamerad?‹ sagte er zu einem Manne, den er draußen bemerkte.
›Wenn Sie hereinkommen, werden Sie ein geschickter alter Soldat sein,‹ erwiderte der Offizier, ohne sich umzuwenden und ohne aufzuhören, mit seinem Säbel das Holz des Hauses zu zerstören.
›Sind Sie es, Philipp?‹ sagte der Adjutant, der am Klange der Stimme einen seiner Freunde erkannte. ›Jawohl. Ach, du bist es, mein Alter!‹ entgegnete Herr de Sucy und betrachtete den Adjutanten, der, wie er, erst dreiundzwanzig Jahre alt war. ›Ich glaubte dich auf der anderen Seite dieses verdammten Flusses. Bringst du uns Kuchen und Konfekt zu unserem Dessert? Du wirst schön empfangen werden,‹ fügte er hinzu, indem er mit dem Losschälen der Holzrinde beschäftigt war, die er nach ländlicher Weise seinem Pferde als Futter reichte. ›Ich suche Ihren Kommandanten, um ihn im Namen des Generals Eblé aufzufordern, nach Zembin zu eilen. Sie werden kaum Zeit haben, durch diese Masse von Kadavern hindurchzukommen, die ich gleich in Brand setzen werde, um ihnen Beine zu machen.‹
›Du machst mir ja förmlich warm! Deine Neuigkeit bringt mich in Schweiß. Ich habe zwei Freunde zu retten! Ach, ohne diese beiden Schützlinge wäre ich schon tot! Ihretwegen sorge ich für mein Pferd und esse selbst nicht mehr. Um Himmelswillen hast du nicht irgendein Stückchen Brot? Es sind jetzt dreißig Stunden her, daß ich nichts in den Magen bekommen habe, und ich habe wie ein Wahnsinniger gekämpft, um mir das bißchen Wärme und Mut zu erhalten, das ich noch besitze.‹
›Armer Philipp! Nichts, nichts. Versuche nicht, hier hineinzukommen! In dieser Scheune liegen unsere Verwundeten. Steige noch höher! Du wirst dann zu deiner Rechten eine Art von Schweinekoben finden: da ist der General! Leb wohl, mein Tapferer. Wenn wir jemals wieder auf einem Pariser Parkett Quadrille tanzen …‹
Er vollendete den Satz nicht: der Sturm wehte in diesem Moment so tückisch, daß der Adjutant losmarschierte, um nicht zu erfrieren, und die Lippen des Majors Philipp erstarrten. Bald herrschte völliges Schweigen. Es wurde nur von Seufzern unterbrochen, die aus dem Hause drangen, und durch das dumpfe Geräusch, das das Pferd des Herrn de Sucy machte, das vor Hunger und Wut die erfrorene Rinde kaute, aus der das Haus erbaut war. Der Major steckte seinen Säbel in die Scheide, nahm das kostbare Tier, das er zu bewahren verstanden hatte, jäh beim Zügel und riß es, trotz seines Widerstandes, von der unheilvollen Nahrung zurück, nach der es so gierig war.
›Vorwärts, Bichette, vorwärts! Du allein kannst Stephanie retten. Warte nur, später, da werden wir uns ausruhen und sicher sterben können.‹
Philipp, in einen Pelz gehüllt, dem er seine Erhaltung und seine Energie verdankte, fing an zu laufen, indem er mit den Füßen scharf auf den gefrorenen Schnee trat, um sich warm zu erhalten. Kaum hatte der Major fünfhundert Schritt gemacht, als er ein tüchtiges Feuer an dem Platze wahrnahm, wo er seit heute morgen seinen Wagen unter der Obhut eines alten Soldaten gelassen hatte. Eine furchtbare Unruhe bemächtigte sich seiner. Wie alle die, welche während dieser Flucht von einer mächtigen Empfindung beherrscht wurden, verspürte er, um seinen Freunden zu helfen, Kräfte in sich, die er zu seiner eigenen Rettung nicht aufgebracht hätte. Bald befand er sich wenige Schritt von einer Terrainfalte entfernt, in der er, vor den Kugeln geborgen, eine junge Frau untergebracht hatte, seine Jugendgefährtin und seinen teuersten Schatz!
Etliche Schritte vom Wagen hatten sich etwa dreißig Nachzügler vor einem riesigen Feuer zusammengefunden, das sie mit hineingeworfenen Brettern, mit den Oberteilen von Kasten, mit Rädern und Wagenwänden unterhielten. Diese Soldaten waren jedenfalls die letzten aller Herbeigekommenen, die von dem Einschnitt zwischen dem Terrain von Studzianka bis zu dem verhängnisvollen Flusse einen Ozean von Köpfen, Feuern und Baracken bildeten, ein lebendes, von fast unmerklichen Wogen bewegtes Meer, aus dem ein dumpfes, manchmal von schrecklichem Lärm unterbrochenes Geräusch empordrang. Von Hunger und Verzweiflung getrieben, hatten diese Unglückseligen sich wahrscheinlich zu dem Wagen hingedrängt. Der alte General und die junge Frau, die hier auf Fetzen, in Mäntel und Pelze gewickelt lagen, waren in diesem Moment vor dem Feuer niedergekniet. Der eine Wagenvorhang war zerrissen. Sobald die um das Feuer gelagerten Männer die Tritte des Pferdes und des Majors hörten, erhoben sie einen Schrei wütenden Hungers.
»Ein Pferd, ein Pferd!«
Alles vereinigte sich zu einem einzigen Ruf.
›Zurück! Nehmen Sie sich in acht!‹ riefen zwei bis drei Soldaten und machten sich an das Pferd.
Philipp stellte sich vor sein Tier und sagte: ›Schufte! Ich stoße euch alle in euer Feuer. Da oben gibt’s genug tote Pferde! Holt sie euch.‹
›Ist das ein Spaßvogel, dieser Offizier! Eins, zwei, willst du dich wehren?‹ entgegnete ein riesiger Grenadier. ›Na, gut, wie du willst!‹
Der Schrei einer Frau lenkte den Schuß ab. Philipp wurde glücklicherweise nicht getroffen; aber Bichette, die zusammengebrochen war, kämpfte mit dem Tode; drei Männer stürzten sich auf sie und gaben ihr mit Bajonettstößen den Rest.
›Kannibalen! Laßt mich wenigstens die Decke und meine Pistolen nehmen,‹ sagte Philipp verzweifelt. ›Die Pistolen, ja‹, erwiderte der Grenadier. ›Aber was die Decke anlangt, da ist ein Infanterist, der seit zwei Tagen ›nichts auf seiner Laterne‹ hat, und der in seinem elenden Jammerrock zittert. Das ist unser General …‹
Philipp schwieg, als er einen Mann sah, dessen Schuhzeug verbraucht, dessen Hose an zehn Stellen durchlöchert war, und der auf dem Kopfe eine schlechte, mit Eis bedeckte Polizeimütze trug. Er beeilte sich, seine Pistolen an sich zu nehmen. Fünf Männer zogen das Tier vor das Feuer und begannen, es mit solcher Geschicklichkeit zu zerlegen, wie es Fleischergesellen in Paris hätten machen können. Mit bewunderungswürdiger Kunst wurden die Stücke abgelöst und auf Kohlen gelegt. Der Major stellte sich neben die Frau, die einen Schrei des Entsetzens ausgestoßen hatte, als sie ihn wiedererkannte; er sah sie unbeweglich auf einem Wagenkissen sitzend und sich wärmend; sie betrachtete ihn stillschweigend, ohne ihm zuzulächeln. Philipp sah jetzt neben ihr den Soldaten, dem er die Verteidigung des Wagens anvertraut hatte; der arme Mensch war verwundet worden. Überwältigt von der Menge, war er eben den Nachzüglern gewichen, die ihn angegriffen hatten; aber wie ein Hund, der bis zum letzten Augenblick das Essen seines Herrn verteidigt hat, hatte er sich seinen Teil an der Beute genommen und sich aus einem weißen Tuch eine Art Mantel gemacht. Jetzt war er damit beschäftigt, ein Stück Pferdefleisch umzudrehen, und der Major nahm auf seinem Gesichte die Freude wahr, die ihm die Zurüstungen zu dem Festessen verursachten. Der Graf von Vandières, seit drei Tagen in eine Art kindischen Zustandes verfallen, blieb auf seinem Kissen neben seiner Frau sitzen und betrachtete mit unbeweglichen Augen die Flammen, deren Wärme anfing, seine Erstarrung zu mildern. Er war von der Gefahr und der Ankunft Philipps nicht mehr erregt worden, als von dem Kampf, bei dem sein Wagen geplündert worden war. Sucy ergriff zuerst die Hand der jungen Gräfin, um ihr ein Zeichen seiner Hingabe auszudrücken und ihr den Schmerz darüber kundzugeben, daß sie so ins letzte Elend geraten war; aber er blieb stumm neben ihr auf einem Schneehaufen, der sich in Wasser auflöste, sitzen und gab selbst dem Wohlgefühl, sich zu erwärmen, nach, die Gefahr und alles andere vergessend. Sein Gesicht nahm gegen seine Absicht einen beinahe stumpfsinnigen Ausdruck von Freude an, und er wartete ungeduldig auf den Augenblick, wo das seinen Soldaten gegebene Stück Pferdefleisch gebraten war. Der Geruch dieses verkohlten Fleisches reizte seinen Hunger, und sein Hunger ließ sein Herzensempfinden, seinen Mut und seine Liebe schweigen. Ohne Zorn betrachtete er die Ergebnisse der Plünderung seines Wagens. Alle Leute, die das Feuer umgaben, hatten sich in die Decken, die Kissen, die Pelze, die männlichen und weiblichen Kleidungsstücke des Grafen und der Gräfin geteilt. Philipp wandte sich um, weil er sehen wollte, ob man noch Nutzen aus seiner Kasse ziehen konnte. Beim Lichte der Flammen bemerkte er Gold, Diamanten und Silberzeug zerstreut, ohne daß jemand daran dachte, sich auch nur das geringste Stück davon anzueignen. Jedes der Individuen, die der Zufall um das Feuer zusammengebracht hatte, bewahrte ein Stillschweigen, das etwas Fürchterliches an sich hatte, und tat nichts weiter, als was er für sein Wohlbefinden für notwendig erachtete. Dieses Elend hatte etwas Groteskes. Die von der Kälte veränderten Gesichter waren mit einem Überzug von Schmutz bedeckt, auf dem sich die Tränenspuren von den Augen bis zum unteren Teil der Wangen mit einer Furche abzeichneten, die die Dicke dieser Kruste anzeigte. Die Unsauberkeit ihrer langen Bärte machte die Soldaten noch abscheulicher. Die einen waren in Weiberschals gewickelt; die anderen trugen Pferdeschabracken, schmutzige Decken und Lumpen, bedeckt mit Reif, der anfing zu zerschmelzen; einige hatten einen Fuß in einem Schuh, den andern in einem Stiefel; schließlich gab es niemanden, dessen Kleidung nicht irgendeine lächerliche Besonderheit aufwies. Inmitten dieser komischen Umhüllung verharrten die Männer ernst und düster. Das Schweigen wurde nur von dem Krachen des Holzes unterbrochen, von dem Flackern der Flamme, von dem fernen Geräusch des Feldes und von den Säbelhieben, die die Verhungertsten Bichette versetzten, um die besten Stücke davon abzureißen. Einige Unglückliche, matter als die andern, schliefen bereits, und wenn einer von ihnen ins Feuer rollte, zog ihn niemand zurück. Diese strengen Logiker dachten, daß, wenn er nicht tot war, das Verbrennen ihn schon veranlassen würde, sich an einen geeigneteren Ort hinzulegen. Wenn aber der Unglückliche im Feuer erwachte und umkam, so beklagte ihn niemand. Etliche Soldaten sahen einander an, wie um ihre eigene Unbekümmertheit durch die Gleichgültigkeit der anderen gerechtfertigt zu sehen. Die junge Gräfin hatte zweimal einen solchen Anblick und blieb stumm. Als die verschiedenen Stücke, die man auf die Kohlen gelegt hatte, gebraten waren, stillte jeder seinen Hunger mit der Freßgier, die uns bei den Tieren so widerwärtig erscheint.
»Das ist das erstemal, daß man dreißig Infanteristen auf einem Pferde gesehen hat,« rief der Grenadier, der das Tier abgestochen hatte.
Das war der einzige Scherz, der nationalen Witz bezeugte.
Bald rollte sich die Mehrzahl der armen Soldaten in ihre Kleider, legte sich auf Bretter, auf alles, was sie vor der Berührung mit dem Schnee schützen konnte, und schlief unbekümmert bis zum nächsten Morgen. Als der Major sich erwärmt und seinen Hunger gefüllt hatte, drückte ihm ein unbezwingliches Schlafbedürfnis auf die Wimpern. Während seines ziemlich kurzen Kampfes mit dem Schlafe betrachtete er die junge Frau, die, mit dem Gesicht zum Feuer gewendet, um zu schlafen, ihre geschlossenen Augen und einen Teil ihrer Stirn sehen ließ; sie war in einen dichten Pelz und einen dicken Dragonermantel gewickelt; ihr Kopf lag auf einem blutbefleckten Kopfkissen; ihre, von einem um den Hals geschlungenen Taschentuch festgehaltene Astrachanmütze schützte ihr Gesicht so viel als möglich vor der Kälte; die Füße hatte sie in den Mantel versteckt. So in sich selbst zusammengerollt, glich sie in der Tat nichts Menschlichem. War sie die letzte Marketenderin? War sie die entzückende Frau, der Stolz eines Liebhabers, die Königin der Pariser Bälle? Ach! Selbst das Auge ihres hingebendsten Freundes konnte nichts Weibliches mehr in diesem Haufen von Wäsche und Lumpen erkennen. Der Kälte war die Liebe im Herzen einer Frau gewichen. Durch die dichten Schleier, die der unwiderstehlichste Schlaf über die Augen des Majors breitete, sah er den Mann und die Frau nur noch wie zwei Punkte. Die Flammen des Feuers, die Gesichter überall, die schreckliche Kälte, die, drei Schritte von der flüchtigen Wärme entfernt, sich durchbohrend geltend machte, alles floß in einen Traum zusammen. Ein peinlicher Gedanke erschreckte Philipp. »Wir werden alle sterben, wenn ich einschlafe; ich will nicht schlafen,« sagte er sich. Aber er schlief. Ein schrecklicher Lärm und eine Explosion erweckten Herrn de Sucy nach einer Stunde Schlaf. Das Gefühl, seine Pflicht tun zu müssen, die Gefahr seiner Freunde fielen ihm plötzlich schwer aufs Herz. Er stieß einen Schrei ähnlich einem Geheul aus. Er und sein Soldat standen allein aufrecht. Sie erblickten ein Feuermeer vor sich, das im Schatten der Nacht vor ihnen eine Masse Menschen abschnitt, indem es die Hütten und Zelte verzehrte; sie hörten Verzweiflungsschreie und Geheul; sie sahen Tausende von entsetzten Gesichtern und wütenden Köpfen. Inmitten dieser Hölle bahnte sich eine Kolonne von Soldaten einen Weg nach der Brücke zu zwischen zwei Reihen von Kadavern hindurch.
»Das ist der Rückzug unsres Nachtrabs!« rief der Major. »Keine Hoffnung mehr!«
»Ich habe Ihren Wagen geschont, Philipp,« sagte eine Freundesstimme.
Als er sich umwandte, erkannte Sucy beim Licht der Flammen den jungen Adjutanten.
»Ach, es ist alles verloren!« erwiderte der Major. »Sie haben mein Pferd verzehrt. Und wie soll ich auch den stumpfsinnigen General und seine Frau auf den Weg bringen?«
»Nehmen Sie einen Feuerbrand und drohen Sie ihnen.«
»Soll ich die Gräfin bedrohen?«
»Adieu!« rief der Adjutant. »Ich habe gerade nur noch Zeit, diesen fatalen Fluß zu überschreiten, und das muß geschehen. Ich habe eine Mutter in Frankreich. Was für eine Nacht! Diese Masse hier will lieber auf dem Schnee bleiben, und die Mehrzahl dieser Unglücklichen will sich lieber verbrennen lassen als sich erheben. Es ist vier Uhr, Philipp! In zwei Stunden werden die Russen anfangen sich zu rühren. Ich versichere Ihnen, daß Sie die Beresina bald voller Leichname sehen werden. Denken Sie an sich, Philipp! Sie haben keine Pferde, Sie können die Gräfin nicht tragen; also vorwärts, kommen Sie mit mir,« sagte er und faßte ihn am Arme.
»Aber, lieber Freund, wie soll ich Stephanie verlassen!«
Der Major ergriff die Gräfin, stellte sie auf die Beine, schüttelte sie mit der Rauheit eines Verzweifelten und zwang sie, aufzuwachen; sie sah ihn mit totem, starrem Blicke an.
›Wir müssen vorwärts, Stephanie, oder wir sterben hier.‹
Als alle Antwort versuchte die Gräfin, sich zur Erde gleiten zu lassen, um zu schlafen. Der Adjutant ergriff einen Feuerbrand und bewegte ihn vor dem Gesicht Stephanies hin und her.
›Retten wir sie gegen ihren Willen!‹ rief Philipp, hob die Gräfin auf und trug sie in den Wagen.
Er kehrte zurück und bat den Adjutanten um Hilfe. Beide nahmen den alten General, ohne zu wissen, ob er tot oder lebendig war, und legten ihn neben seine Frau. Der Major stieß mit dem Fuße jeden einzelnen der auf der Erde liegenden Leute weg, nahm ihnen ab, was sie geraubt hatten, häufte alle Kleider auf die beiden Gatten und warf in eine Ecke des Wagens etliche gebratene Stücke ihres Pferdes. ›Was wollen Sie denn machen?‹ fragte ihn der Adjutant.
›Sie schleppen‹, sagte der Major.
›Sie sind wohl toll!‹
›Das ist wahr!‹ rief Philipp und kreuzte die Arme über der Brust.
Plötzlich schien er von einem verzweifelten Gedanken gepackt zu sein.
›Du!‹, sagte er und ergriff den gesunden Arm seines Soldaten, ›ich vertraue sie dir für eine Stunde an! Denke daran, daß du eher sterben mußt, als, wer es auch sei, an den Wagen herankommen lassen darfst.‹ Der Major bemächtigte sich der Diamanten der Gräfin, nahm sie in die eine Hand, zog mit der andern den Säbel und begann wütend auf die Schläfer loszuschlagen, die er für die unerschrockensten hielt, und es gelang ihm auch, den kolossalen Grenadier und noch zwei andere Männer, deren militärischer Rang unmöglich zu erkennen war, aufzuwecken.
»Wir sind verloren«, sagte er zu ihnen.
»Das weiß ich wohl,« antwortete der Grenadier, »aber das ist mir egal.«
»Nun also, so oder so tot, ist es nicht besser, sein Leben für eine hübsche Frau zu verkaufen, auf die Gefahr hin, Frankreich noch einmal wiederzusehen?«
»Ich will lieber schlafen,« sagte einer von den Leuten und rollte auf den Schnee, »und wenn du mich weiter belästigst, Major, werde ich dir mein Bajonett in die Wampe pflanzen.«
»Worum handelt es sich, Herr Major?«, fragte der Grenadier. »Der Kerl ist betrunken! Das ist ein Pariser; die wollen es bequem haben.«
»Das hier ist für dich, mein braver Kerl,« rief der Major und bot ihm einen Diamantenschmuck an, »wenn du mir folgen und wie ein Wilder kämpfen willst. Die Russen werden in zehn Minuten auf dem Marsche sein, sie sind beritten; wir werden auf ihre erste Batterie losmarschieren und zwei Pferde mit uns nehmen.«
»Aber die Schildwachen, Herr Major?«
»Einer von uns dreien« , sagte er zu dem Soldaten. Er unterbrach sich und sah den Adjutanten an; »Sie kommen mit uns, Hippolyt, nicht wahr?«
Hippolyt stimmte mit einem Kopfnicken zu.
»Einer von uns«, fuhr der Major fort, »wird die Schildwache auf sich nehmen. Übrigens werden sie auch vielleicht schlafen, diese verdammten Russen.«
»Bist du wirklich so tapfer, mein Major? Aber du wirst mich auch in deinem Wagen mitnehmen?» sagte der Grenadier.
»Jawohl, wenn du dort oben nicht dein Fell opfern mußt. Wenn ich falle, versprecht mir, Hippolyt und du, Grenadier,» sagte der Major und wandte sich an seine beiden Gefährten, ,»daß ihr euch für die Rettung der Gräfin aufopfern wollt.»
»Abgemacht«, rief der Grenadier.
Sie wandten sich der Linie der Russen zu, nach den Batterien hin, die so furchtbar die Masse der Unglücklichen zerschmettert hatten, die am Ufer des Flusses lagen. Einige Augenblicke nach ihrem Verschwinden ertönte der Galopp zweier Pferde auf dem Schnee, und die wachgewordene Batterie sandte einige Salven hinterher, die über die Häupter der Schläfer hinweggingen; der Galopp der Pferde war so überstürzt, daß man von Schmiedhämmern hätte reden mögen. Der edelmütige Adjutant war gefallen. Der athletische Grenadier war heil und gesund geblieben. Philipp hatte bei der Verteidigung seines Freundes einen Bajonettstich in die Schulter erhalten; trotzdem klammerte er sich an die Nackenhaare des Pferdes und preßte es so fest mit seinen Beinen, daß das Tier sich wie in einem Schraubstock befand.
»Gott sei gelobt!« rief der Major, als er seinen Soldaten unbeweglich im Wagen an seinem Platze vorfand.
»Wenn Sie gerecht sein wollen, Herr Major, werden Sie mir das Kreuz verschaffen. Wir haben hübsch mit dem Schießprügel und dem Stichgewehr gespielt, was?«
»Wir haben noch nichts geleistet. Jetzt müssen wir die Pferde anspannen. Nehmen Sie die Seile.«
»Es sind nicht genug davon vorhanden.«
»Dann, Grenadier, müssen Sie Hand an die Schläfer legen und ihre Umhänge und ihre Wäsche dazu nehmen …«
»Sieh mal an, er ist tot, dieser Hanswurst!« rief der Grenadier, als er den ersten, an den er sich wandte, umdrehte. »Ach, wie komisch, sie sind ja tot!«
»Alle?«
»Jawohl, alle! Es scheint, das Pferd ist ein unverdauliches Essen, wenn man es mit Schnee genießt.« diese Worte ließen Philipp erzittern. Der Frost war noch stärker geworden.
»Mein Gott! Eine Frau verlieren, die ich schon zwanzigmal gerettet habe.«
Der Major schüttelte die Gräfin und rief: »Stephanie! Stephanie!«
Die junge Frau öffnete ihre Augen.
»Wir sind gerettet, Madame.«
»Gerettet!« wiederholte sie und fiel zurück.
Die Pferde wurden, so gut es ging, angespannt. Mit seinem Säbel in der gesunden Hand, die Zügel in der andern, bestieg er, mit seinen Pistolen bewaffnet, das eine Pferd, während der Grenadier sich auf das andere setzte. Der alte Soldat, dessen Füße erfroren waren, wurde quer in den Wagen über den General und die Gräfin geworfen. Durch Säbelhiebe angestachelt, trugen die Pferde die Equipage mit wütender Eile in die Ebene hinaus, wo unzählige Schwierigkeiten den Major erwarteten. Bald war es unmöglich, vorwärts zu kommen, ohne zu riskieren, Männer, Frauen und eingeschlafene Kinder totzufahren, die alle sich zu rühren verweigerten, als der Grenadier sie aufweckte. Vergeblich suchte Herr de Sucy den Weg, den der Nachtrab inzwischen sich mitten in dieser Menschenmasse gebahnt hatte; er war verschwunden wie das Kielwasser des Schiffes auf dem Meere; es ging nur im Schritt weiter, meist von den Soldaten angehalten, die damit drohten, die Pferde zu töten.
›Wollen Sie weiter kommen?‹ fragte der Grenadier.
›Um den Preis meines Blutes, um den Preis der ganzen Welt‹, erwiderte der Major.
›Vorwärts! Man macht keine Omeletten, ohne Eier zu zerschlagen.‹
Und der Grenadier jagte die Pferde auf die Menschen los, ließ blutige Geleise hinter sich, stürzte die Zelte um und bahnte sich eine doppelte Furche quer durch dieses Feld von Köpfen. Aber wir müssen ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er niemals unterließ, mit donnernder Stimme zu rufen: ›Achtung, ihr Biester!‹
›Die Unglücklichen!‹ rief der Major.
›Bah! Entweder der Frost oder die Kanonen!‹ sagte der Grenadier, trieb die Pferde an und stach mit der Spitze seines Säbels auf sie los.
Eine Katastrophe, die ihnen sehr viel früher hätte begegnen und vor der bis dahin ein fabelhafter Zufall sie bewahrt hatte, hielt plötzlich ihren Weg an. Der Wagen stürzte um.
›Das dachte ich mir!‹ rief der unerschütterliche Grenadier aus. ›Oh, oh! Der Kamerad ist tot!‹
›Armer Laurent!‹ sagte der Major.
›Laurent? Ist er nicht von den fünften Jägern?‹
›Jawohl.‹
›Das ist mein Vetter. Bah! Das Hundeleben ist nicht schön genug, daß man es in der jetzigen Zeit zu bedauern hätte.‹
Der Wagen wurde nicht wieder aufgerichtet, die Pferde nicht wieder freigemacht ohne einen unendlichen, nicht wieder gut zu machenden Zeitverlust. Der Stoß war so heftig gewesen, daß die junge Gräfin, die erwacht und durch die Bewegung aus ihrer Betäubung aufgerüttelt worden war, die Kleidungsstücke abwarf und sich erhob.
»Wo sind wir denn, Philipp?« rief sie mit sanfter Stimme und sah um sich.
»Fünfhundert Schritt von der Brücke entfernt. Wir wollen über die Beresina. Jenseits des Flusses, Stephanie, werde ich Sie nicht mehr quälen, werde Sie schlafen lassen, wir werden in Sicherheit sein und in Ruhe Wilna erreichen. Gebe Gott, daß Sie niemals erfahren, was Ihr Leben gekostet hat!«
»Du bist verwundet?«
»Es bedeutet nichts.«
Die Stunde der Katastrophe war herangekommen. Die Kanonen der Russen kündigten den Tag an. Herren von Studzianka, feuerten sie über die Ebene; und bei dem ersten Morgenlicht bemerkte der Major ihre Kolonnen sich auf den Höhen formieren. Ein Alarmgeschrei erhob sich mitten aus der Menge, die in einem Moment auf den Beinen war. Instinktmäßig begriff jeder die ihm drohende Gefahr, und alle drängten sich in Wellenbewegungen der Brücke zu. Die Russen eilten mit der Schnelligkeit eines Feuerbrandes hinab. Männer, Weiber, Kinder, Pferde, alles marschierte auf die Brücke los. Glücklicherweise befanden sich der Major und die Gräfin noch ziemlich entfernt vom Ufer. Der General Eblé hatte Feuer an die Zelte am andern Ufer gelegt. Trotz der Warnungen, die vor dem Betreten der Rettungsplanke gegeben wurden, wollte niemand zurückweichen. Nicht nur senkte sich die mit Menschen überladene Brücke, sondern der heftige Strom von Menschenzufluß stürzte wie eine verhängnisvolle Lawine so hinab, daß eine Menschenmenge wie ein Schneesturz ins Wasser mitgerissen wurde. Man hörte keinen Schrei, sondern nur das dumpfe Geräusch eines ins Wasser gefallenen Steins; dann war die Beresina mit Leichnamen bedeckt. Der Rückstoß derjenigen, die in die Ebene zurückwichen, um diesem Tode zu entgehen, war so furchtbar, daß eine große Menge von Leuten durch Erstickung starben. Der Graf und die Gräfin verdankten ihr Leben nur ihrem Wagen. Nachdem die Pferde eine Masse Sterbender zerschmettert und vernichtet hatten, gingen sie selbst zugrunde unter den Füßen einer Art menschlicher Wasserhose, die auf das Ufer stürzte. Der Major und der Grenadier retteten sich durch ihre Kraft. Sie töteten, um nicht selbst getötet zu werden. Dieser Orkan von menschlichen Gesichtern, dieses Hin- und Herfließen von durch die gleiche Bewegung getragenen menschlichen Körpern, ließ während einiger Augenblicke das Ufer der Beresina verlassen erscheinen. Die Masse hatte sich zurück in die Ebene geworfen. Wenn etliche Menschen sich von oben den steilen Abhang hinabließen, so geschah das weniger in der Hoffnung, das andere Ufer zu erreichen, was für sie Frankreich bedeutete, als um den Wüsten Sibiriens zu entrinnen. Die Verzweiflung wurde eine Rettung für etliche mutige Leute. Ein Offizier sprang von Scholle zu Scholle bis an das andere Ufer; ein Soldat kletterte mit wunderbarer Geschicklichkeit über einen Haufen von Leichnamen und Eisschollen. Diese riesenhafte Volksmasse begriff schließlich, daß die Russen nicht zwanzigtausend waffenlose, erfrorene, stumpfgewordene Menschen, die sich nicht verteidigen würden, töten wollten, und jeder erwartete sein Los mit furchtbarer Resignation. So blieben also der Major, sein Grenadier, der alte Soldat und seine Frau allein einige Schritte von dem Orte, wo sich die Brücke befand. Alle vier standen hier aufrecht, mit trockenen Augen, stillschweigend und von einer Menge Toter umgeben. Etliche kräftige Soldaten, etliche Offiziere, denen die Verhältnisse alle ihre Energie wiedergaben, fanden sich neben ihnen ein. Diese ziemlich zahlreiche Gruppe umfaßte ungefähr fünfzig Menschen. Der Major bemerkte in einer Entfernung von zweihundert Schritt die Ruinen der Brücke, die für die Wagen hergestellt, aber vorher zusammengebrochen war.
»Zimmern wir uns ein Floß zusammen!« rief er.
Kaum hatte er dieses Wort fallen lassen, als die ganze Gruppe auf die Trümmer zulief. Eine Menge Menschen schickte sich an, Eisenstäbe aufzusammeln, Holzstücke, Seile aufzusuchen, kurz alles für den Bau eines Flosses notwendige Material. Eine Truppe von zwanzig Soldaten und Offizieren bildeten eine von dem Major befehligte Garde, um die Arbeiter gegen die verzweifelten Angriffe zu schützen, die die Masse vollführen könnte, wenn sie ihren Plan erriet. Das Gefühl der Freiheit, das die Gefangenen beseelt und ihnen Wunder einflößt, kann mit dem nicht verglichen werden, das in diesem Augenblick die unglücklichen Franzosen handeln ließ.
»Da sind die Russen! Da sind die Russen!« schrieen den Arbeitern ihre Verteidiger zu.
Das Holz kreischte, die Bohlen wuchsen in die Breite, Höhe und Tiefe. Generale, Soldaten, Obersten, alles bog sich unter dem Gewicht der Räder, der Eisen, der Bretter: es war ein wahrhaftes Bild des Baues der Arche Noah. Die junge Gräfin saß neben ihrem Manne und sah mit Bedauern zu, weil sie an der Arbeit nichts mittun konnte; trotzdem half sie, Knoten zu knüpfen, um die Seile fester zu machen. Endlich war das Floß fertig. Vierzig Menschen stürzten sich ins Wasser des Flusses, während ein Dutzend Soldaten die Seile hielten, die dazu dienen sollten, an dem Abhang festzuhalten. Kaum aber sahen die Erbauer ihre Einschiffung auf der Beresina sich vollziehen, so stürzten sie sich von dem Ufer oben hinab mit äußerster Selbstsucht. Der Major, der die Wut des ersten Ansturms befürchtete, hielt Stephanie und den General an der Hand fest; aber er erbebte, als er die dunkle Masse sich einschiffen sah und die darauf zusammengepreßten Menschen erblickte, wie Zuschauer im Parterre eines Theaters.
›Ihr Wilden!‹ rief er, ›ich habe euch doch den Gedanken eingegeben, ein Floß zu erbauen; ich bin euer Retter, und ihr verweigert mir meinen Platz!‹
Ein verworrener Lärm war die Antwort. Die am Rande des Flosses untergebrachten und mit Stäben zum Abstoßen vom Abhang versehenen Männer stießen mit Gewalt den Holzzug vorwärts, um ihn an das andere Ufer zu drängen und ihn die Eisschollen und Leichname durchschneiden zu lassen.
›Zum Donnerwetter nochmal! Ich renne euch ins Wasser, wenn ihr den Major und seine beiden Gefährten nicht richtig aufnehmt!‹ schrie der Grenadier, erhob seinen Säbel, verhinderte ihren Aufbruch und ließ sie zusammenrücken trotz der schrecklichen Schreie.
›Ich werde fallen! Ich falle!‹ schrieen seine Gefährten. ›Immer weiter vorwärts.‹
Der Major betrachtete trockenen Auges seine Geliebte, die ihre Augen zum Himmel mit erhabener Ergebung aufhob.
»Mit dir zusammen sterben!« sagte sie.
Es lag etwas Komisches in der Haltung der Leute auf dem Floß. Obgleich sie ein schauderhaftes Gebrüll ausstießen, wagte doch keiner dem Grenadier Widerstand zu leisten; denn sie waren so zusammengedrängt, daß eine einzige Person nur zu stoßen brauchte, um alles umzustürzen. In dieser Gefahr versuchte ein Hauptmann sich von einem Soldaten zu befreien, der die feindliche Bewegung des Offiziers wahrnahm, ihn anpackte und ihn ins Wasser stürzte mit den Worten: »Ach, du Ente, du willst trinken! Na dann los!«
»Hier sind zwei Plätze frei!« rief er dann. »Vorwärts, Major, werfen Sie uns Ihre kleine Frau herüber und kommen Sie selbst mit! Lassen Sie doch den alten Mops zurück, der wird ja morgen doch sterben!«
»Beeilt euch!« schrie eine Stimme, die sich aus hundert zusammensetzte.
»Vorwärts, Major … Die andern schimpfen, und sie haben recht.«
Der Graf von Vandières entledigte sich seiner Umkleidung und stand aufrecht in seiner Generalsuniform.
»Retten wir den Grafen«, sagte Philipp.
Stephanie drückte ihrem Freunde die Hand, warf sich über ihn und umarmte ihn mit wildem Druck.
»Adieu!« sagte sie.
Sie hatten sich verstanden. Der Graf von Vandières fand seine Kräfte und seine Geistesgegenwart wieder, um zur Einschiffung hinunterzuspringen, wohin Stephanie ihm folgte, nachdem sie einen letzten Blick auf Philipp geworfen hatte.
»Major, wollen Sie meinen Platz haben? Ich pfeife aufs Leben« , rief der Grenadier. »Ich habe weder Frau, noch Kind, noch Mutter.«
»Ich vertraue sie dir an« , rief der Major und zeigte auf den Grafen und seine Frau.
»Seien Sie beruhigt, ich werde sie wie meinen Augapfel hüten.«
Das Floß wurde mit solcher Gewalt an das Ufer gestoßen, das der Stelle, wo Philipp unbeweglich stand, gegenüber war, daß sein Stoß an die Erde alles erschütterte. Der an Bord befindliche Graf rollte in den Fluß. Als er hineinfiel, schlug ihm eine Eisscholle auf den Kopf und trieb ihn wie eine Kugel weit weg.
»He! Major!« schrie der Grenadier.
»Adieu!« rief eine Frauenstimme.
Und Philipp de Sucy fiel vor Schreck erstarrt nieder, überwältigt von der Kälte, dem Schmerz und der Müdigkeit.
»Meine arme Nichte war irrsinnig geworden«, fügte der Arzt nach einer kurzen Pause hinzu. »Ach, mein Herr«, fuhr er fort und ergriff Herrn d’Albons Hand, »wie entsetzlich wurde das Leben für diese kleine, so junge, so zarte Frau! Nachdem sie infolge eines unglaublichen Mißgeschicks von dem Gardegrenadier, einem gewissen Fleuriot, getrennt worden war, wurde sie zwei Jahre hindurch hinter der Armee hergeschleppt, als Spielzeug eines Haufens von Elenden. Man hat mir erzählt, daß sie mit bloßen Füßen, schlecht bekleidet, ganze Monate hindurch ohne Pflege, ohne Nahrung blieb; bald in Krankenhäusern gehalten, bald wie ein Tier weggejagt; Gott allein weiss, wieviel Unglück diese Unselige dennoch überlebt hat! Sie befand sich in einer kleinen deutschen Stadt, mit Irrsinnigen zusammengesperrt, während ihre Verwandten, die sie für tot hielten, ihre Erbschaft teilten. Im Jahre 1816 erkannte sie der Grenadier Fleuriot in einer Straßburger Herberge, wo sie angelangt war, nachdem sie eben aus ihrem Gefängnis entwichen war. Einige Bauern erzählten dem Grenadier, daß die Gräfin einen ganzen Monat in einem Walde gelebt hätte und daß sie nach ihr gejagt hätten, um sich ihrer habhaft zu machen und zu ihr gelangen zu können. Ich befand mich damals wenige Meilen von Straßburg entfernt. Als ich von einem wilden Mädchen reden hörte, hatte ich den Wunsch, die ungewöhnlichen Tatsachen festzustellen, die Grund zu so lächerlichen Erzählungen gaben. Wie wurde mir, als ich die Gräfin wiedererkannte! Fleuriot berichtete mir alles, was er von dieser traurigen Geschichte wußte. Ich nahm diesen armen Menschen mit meiner Nichte nach der Auvergne mit, wo ich das Unglück hatte, ihn zu verlieren. Er hatte ein wenig Herrschaft über Frau von Vandières. Er allein konnte bei ihr erreichen, daß sie sich ankleidete. ›Adieu!‹, dieses Wort, worin ihr ganzes Sprechen bestand, sagte sie früher nur selten. Fleuriot hatte es unternommen, einige Gedanken in ihr wieder zu erwecken; aber er war nicht weitergekommen, er hatte sie nur dazu gebracht, dieses traurige Wort etwas häufiger auszusprechen. Der Grenadier verstand sie zu zerstreuen und zu beschäftigen, indem er mit ihr spielte, und auf seine Kunst hoffte ich, aber …«
Der Onkel Stephanies schwieg einen Augenblick. »Hier«, fuhr er fort, »hat sie ein anderes Wesen gefunden, mit dem sie sich zu verstehen scheint. Das ist eine idiotische Bäuerin, die trotz ihrer Häßlichkeit und Stumpfsinnigkeit einen Maurer geliebt hat. Dieser Maurer wollte sie heiraten, weil sie einige Morgen Land besitzt. Die arme Genovefa war während eines Jahres das glücklichste Geschöpf der Welt. Sie putzte sich und ging Sonntags mit Dallot tanzen; sie verstand sich auf die Liebe; es fand sich in ihrem Herzen und in ihrem Geiste Platz für ein solches Gefühl. Aber Dallot stellte seine Überlegungen an. Er fand ein junges Mädchen, das seinen gesunden Verstand und zwei Morgen Land mehr besaß als Genovefa. Da hat Dallot Genovefa stehen gelassen. Das arme Geschöpf verlor das bißchen Intelligenz, das die Liebe bei ihr entwickelt hatte, und versteht sich nun nur noch auf Kühe hüten und Gras schneiden. Meine Nichte und dieses arme Mädchen sind gewissermaßen durch die unsichtbare Kette eines gemeinsamen Geschicks aneinander gebunden und durch das Gefühl, das ihren Irrsinn veranlaßt hat. Hier, sehen Sie«, sagte Stephanies Onkel und führte den Marquis d’Albon ans Fenster.
Der Richter bemerkte jetzt in der Tat die hübsche Gräfin auf der Erde zwischen den Beinen Genovefas sitzend; die mit einem riesigen knöchernen Kamm bewaffnete Bäuerin wendete viel Sorgsamkeit darauf, das lange schwarze Haar Stephanies durchzukämmen, die sich das gefallen ließ, indem sie erstickte Schreie von sich gab, deren Akzent ein instinktiv empfundenes Behagen verriet. Herr d’Albon erschauerte, als er die Hingebung des Körpers und die tierische Haltlosigkeit bemerkte, die bei der Gräfin die vollkommene Abwesenheit des Geistes verriet.
»Philipp, Philipp!« rief er aus, »das vergangene Unglück bedeutet ja noch nichts. Gibt es denn keine Hoffnung mehr?«, fragte er.
Der alte Arzt hob die Augen zum Himmel empor.
»Adieu, mein Herr«, sagte Herr d’Albon und drückte dem Alten die Hand. »Mein Freund erwartet mich, Sie werden ihn bald sehen.«
»Also sie ist es doch!« rief Sucy aus, nachdem er die ersten Worte des Marquis d’Albon gehört hatte.
»Ach, ich zweifelte noch daran«, fügte er hinzu und ließ einige Tränen aus seinen dunklen Augen herabfallen, deren Ausdruck ungewöhnlich ernst war.
»Ja, es ist die Gräfin von Vandières«, antwortete der Richter.
Der Oberst erhob sich jäh und kleidete sich eilig an.
»Aber Philipp!« sagte der Richter verblüfft, »wirst du verrückt?«
»Aber ich bin ja nicht mehr krank«, antwortete der Oberst einfach. »Diese Nachricht hat alle meine Schmerzen beruhigt. Und was für ein Unglück könnte ich empfinden, wenn ich an Stephanie denke. Ich gehe nach Bons-Hommes, sie sehen, mit ihr sprechen, sie heilen. Sie ist frei. Schön! Das Glück wird uns lächeln, oder es gäbe keine Vorsehung mehr. Glaubst du denn, daß diese arme Frau mich anhören könnte, ohne ihren Verstand wieder zu gewinnen?«
»Sie hat dich schon gesehen, ohne dich wiederzuerkennen«, entgegnete sanft der Richter, der, als er die übertriebene Hoffnung seines Freundes wahrnahm, versuchte, ihm heilsamen Zweifel einzuflößen. Der Oberst erzitterte. Aber er begann zu lächeln und ließ sich eine leichte Bewegung der Ungläubigkeit entschlüpfen. Niemand wagte es, dem Plan des Obersten sich zu widersetzen. Nach wenigen Stunden befand er sich in der alten Priorei bei dem Arzte und der Gräfin von Vandières.
»Wo ist sie?« rief er aus, als er ankam.
»Still!« antwortete ihm Stephanies Onkel. »Sie schläft. Dort ist sie.«
Philipp sah die arme Irre in der Sonne auf einer Bank niedergehockt. Ihr Kopf war gegen die Hitze der Luft durch einen Wald verwirrter Haare auf ihrem Gesicht geschützt; ihre Arme hingen graziös bis auf die Erde hinab; ihr Körper lag in reizvoller Stellung wie der einer Hirschkuh; ihre Füße waren ohne Mühe unter ihr zusammengebogen; ihr Busen hob sich in regelmäßigen Intervallen; ihre Haut, ihr Teint wies die Porzellanblässe, die wir so sehr auf den Gesichtern von Kindern bewundern. Unbeweglich neben ihr stehend, in der Hand einen Zweig, den Stephanie zweifellos von dem höchsten Wipfel eines Pappelbaums abgepflückt hatte, bewegte die Idiotin sanft die Blätter über ihrer eingeschlafenen Gefährtin, um die Fliegen zu verjagen und die Luft zu erfrischen. Die Bäuerin betrachtete Herrn Fanjat und den Obersten; dann, wie ein Tier, das seinen Herrn erkannt hat, wandte sie langsam den Kopf der Gräfin zu und fuhr fort, über ihr zu wachen, ohne das geringste Zeichen von Erstaunen oder Verständnis zu geben. Die Luft war glühend. Die Steinbank schien zu funkeln, und die Wiese strahlte dem Himmel diese ruhelosen Düfte entgegen, die über den Kräutern flimmern und glühen wie ein goldener Staub; aber Genovefa schien die verzehrende Hitze nicht zu spüren. Der Oberst drückte heftig die Hände des Arztes in den seinigen. Aus den Augen des Soldaten rollten Tränen die männlichen Wangen entlang und fielen auf den Rasen zu Stephanies Füßen.
»Mein Herr,« sagte der Onkel, »jetzt sind es zwei Jahre her, daß mir täglich das Herz brechen will. Bald werden Sie so weit sein wie ich. Wenn Sie nicht mehr weinen, so werden Sie Ihren Schmerz nicht um so weniger empfinden.«
»Sie haben für sie gesorgt?« sagte der Oberst, dessen Blicke ebensoviel Dankbarkeit wie Eifersucht ausdrückten.
Die beiden Männer verstanden sich; und indem sie sich von neuem die Hand drückten, blieben sie unbeweglich in der Betrachtung der herrlichen Ruhe, die der Schlaf über dieses entzückende Wesen ausbreitete. Von Zeit zu Zeit stieß Stephanie einen Seufzer aus, und dieser Seufzer, der alle Anzeichen des Gefühls zeigte, ließ den unglücklichen Obersten vor Freude erzittern.
»Ach,« sagte Herr Fanjat leise zu ihm, »täuschen Sie sich nicht, mein Herr, Sie sehen sie jetzt bei voller Vernunft.«
Wer je voller Entzücken damit beschäftigt war, ganze Stunden lang eine zärtlich geliebte Person schlafen zu sehen, deren Augen im Schlafe lächeln müßten, wird zweifellos das süße und furchtbare Gefühl begreifen, das den Obersten bewegte. Für ihn war der Schlaf eine Vorspiegelung; das Erwachen mußte für ihn den Tod bedeuten, und zwar den schrecklichsten aller Tode. Plötzlich lief eine junge Ziege in drei Sprüngen auf die Bank zu und witterte Stephanie, welche das Geräusch erweckte; sie richtete sich leicht auf den Füßen auf, ohne daß diese Bewegung das launische Tier erschreckte; aber als sie Philipp bemerkte, floh sie, von ihrem vierfüßigen Gefährten gefolgt, bis zu einer Hollunderhecke; dann ließ sie einen kleinen wilden Vogelschrei hören, den der Oberst nahe beim Gitter schon gehört hatte, wo die Gräfin Herrn d’Albon zum erstenmal erschienen war. Schließlich kletterte sie auf einen wilden Ebenholzbaum, hockte sich in dem grünen Gipfel dieses Baumes fest und fing an, den »Unbekannten« mit der Neugier der Nachtigallen des Waldes zu betrachten.
»Adieu, adieu, adieu!« sagte sie, ohne daß ihre Seele diesem Worte eine Betonung verlieh.
Es war die Gleichgültigkeit eines in der Luft singenden Vogels.
»Sie erkennt mich nicht mehr! rief der verzweifelte Oberst. »Stephanie! Das ist ja Philipp, dein Philipp, Philipp!«
Und der arme Soldat sprang auf den Baum zu; aber als er drei Schritt von ihm entfernt war, sah ihn die Gräfin an, wie um ihm zu trotzen, obwohl ein furchtsamer Ausdruck in ihrem Auge erschien; dann rettete sie sich von dem Ebenholzbaum auf eine Akazie, und von da auf eine nordische Tanne, wo sie sich von Zweig zu Zweig mit unerhörter Leichtigkeit wiegte.
»Verfolgen Sie sie nicht«, sagte Herr Fanjat zu dem Obersten. »Sie könnten zwischen ihr und sich einen unüberwindlichen Zwiespalt aufrichten; ich werde Ihnen helfen, sie kennenzulernen und sie zu zähmen. Kommen Sie auf diese Bank hier. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf diese arme Irre richten, dann werden Sie sie bald unmerklich näher kommen sehen, um Sie zu prüfen.«
»Sie! Mich nicht wiedererkennen und mich fliehen!« wiederholte der Oberst und lehnte den Rücken gegen einen Baum, dessen Blätter eine ländliche Bank beschatteten. Der Doktor verharrte stillschweigend.
Bald kam die Gräfin von dem Gipfel der Tanne sachte von oben herab, indem sie wie ein Irrlicht herabschwankte und sich zuweilen mit den Regungen des Windes mitgehen ließ, die er den Bäumen mitteilte. Bei jedem Aste hielt sie still, um nach dem Fremden auszuspähen; aber da sie ihn unbeweglich sah, sprang sie schließlich auf das Gras, stellte sich aufrecht und kam mit langsamem Schritt quer über die Wiese auf ihn zu. Als sie an einem Baum, ungefähr zehn Fuß von der Bank entfernt stand, sagte Herr Fanjat leise zu dem Obersten:
»Nehmen Sie vorsichtig in meiner rechten Tasche etliche Stücke Zucker und zeigen Sie sie ihr, sie wird dann näher kommen; ich werde zu Ihren Gunsten auf das Vergnügen verzichten, ihr einige Leckereien zu verschaffen. Mit Unterstützung des Zuckers wird sie Sie leidenschaftlich lieben, Sie werden sie gewöhnen, Ihnen näher zu kommen und Sie wieder zu erkennen.«
»Als sie ein echtes Weib war,« antwortete Philipp traurig, »hatte sie gar keinen Geschmack für Süßigkeiten.«
Als der Oberst Stephanie mit dem Stückchen Zucker winkte, das er ihr mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hinhielt, stieß sie einen neuen wilden Schrei aus und eilte auf Philipp zu; dann blieb sie stehen, von der instinktiven Furcht bewegt, die sich ihr aufdrängte; abwechselnd betrachtete sie den Zucker und wandte den Kopf ab, wie die armseligen Hunde, denen die Herren verbieten, an ein Gericht zu rühren, bevor man ihnen einen der letzten Buchstaben des Alphabets nennt, das man langsam rezitiert hat. Endlich siegte die tierische Leidenschaft über die Furcht: Stephanie stürzte sich auf Philipp, streckte schüchtern ihre hübsche braune Hand aus, um die Beute zu ergreifen, berührte die Finger ihres Geliebten, packte den Zucker und verschwand in einem Gebüsch des Waldes. Diese schauderhafte Szene schlug den Obersten vollends danieder, der in Tränen ausbrach und sich in seinen Salon flüchtete.
»Verleiht die Liebe denn weniger Mut als die Freundschaft?« sagte Herr Fanjat zu ihm: »Ich habe noch Hoffnung, Herr Baron. Meine arme Nichte war in einem viel bedauernswerteren Zustande, als dem, in dem Sie sie sehen.«
»Ist das noch möglich?« rief Philipp aus.
»Sie war nackt geblieben«, erwiderte der Mediziner. Der Oberst machte eine Schreckensgebärde und erbleichte; der Doktor glaubte in dieser Blässe einige bösen Symptome zu erkennen: er faßte ihm den Puls und fand ihn einem heftigen Fieber ausgeliefert; auf ernstliches Drängen gelang es ihm, ihn ins Bett zu bringen, und er bereitete ihm eine leichte Dosis Opium, um ihm einen ruhigen Schlaf zu verschaffen. So verliefen ungefähr acht Tage, während deren der Baron von Sucy oft mit tödlicher Angst kämpfte; bald fanden seine Augen keine Tränen mehr. Seine oft erschütterte Seele vermochte sich nicht an das Schauspiel zu gewöhnen, das ihm der Irrsinn der Gräfin darbot; aber er fand sich in gewissem Sinne mit der grausamen Lage ab und erblickte in seinem Schmerze einen Trost. Sein Heroismus kannte keine Grenzen. Er fand den Mut, Stephanie zu zähmen, indem er ihr Süßigkeiten aussuchte; er gab sich solche Mühe, ihr diese Nahrung herbeizubringen, er verstand es, die bescheidenen Eroberungen, die er dem Instinkt seiner Geliebten diesen letzten Rest ihrer Intelligenz aufdrängen wollte, so vorsichtig abzumessen, daß es ihm gelang, sie vertraulicher zu machen, als sie es jemals gewesen war.
Der Oberst stieg jeden Morgen in den Park hinunter; und wenn er, nachdem er lange Zeit nach der Gräfin gesucht hatte, nicht ahnen konnte, auf welchem Baum sie sich leicht wiegte, noch in welchem Winkel sie geklettert war, um hier mit einem Tier zu spielen, noch auf welches Dach sie geklettert war, so pfiff er den berühmten Marsch: Partant pour la Syrie, woran sich die Erinnerung an eine Szene ihrer Liebe kettete. Sogleich lief Stephanie mit der Leichtigkeit eines jungen Rehs herbei. Es war ihr so natürlich geworden, den Obersten zu sehen, daß er sie nicht mehr erschreckte; bald gewöhnte sie sich daran, sich neben ihn zu setzen, ihn mit ihrem mageren beweglichen Arm zu umfassen. In dieser, den Liebenden so teuren Haltung, gab ihr Philipp langsam einiges Zuckerzeug, für das die Gräfin eine Vorliebe hatte. Wenn sie alles aufgenascht hatte, geschah es zuweilen, daß Stephanie die Taschen ihres Freundes mit Gesten durchforschte, die die mechanische Schnelligkeit eines Affen zeigten. Wenn sie ganz sicher war, daß er nichts mehr darin hatte, betrachtete sie Philipp mit klarem Auge, ohne Gedanken, ohne ein Wiedererkennen; sie spielte dann mit ihm; sie versuchte dann, ihm die Stiefel wegzunehmen, um seinen Fuß anzusehen, sie zerriß seine Handschuhe, setzte seinen Hut auf; sie ließ ihn seine Hände in ihr Haar stecken, erlaubte ihm, sie in seine Arme zu nehmen, und empfing ohne Vergnügen glühende Küsse. Endlich sah sie ihn schweigend an, wenn er Tränen vergoß; sie begriff wohl den Pfiff von Partant pour la Syrie, aber es wollte ihm nicht gelingen, sie ihren eigenen Namen »Stephanie« aussprechen zu lassen. Philipp wurde bei seinem schrecklichen Unternehmen in einer Hoffnung festgehalten, die ihn niemals verließ. Wenn er an einem schönen Herbstvormittag die Gräfin ruhig auf einer Bank sitzend sah, unter einem gelb gewordenen Pappelbaum, lagerte sich der arme Liebende zu ihren Füßen und sah ihr so lange in die Augen, als sie ihn hineinsehen ließ, in der Hoffnung, daß das Licht, das ihr daraus entschlüpfte, wieder zur Vernunft werden würde. Manchmal bildete er sich etwas ein: er glaubte die harten und unbeweglichen Züge von neuem zitternd, weich und lebendig werden zu sehen und rief aus: »Stephanie! Stephanie! Du verstehst mich, du siehst mich!« Aber sie hörte den Ton seiner Stimme wie ein Geräusch, wie die Wirkung des Windes, der die Bäume bewegte, wie das Brüllen der Kuh, auf die sie kletterte; und der Oberst rang verzweifelt seine Hände, immer von neuen verzweifelt. Die Zeit und seine vergeblichen Versuche vermehrten nur seinen Schmerz. Eines Abends, bei ruhigem Himmel und inmitten des Schweigens und Friedens des ländlichen Asyls, bemerkte der Doktor von fern, wie der Oberst eine Pistole lud. Der alte Arzt begriff, daß Philipp keine Hoffnung mehr hatte; er fühlte, wie alles Blut ihm zu Herzen floß, und wenn er den Schwindel, der sich seiner bemächtigte, widerstand, so geschah es, weil er lieber seine Nichte lebend und irre sehen wollte als tot. Er lief herzu.
»Was machen Sie da?« sagte er.
»Das ist für mich,« antwortete der Oberst und zeigte auf eine geladene Pistole auf der Bank, »und die dort ist für sie!« fügte er hinzu und schob die Kugel in die Waffe, die er hielt.
Die Gräfin lag auf der Erde ausgestreckt und spielte mit den Kugeln.
»Sie wissen also nicht,« sagte kalt der Arzt, der seinen Schrecken verbarg, »daß sie heute Nacht im Schlafe gesagt hat: Philipp?«
»Sie hat meinen Namen genannt!« rief der Baron und ließ seine Pistole zur Erde fallen, die Stephanie wieder aufhob; aber er entriß sie ihren Händen, bemächtigte sich derjenigen, die sich auf der Bank befand, und rettete sich.
»Arme Kleine!« rief der Arzt aus, glücklich über den Erfolg, den seine List gehabt hatte. Er drückte die Irre an seinen Busen und fuhr fort: »Er hätte sie getötet, der Egoist! Er will dir den Tod geben, weil er selber leidet. Er versteht es nicht, dich um deinetwillen zu lieben, mein Kind! Wir werden ihm vergeben, nicht wahr? Er ist unsinnig, und du, du bist nur irre. Gott, mein Liebling, soll dich allein an ihn erinnern. Wir halten dich für unglücklich, weil du an unserem Elend nicht teilnimmst, töricht wie wir sind! Du aber,« sagte er und setzte sie auf seine Knie, »du bist glücklich, nichts stört dich; du lebst wie eine Hirschkuh.«
Sie sprang auf eine junge Amsel los, die hüpfte, packte sie mit einem kleinen Schrei der Genugtuung, erstickte sie, sah die Tote an und ließ sie am Fuße eines Baumes liegen, ohne weiter an sie zu denken.
Als der nächste Morgen tagte, stieg der Oberst in die Gärten hinab. Er suchte Stephanie, er glaubte an sein Glück; und als er sie nicht fand, pfiff er nach ihr. Als die Geliebte herangekommen war, nahm er sie beim Arm und ging mit ihr zum erstenmal in gleichem Schritt, sie begaben sich in ein Gesträuch verblühender Bäume, von denen im Morgenwinde Blätter herabfielen. Der Oberst setzte sich, und Stephanie lehnte sich von selbst an ihn. Philipp zitterte vor Freude.
»Meine Geliebte,« sagte er und küßte mit glühender Liebe die Hände der Gräfin, »ich bin Philipp.«
Sie sah ihn voll Neugierde an.
»Komm«, fügte er hinzu und preßte sie an sich. »Fühlst du, wie mein Herz schlägt? Es hat nur für dich geschlagen. Ich liebe dich noch immer … Philipp ist nicht tot: er ist hier … Du bist bei ihm … Du bist meine Stephanie, und ich bin dein Philipp.«
»Adieu!« sagte sie, »adieu!«
Der Oberst erzitterte, denn er glaubte zu bemerken, daß seine Erregung sich seiner Geliebten mitteilte. Sein zerreißender Schrei, von der Hoffnung angestachelt, diese letzte Anstrengung einer ewigen Liebe, einer verzehrenden Leidenschaft, würde die Vernunft seiner Geliebten erwecken.
»Ach, Stephanie! Wir werden glücklich sein!«
Sie ließ sich einen Schrei der Genugtuung entschlüpfen, und ihre Augen zeigten einen warmen Schimmer von Intelligenz.
»Sie erkennt mich wieder! Stephanie!«
Der Oberst fühlte sein Herz schwellen und seine Augen feucht werden. Aber er sah plötzlich die Gräfin ihm ein Stückchen Zucker zeigen, das sie gefunden hatte, als sie ihn durchsuchte, während er sprach. Er hatte also für einen menschlichen Gedanken diesen Grad von Verstand gehalten, den die List des Affen voraussetzt. Philipp verlor die Besinnung. Herr Fanjat fand die Gräfin auf dem Körper des Obersten sitzend. Sie biß zum Zeichen ihres Vergnügens in ihren Zucker mit einer Schöntuerei, die man bewundert hätte, wenn sie, im Besitz ihrer Vernunft, zum Spaß ihren Papagei oder ihre Katze hätte nachahmen wollen.
»Ach, mein Freund!« rief Philipp aus, als er wieder zur Besinnung kam, »ich sterbe alle Tage, alle Augenblicke! Ich liebe sie zu sehr! Alles würde ich ertragen haben, wenn sie in ihrem Irrsinn ein klein wenig von weiblichem Charakter beibehalten hätte. Aber sie immer wie eine Wilde sehen und selbst schamlos, sie sehen …«
»Sie wollen also einen Opernirrsinn haben«, sagte bitter der Doktor, »und die Hingebung Ihrer Liebe ist Vorurteilen unterworfen? Wie, mein Herr, ich habe mich des trüben Glücks beraubt, meine Nichte zu ernähren, ich habe Ihnen das Vergnügen überlassen, mit ihr zu spielen, und mir nur die drückendsten Lasten vorbehalten … Während Sie schlafen, wache ich über sie, ich … Nein, mein Herr, überlassen Sie sie mir wieder. Verlassen Sie diese traurige Einsiedelei. Ich kann mit diesem teuren kleinen Wesen leben; ich verstehe ihren Irrsinn, ich spähe ihre Gesten aus, ich kenne ihre Geheimnisse. Eines Tages werden Sie mir dafür danken.«
Der Oberst verließ Bons-Hommes, um nur noch einmal dorthin zurückzukehren. Der Doktor war betroffen von der Wirkung, die er bei seinem Gast hervorgerufen hatte; er begann ihn gleichermaßen zu lieben wie seine Nichte. Wenn von den beiden Liebenden der eine des Mitleids wert war, so war es sicher Philipp: trug er nicht für sich selbst allein die Last eines schrecklichen Schmerzes? Der Arzt zog Erkundigungen über den Oberst ein und erfuhr, daß der Unglückliche sich auf ein Gut geflüchtet hatte, das er in der Nähe von Saint-Germain besaß. Der Baron hatte, unter der Eingebung eines Traums, einen Plan gefaßt, um der Gräfin den Verstand wiederzugeben. Ohne Wissen des Doktors verwandte er den Rest des Herbstes auf die Vorbereitungen zu diesem gewaltigen Unternehmen. Ein Flüßchen lief durch seinen Park, wo es im Winter einen großen Sumpf überschwemmte, der fast demjenigen glich, der sich längs des rechten Ufers der Beresina ausbreitete. Das Dorf Satout, das auf einem kleinen Hügel lag, rahmte diese Szene des Schreckens ein, wie Studzianka die Niederung der Beresina umschloß. Der Oberst nahm eine Anzahl Arbeiter an und ließ einen Kanal ziehen, der den reißenden Fluß darstellte, wo die Schätze Frankreichs untergegangen waren, Napoleon und seine Armee. Mit Hilfe seiner Erinnerung gelang es Philipp, in seinem Park das Ufer nachzubilden, wo der General Eblé seine Brücken errichtet hatte. Er pflanzte Büsche und ließ sie anzünden, um dadurch die geschwärzten und halb verbrauchten Bretter darzustellen, die auf beiden Seiten des Ufers den Nachzüglern bezeugt hatten, daß der Weg nach Frankreich ihnen versperrt war. Der Oberst ließ Holztrümmer herbeischleppen, ähnlich denen, deren sich seine Unglücksgefährten bedient hatten, um ihr Fahrzeug zu konstruieren. Er verwüstete seinen Park, um die Illusion vollkommen zu machen, auf die er seine letzte Hoffnung baute. Er beschaffte zerlumpte Uniformen und Kleider, um mehrere hundert Bauern darein zu kleiden. Er errichtete Hütten, Biwaks, Batteriestände, die er in Brand setzte. Kurz er vergaß nichts von alledem, was geeignet war, die schrecklichste aller Szenen nachzubilden, und er erreichte sein Ziel. Um die ersten Tage des Monats Dezember, als der Schnee die Erde mit einem dicken weißen Mantel bedeckt hatte, erkannte er die Beresina wieder. Dieses falsche Rußland war von einer so erschreckenden Wirklichkeit, daß auch mehrere seiner Waffengefährten die Szene ihrer ehemaligen Leiden wiedererkannten. Herr von Sucy hütete das Geheimnis dieser tragischen Darstellung, über die zu jener Zeit sich mehrere Pariser Gesellschaftskreise wie über eine Narrheit unterhielten.
Zu Beginn des Monats Januar 1820 bestieg der Oberst einen Wagen, ähnlich dem, der Herr und Frau von Vandières von Moskau nach Studzianka geführt hatte, und wandte sich nach dem Walde von Ile-Adam. Der Wagen wurde von Pferden gezogen, die fast denen glichen, die er bei Gefahr seines Lebens aus den Reihen der Russen geholt hatte. Er trug die beschmutzten und bizarren Kleider, die Waffen, die Kopfbedeckung, die er am 29. November 1812 anhatte. Er hatte sogar Bart und Haare lang wachsen lassen und sein Gesicht vernachlässigt, damit nichts an dieser scheußlichen Wirklichkeit fehlte.
»Ich habe Ihr Kommen geahnt,« rief Herr Fanjat, als er den Oberst aus dem Wagen steigen sah. »Wenn Sie wünschen, daß Ihr Projekt glückt, dann zeigen Sie sich nicht in diesem Aufzug. Heute Abend werde ich meine Nichte etwas Opium nehmen lassen. Während sie schläft, werden wir sie wie bei Studzianka anziehen und werden sie in diesen Wagen setzen. Ich folge Ihnen in einem Reisewagen.«
Etwa um zwei Uhr morgens wurde die junge Gräfin in den Wagen getragen, auf Kissen gebettet und in eine grobe Decke eingehüllt. Einige Bauern hielten Licht bei dieser einzigartigen Entführung. Plötzlich erscholl ein durchdringender Schrei in der Stille der Nacht. Philipp und der Arzt wandten sich um und erblickten Genovefa, die halbnackt aus der Kammer kam, in der sie schlief.
»Adieu, adieu! Es ist zu Ende, adieu!« rief sie, heiße Tränen weinend.
»Nun, was hast du denn, Genovefa?« sagte Herr Fanjat zu ihr.
Genovefa schüttelte den Kopf mit einer Bewegung der Verzweiflung, hob die Arme gen Himmel, blickte den Wagen an, stieß einen langen Klageton aus, gab sichtliche Zeichen eines tiefen Schreckens und kehrte schweigend ins Haus zurück.
»Das ist ein gutes Vorzeichen«, rief der Oberst. »Dieses Mädchen bedauert, keine Gefährtin mehr zu haben. Sie sieht vielleicht, daß Stephanie den Verstand wiederfinden wird.
»Gott wolle es!« sagte Herr Fanjat, der von diesem Zwischenfall tiefbewegt zu sein schien. Seitdem er sich mit dem Irrsinn beschäftigte, hatte er mehrfache Beispiele prophetischen Geistes und der Gabe des zweiten Gesichts angetroffen, von denen einige Proben von Geisteskranken gegeben worden sind, und die, nach den Erzählungen mehrerer Reisender, auch bei den wilden Völkern zu finden sind.
So wie es der Oberst berechnet hatte, durchquerte Stephanie die vermeintliche Niederung der Beresina etwa um 9 Uhr morgens; sie wurde durch einen Böllerschuß geweckt, der hundert Schritt von dem Ort entfernt abgefeuert wurde, wo die Szene stattfand. Das war das Signal. Tausend Bauern stießen ein schreckliches Geschrei aus, ähnlich dem Verzweiflungsruf, der die Russen erschreckte, als zwanzigtausend Nachzügler sich durch ihre Schuld dem Tode oder der Sklaverei ausgeliefert sahen. Bei diesem Schrei, bei diesem Kanonenschuß sprang die Gräfin aus dem Wagen, rannte mit rasender Angst auf den schneebedeckten Platz, sah die verbrannten Biwaks und das unglückselige Floß, das man in die vereiste Beresina hinabließ. Dort stand der Major Philipp und ließ seinen Säbel über der Menge wirbeln. Frau von Vandières ließ einen Schrei ertönen, der alle Herzen erstarren machte, und stellte sich vor den Oberst hin, der krampfhaft zusammenzuckte. Sie sammelte sich und blickte zunächst unbestimmt dieses fremde Bild an. Während eines Moments, so kurz wie der Blitz, gewannen ihre Augen die entblößte Klarheit der Intelligenz, die wir in dem erstaunten Auge der Vögel bewundern; dann legte sie die Hand an die Stirn mit dem lebhaften Ausdruck eines Menschen, der nachdenkt, sie erfaßte diese starke Erinnerung, dieses verflossene Erlebnis, das ausgebreitet vor ihr lag, wandte lebhaft den Kopf zu Philipp hin und erkannte ihn. Ein schreckliches Schweigen lastete auf der Menge. Der Oberst seufzte und wagte nicht zu sprechen; der Doktor weinte. Stephanies schönes Gesicht färbte sich schwach; dann, in allmählicher Steigerung, gewann sie den Glanz eines vor Frische strahlenden jungen Mädchens. Ihr Gesicht bekam eine schöne Purpurfarbe. Leben und Glück, angefacht durch eine blitzende Einsicht, nahmen immer mehr zu gleich einer Feuersbrunst. Ein konvulsives Zittern breitete sich von den Füßen bis zum Herzen aus. Dann vereinigten sich diese Erscheinungen, die einen Moment aufleuchteten, gleichsam zu einem gemeinsamen Band, als die Augen Stephanies einen himmlischen Funken, eine bewegte Flamme ausstrahlten. Sie lebte, sie dachte! Sie schauderte, vor Schrecken vielleicht! Gott selbst löste zum zweitenmal die erstorbene Zunge und warf von neuem sein Feuer in diese erloschene Seele. Der menschliche Wille erwuchs mit seinen elektrischen Strömen und belebte diesen Körper, von dem er so lange abwesend gewesen war.
»Stephanie!« schrie der Oberst.
»Oh! das ist Philipp,« sagte die arme Gräfin.
Sie stürzte sich in die zitternden Arme, die der Oberst ihr entgegenstreckte, und die Umarmung der beiden Liebenden erschütterte die Zuschauer. Stephanie floß in Tränen. Plötzlich legte sich ihr Weinen, sie wurde leblos, als wenn der Blitz sie gerührt hätte, und hauchte mit schwacher Stimme: »Adieu, Philipp! Ich liebe dich, adieu!«
»Oh, sie ist tot!« rief der Oberst, indem er die Arme öffnete.
Der alte Arzt fing den leblosen Körper seiner Nichte auf, umarmte sie, wie es ein junger Mann getan hätte, trug sie fort und setzte sich mit ihr auf einen Holzhaufen. Er blickte die Gräfin an und legte ihr seine kraftlose und krampfhaft zuckende Hand aufs Herz. Das Herz schlug nicht mehr.
»So ist es also wahr?« sagte er, indem er abwechselnd den unbeweglichen Oberst und das Gesicht Stephanies betrachtete, über das der Tod eine strahlende Schönheit, eine flüchtige Glorie ausbreitete, das Pfand vielleicht einer glänzenden Zukunft.
»Ja, sie ist tot.
»Ach, dieses Lächeln!« rief Philipp, »sehen Sie nur dieses Lächeln! Ist es möglich?«
»Sie ist schon kalt«, erwiderte Herr Fanjat.
Herr von Sucy machte einige Schritte, um sich von diesem Schauspiel loßzureißen; aber er hielt an, pfiff das Lied, das die Irre kannte, und als er seine Geliebte nicht kommen sah, entfernte er sich mit schwankendem Schritt, wie ein Trunkener, immer pfeifend, aber ohne sich noch einmal umzusehen.
Der General Philipp von Sucy galt in der Gesellschaft als ein sehr liebenswürdiger und namentlich als ein sehr heiterer Mann. Vor einigen Tagen beglückwünschte ihn eine Dame wegen seiner guten Laune und der Beständigkeit seines Charakters.
»Ach, meine Gnädige,« sagte er, »ich bezahle meine Späße recht teuer, des Abends, wenn ich alleine bin!«
»Sind Sie denn jemals allein?«
»Nein,« antwortete er lächelnd.
Wenn ein kluger Beobachter der menschlichen Natur in diesem Augenblick den Ausdruck des Grafen von Sucy hätte beobachten können, würde er vielleicht geschaudert haben.
»Warum heiraten Sie nicht?« fuhr jene Dame fort, die selbst mehrere Töchter in einem Pensionat hatte. »Sie sind reich, Standesperson, von altem Adel; Sie haben Talente, Sie haben noch eine Zukunft, alles lächelt Ihnen zu.«
»Jawohl«, erwiderte er, »aber es ist ein Lächeln, das mich tötet.«
Am nächsten Tage erfuhr die Dame voll Erstaunen, daß Herr von Sucy sich während der Nacht eine Kugel vor den Kopf geschossen hatte. Die gute Gesellschaft unterhielt sich verschiedentlich über dieses außergewöhnliche Ereignis, und jeder suchte nach dem Grunde. Je nach dem Geschmack des Beurteilers wurden das Spiel, die Liebe, der Ehrgeiz, verborgene Ausschweifungen als Erklärung gegeben für diese Katastrophe, die letzte Szene eines Dramas, das im Jahre 1812 begonnen hatte. Zwei Menschen allein, ein Beamter und ein alter Arzt, wußten, daß der Graf von Sucy einer jener starken Menschen war, denen Gott die unglückselige Kraft verleiht, alle Tage siegreich aus einem furchtbaren Kampf hervorzugehen, den sie einem unbekannten Schrecken liefern. Und daß sie, wenn in einem Augenblick Gott ihnen seine mächtige Hand entzieht, unterliegen.