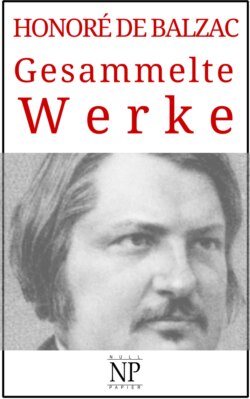Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 18
8
ОглавлениеHerr Molineux war ein kleiner komischer Rentier, wie solche nur in Paris existieren, ebenso wie eine gewisse Art Moos nur in Island wächst. Dieser Vergleich ist um so treffender, als dieser Mensch ein Zwitterwesen war, das einem Tier-Pflanzenreich angehörte, wie es ein neuer Mercier aus Cryptogamen zusammenstellen könnte, die auf, in, oder unter dem Mauerputz verschiedener eigenartiger und ungesunder Häuser aufsprossen, blühen und absterben, wo diese Wesen mit Vorliebe erscheinen. Beim ersten Anblick zeigte diese doldentragende Menschenpflanze, wie man mit Rücksicht auf ihre blaue röhrenförmige Mütze, die sie bekrönte, sagen kann, mit ihrem von einer grünlichen Hose umkleideten Stengel und ihren von Bänderschuhen umhüllten zwiebelartigen Wurzeln eine blasse, glatte Physiognomie, die nichts von Gift verriet. In diesem merkwürdigen Produkt mußte man den Leichtgläubigen par excellence erkennen, der alle Nachrichten, die die Presse mit ihrer Tinte tauft, glaubt, und der alles gesagt zu haben meint, wenn er sagt: Lesen Sie nur die Zeitung! Der Bourgeois, der ja im Grunde durchaus ein Freund der Ordnung ist, revoltiert stets innerlich gegen die herrschende Macht, gehorcht ihr aber immer; er ist als Masse schwach, aber im einzelnen grimmig, gefühllos wie ein Gerichtsvollzieher, wenn es sich um sein Recht handelt, aber seine Vögel mit frischem Samen und seine Katze mit Fischgräten fütternd; ein Mensch, der das Ausschreiben einer Mietsquittung unterbrach, um seinem Kanarienvogel etwas vorzupfeifen, mißtrauisch wie ein Gefängniswärter, steckte er Geld in irgendein schlechtes Geschäft, um den Verlust dann durch den schmutzigsten Geiz wieder einzubringen. Die Bösartigkeit dieser Bastardpflanze zeigte sich erst beim Gebrauch; ihre ekelhafte Bitterkeit verlangte danach, bei irgendeinem Geschäft, wo ihre Interessen mit denen von Menschen verknüpft waren, ins Kochen zu geraten. Wie alle Pariser hatte auch Molineux ein Herrschbedürfnis, er verlangte seinen mehr oder weniger bedeutenden Anteil am Regieren, den jeder, selbst ein Portier, über ein Schlachtopfer irgendwelcher Art auszuüben wünscht, über die Frau, das Kind, den Mieter, den Angestellten, das Pferd, den Hund oder den Affen, denen man, um sich schadlos zu halten, die Demütigungen zurückgibt, die man selbst in der höheren Sphäre, nach der man strebt, hat hinnehmen müssen. Dieser kleine langweilige Alte hatte nun weder Weib, noch Kind, noch Neffen, noch Nichte; seine Aufwartefrau behandelte er so grob, daß er kein Aschenbrödel aus ihr machen konnte, denn sie vermied jede Berührung mit ihm, wenn sie ihren Dienst verrichtete. Sein Verlangen, zu tyrannisieren, wurde hier also nicht erfüllt; um es anderweitig zu befriedigen, hatte er geduldig die gesetzlichen Bestimmungen über Mietsverträge und die Grenzmauern studiert, hatte sich in die Jurisprudenz vertieft, soweit sie sich auf den Pariser Hausbesitz bezieht, und zwar mit all den unzähligen Nebenumständen, wie Servituten, Steuern, Lasten, Kehrerlohn, Teppichaushängen am Fronleichnamsfest, Abflußrohren, Beleuchtung, Vorspringen in die Baufluchtlinie, Nachbarschaft von gesundheitsgefährdenden Fabriken. Seine Mittel; seine Tätigkeit, sein ganzes Denken lief darauf hinaus, seinen Beruf als Hausbesitzer in voller Kriegsbereitschaft zu halten; er trieb das zu seinem Vergnügen und das Vergnügen wurde zu einer fixen Idee. Er liebte es auch, seine Mitbürger gegen jede Gesetzwidrigkeit zu beschützen; aber er hatte nur selten Gelegenheit zu Beschwerden, und so hatte er sich mit seiner Leidenschaft auf seine Mieter gestürzt. Sein Mieter wurde sein Feind, sein Untergebener, sein Subjekt, sein Lehnsmann; er glaubte ein Anrecht auf seinen Respekt zu haben und hielt ihn für einen ungeschliffenen Menschen, wenn dieser ihm auf der Treppe begegnete, ohne ihn anzusprechen. Die Mietsquittungen schrieb er eigenhändig aus und übersandte sie am Zahltage um zwölf Uhr. Blieb der Mieter im Verzuge, so erhielt er zu bestimmter Stunde die Mahnung, dann erfolgte sofort die Möbelbeschlagnahme, die Verurteilung in die Kosten – der ganze Galopp der Rechtsmittel wurde mit einer Schnelligkeit in Bewegung gesetzt, wie der Scharfrichter seine »Maschine« handhabt. Molineux bewilligte weder einen andern Zahltag, noch einen Aufschub; in Mietsachen hatte er an Stelle des Herzens einen Knorpel. »Wenn Sie es nötig haben, will ich Ihnen Geld borgen,« sagte er zu einem zahlungsfähigen Manne, »aber Ihre Miete müssen Sie pünktlich bezahlen, jede Verzögerung bringt einen Zinsverlust für mich mit sich, für den uns das Gesetz nicht entschädigt.« – Nachdem er lange die phantastischen Launen der Mieter studiert hatte, die nie die gleichen waren und einander in der Weise folgten, daß der Nachfolger alles wieder anders einrichtete, hatte er sich ein bestimmtes Prinzip ausgedacht, an dem er unverbrüchlich festhielt. Er ließ grundsätzlich keine Reparaturen ausführen; die Kamine rauchten nicht, die Treppen waren sauber, die Zimmerdecken weiß, die Gesimse unversehrt, die Fußböden saßen fest auf ihren Balken, der Anstrich war in Ordnung; die Schlösser waren nicht älter als drei Jahre, keine Fensterscheibe fehlte, Löcher gab es nicht, Risse im Fußboden wurden nur sichtbar beim Ausziehen; wurde ihm die Wohnung wieder übergeben, so übernahm er sie in Gegenwart eines Schlossers, eines Malers und eines Glasers, sehr entgegenkommenden Leuten, wie er sagte. Dem neuen Mieter stand es dann frei, die Wohnung zu restaurieren; wenn der Unglückliche das aber machte, so grübelte der kleine Molineux Tag und Nacht darüber, wie er ihn wieder herausbringen könne, um über die neu in Ordnung gebrachte Wohnung wieder zu verfügen: er spionierte ihn aus, er paßte ihm auf und ließ eine ganze Serie übler Machenschaften gegen ihn los. Er kannte alle Finessen der Pariser Gesetzesbestimmungen über Mietverträge. Händelsüchtig und schreibwütig, verfaßte er sanfte, höfliche Briefe an seine Mieter; aber hinter seinem Stil, wie hinter seiner süßlichen und zuvorkommenden Miene verbarg sich die Seele eines Shylock. Er ließ sich immer halbjährlich voraus bezahlen, um beim Ablauf des Vertrages mit Bezug auf den langen Schwanz all der dornigen Bedingungen, die er ausgeheckt hatte, aufrechnen zu können. Er überzeugte sich stets, ob die eingebrachten Möbel genügend Deckung für den Mietzins gewährten. Über jeden neuen Mieter zog er genaue Erkundigungen ein, denn gewisse Berufe wollte er nicht aufnehmen, und der geringste Hammerschlag erschreckte ihn. Wenn dann ein Vertrag zu unterzeichnen war, hob er ihn erst bei sich auf und buchstabierte ihn erst acht Tage lang durch, denn er hatte Angst vor dem »et cetera« des Notars. Abgesehen von seinen fixen Ideen als Hausbesitzer war Jean-Baptiste Molineux ein guter, hilfsbereiter Kerl, er spielte seinen Boston, ohne zu schimpfen, wenn ihn sein Mitspieler im Stiche ließ; er lachte über das, worüber die Bourgeois zu lachen, redete über das, worüber sie zu reden pflegen, über die Willkürakte der Bäcker, die die Frechheit hatten, einem falsches Gewicht zu verkaufen, über die Polizei und über die heldenmütigen siebzehn Abgeordneten der Linken. Er las den »Bon Sens« des Pfarrers Meslier und ging zur Messe, da er sich zwischen Deismus und Christentum nicht zu entscheiden vermochte; aber die Hostie wies er niemals zurück und beklagte sich dann, daß er sich den um sich greifenden Anmaßungen der Geistlichkeit entziehen müsse. Über diesen Punkt schrieb er unermüdlich Petitionsbriefe an die Zeitungen, die diese weder abdruckten, noch zurücksandten. Im ganzen war er ein achtbarer Bourgeois, der am Weihnachtsabend feierlich seinen Holzkloben ins Feuer legt, den Dreikönigstag feiert, Aprilscherze ersinnt, bei schönem Wetter auf allen Boulevards zu sehen ist, den Schlittschuhläufern zuschaut und schon um zwei Uhr, mit einem Butterbrot in der Tasche, auf der Place Louis XV. erscheint, um an den Tagen, wo hier Feuerwerk abgebrannt wird, vornan zu stehen.
Der Holländische Hof, wo dieser kleine Alte wohnte, ist das Produkt einer jener verzwickten Terrainspekulationen, aus denen man nicht mehr klug wird, sobald es fertig ist. Dieses klosterartige Bauwerk mit inneren Arkaden und Galerien war aus Quadersteinen errichtet und am Ende des Hofes mit einem Brunnen geschmückt, aber einem durstigen Brunnen, der sein Löwenmaul weniger zum Speien von Wasser öffnete, als um alle Passanten um welches zu bitten; zweifellos hatte man auch das Stadtviertel Saint-Denis mit einer Art von Palais-Royal ausstatten wollen. Dieser ungesunde, auf allen vier Seiten von hohen Häusern umgebene Bau ist nur am Tage etwas belebt; er ist das Zentrum der dunklen Passagen, die hier zusammentreffen und das Viertel der Hallen mit dem Viertel Saint-Martin durch die berüchtigte Rue Quincampoix verbinden, feuchte Fußwege, in denen sich eilige Leute Rheumatismus holen; Nachts aber ist es die einsamste Stelle von Paris, man möchte es die Handelskatakomben nennen. Man findet hier verschiedene übelriechende Gewerbebetriebe, sehr wenig Holländer und viele Gewürzkrämer. Natürlich haben die Zimmer dieses Handelspalastes keine andere Aussicht als auf den gemeinsamen Hof, nach dem alle Fenster gehen, daher sind auch die Mieten hier äußerst niedrig. Herr Molineux wohnte hier in einer Eckwohnung, und zwar aus Gesundheitsrücksichten im sechsten Stock: die Luft war doch erst in einer Höhe von siebzig Fuß über dem Erdboden rein. Hier genoß der biedere Hausbesitzer den entzückenden Anblick der Mühlen auf dem Montmartre, wenn er sich zwischen den Dachrinnen, wo er Blumen zog, ohne Rücksicht auf die Polizeivorschriften bezüglich der hängenden Gärten des modernen Babylons, erging. Seine Wohnung bestand aus vier Zimmern, wozu noch sein kostbarer Dachboden in dem obersten Stockwerk kam: er besaß den Schlüssel dazu, er gehörte ihm, er hatte ihn eingerichtet, damit war für ihn in dieser Beziehung alles in Ordnung. Trat man bei ihm ein, so zeigte die unanständige Kahlheit sofort seinen Geiz an: im Vorzimmer standen sechs Strohstühle und ein Kachelofen, die Wände waren mit einer flaschengrünen Tapete beklebt und mit vier auf Auktionen gekauften Stichen geschmückt; im Speisezimmer befanden sich zwei Schränke, zwei Vogelbauer voll Vögel, ein mit Wachstuch überzogener Tisch, ein Barometer, eine Fenstertür, die nach den hängenden Gärten hinausführte, und mit Roßhaarstoff überzogene Mahagonistühle; der Salon hatte kleine Fenstervorhänge aus alter grüner Seide und weiße, mit grünem Utrechter Sammet überzogene Möbel. Das Schlafzimmer des alten Junggesellen hatte Möbel im Stil Ludwigs XV., die infolge des langen Gebrauchs so aussahen, daß eine in Weiß gekleidete Dame Furcht gehabt hätte, sich auf ihnen schmutzig zu machen. Der Kamin war mit einer von zwei Säulen getragenen Uhr geschmückt, zwischen denen ein Zifferblatt als Postament für eine lanzenschwingende Pallas diente: eine mythologische Darstellung. Der Fußboden war mit Schüsseln voller Speisereste für die Katzen so bedeckt, daß man befürchten mußte, hineinzutreten. Über einer Kommode aus Rosenholz hing ein Pastellbild (Molineux als junger Mann). Dazu einige Bücher, Tische mit gemeiner grüner Pappe bedeckt und auf einer Konsole seine ausgestopften seligen Kanarienvögel; das Bett endlich verbreitete eine Kälte, daß es einen Karmelitermönch abgeschreckt hätte.
Cäsar Birotteau war entzückt von der ausgesuchten Höflichkeit Molineux’, den er in einem grauen Schlafrock vorfand, wie er seine Milch überwachte, die auf einem Blechwärmer in einem Kaminwinkel stand, und sein Kaffeewasser, das in einem kleinen grünen irdenen Topf kochte und das er in kleinen Portionen in seine Kaffeekanne goß. Um seinen Hauswirt nicht zu bemühen, hatte der Schirmhändler Birotteau die Tür geöffnet. Molineux besaß eine große Hochachtung vor den Bürgermeistern und Beigeordneten von Paris, die er »seine städtischen Offiziere« nannte. Als er den Kommunalbeamten erblickte, erhob er sich und blieb mit dem Käppchen in der Hand stehen, bis sich der große Birotteau gesetzt hatte.
»Nein, verehrter Herr; ja, verehrter Herr; ach, mein verehrter Herr, wenn ich geahnt hätte, daß mir die Ehre zuteil werden würde, im Schoße meiner bescheidenen Penaten ein Mitglied der Pariser städtischen Verwaltung empfangen zu sollen, seien Sie überzeugt, daß ich es mir zur Pflicht gemacht hätte, meinerseits Sie aufzusuchen, obgleich ich Ihr Hausbesitzer bin, oder wenigstens im Begriffe bin, es zu werden.« Birotteau deutete an, daß er sein Käppchen wieder aufsetzen möchte. »Nein, das tue ich nicht, ich setze es nicht eher auf, als bis Sie Platz genommen und sich selbst bedeckt haben, falls Sie etwa erkältet sein sollten; mein Zimmer ist etwas kalt, meine bescheidenen Einkünfte gestatten mir nicht … Zur Gesundheit, Herr Beigeordneter.«
Birotteau hatte geniest, als er seinen Vertrag hervorsuchte. Er überreichte ihn, nicht ohne hinzuzufügen, um alle Verzögerungen zu verhindern, daß Herr Roguin, der Notar, ihn auf seine Kosten aufgesetzt habe.
»Ich bestreite nicht etwa die glänzenden Fähigkeiten des Herrn Roguin, ein unter dem Pariser Notariat wohlbekannter Name; aber ich habe so meine kleinen Gewohnheiten, ich besorge meine Geschäfte selbst, eine entschuldbare Eigenheit, und mein Notar ist …«
»Aber unser Geschäft ist ja ein so einfaches«, sagte der Parfümhändler, der an die schnellen Entscheidungen der Kaufleute gewöhnt war.
»Ein so einfaches?« rief Molineux aus. »In Mietsachen ist nichts einfach. Ach, Sie sind nicht Hausbesitzer, Herr Birotteau, um so besser für Sie. Wenn Sie wüßten, bis zu welchem Grade die Mieter es an Entgegenkommen fehlen lassen, und was für Vorsichtsmaßregeln wir treffen müssen! Hören Sie, da hatte ich einen Mieter …«
Und Molineux erzählte eine Stunde lang, wie der Zeichner Gandrin die Wachsamkeit seines Portiers in der Rue Saint-Honoré vereitelt hatte. Der Herr Gandrin hatte Scheußlichkeiten verübt, die eines Marat würdig waren, obszöne Zeichnungen angefertigt, was die Polizei duldete, soweit geht die Lässigkeit der Polizei! Dieser Gandrin, ein von Grund aus unmoralischer Künstler, brachte leichtfertige Weiber mit nach Hause und machte damit die Treppe unbenutzbar! Ein Streich, der zu einem Menschen paßte, der Karikaturen auf die Regierung zeichnete. Und weshalb alle diese Schlechtigkeiten? … Weil man am 15. die Miete von ihm verlangte! Es kam zur Klage zwischen Gandrin und Molineux, denn obwohl er nicht bezahlte, wollte der Künstler die Wohnung nicht räumen. Molineux bekam anonyme Briefe, zweifellos von Gandrin, in denen er mit dem Tode bedroht wurde, wenn er sich abends in den Winkeln des Holländischen Hofes blicken ließe.
»Das ging so weit, Herr Birotteau,« fuhr er fort, »daß der Herr Polizeipräfekt, dem ich meine Not klagte … (ich habe dabei die Gelegenheit benutzt, um ihm einige Anregungen über Änderungen der Gesetze, die sich auf diese Materie beziehen, zu geben), mich autorisiert hat, zu meiner persönlichen Sicherheit mir Pistolen anzuschaffen.«
Der kleine Alte stand auf und holte seine Pistolen. »Hier sind sie, Herr Birotteau!« rief er aus.
»Aber von mir, lieber Herr, haben Sie doch nichts dergleichen zu befürchten«, sagte Birotteau und warf Cayron einen lächelnden Blick zu, in dem sich etwas von Mitleid über einen solchen Menschen malte.
Molineux, der diesen Blick bemerkt hatte, fühlte sich beleidigt durch eine solche Kundgebung von Seiten eines städtischen Beamten, der doch die seiner Verwaltung Unterstehenden schützen müßte. Was er jedem andern verziehen hätte, konnte er Birotteau nicht verzeihen.
»Verehrter Herr,« begann er wieder in trockenem. Tone, »einer der geachtetsten Handelsrichter, ein Beigeordneter, ein ehrenwerter Kaufmann braucht sich mit solchen Kleinigkeiten, denn es sind Kleinigkeiten, nicht zu befassen. Aber in dem hier vorliegenden Falle kommt das Durchbrechen einer Mauer in Betracht, zu dem Ihr Hauswirt, der Herr Graf von Grandville, seine Genehmigung erteilen muß, es muß eine Abrede getroffen werden, daß der Durchbruch nach Ablauf der Mietzeit wieder beseitigt wird; schließlich ist der Mietzins ungewöhnlich niedrig, er muß steigen, die Place Vendôme wird sich im Werte heben, sie tut das schon! Die Rue Castiglione wird gebaut werden! Ich binde mich … ich binde mich …«
»Kommen wir zu einem Ende«, sagte der verblüffte Birotteau. »Wieviel verlangen Sie? Ich bin genügend Geschäftsmann, um zu wissen, daß alle Ihre Bedenken vor dem wichtigeren Bedenken, wieviel ich zahle, zum Schweigen gebracht werden. Also, wieviel verlangen Sie?«
»Ich stelle nur eine angemessene Forderung, Herr Beigeordneter. Auf wie lange wollen Sie mieten?«
»Auf sieben Jahre«, erwiderte Birotteau.
»Was wird nicht in sieben Jahren mein erster Stock für einen Wert haben!« sagte Molineux. »Wie teuer werden dann zwei möblierte Zimmer in diesem Viertel bezahlt werden? Vielleicht mit mehr als zweihundert Franken monatlich! Ich binde mich, ich binde mich durch einen solchen Vertrag. Wir wollen also den Mietzins auf fünfzehnhundert Franken festsetzen. Bei diesem Mietpreis erkläre ich mich damit einverstanden, daß die beiden Zimmer von der Mietwohnung des Herrn Cayron hier«, sagte er und warf einen scheelen Blick auf den Händler, »abgetrennt werden, und willige in einen Mietvertrag mit Ihnen auf sieben hintereinander folgende Jahre. Die Kosten des Durchbruchs tragen Sie, nachdem Sie mir die Einwilligung und den Verzicht auf alle Rechte seitens des Herrn Grafen von Grandville übergeben haben. Für alles, was bei diesem kleinen Durchbruch passiert, haften Sie und übernehmen die Verpflichtung, die Mauer, soweit sie mich angeht, wiederherzustellen, wofür ich eine Entschädigung von fünfhundert Franken, sofort zahlbar, verlange: das geschieht um Lebens oder Sterbens willen, ich will hinter niemandem herlaufen, wenn ich meine Mauer wiederherstellen muß.«
»Diese Bedingungen halte ich für im ganzen angemessen«, sagte Birotteau.
»Ferner«, fuhr Molineux fort, »zahlen Sie mir siebenhundertfünfzig Franken, hic et nunc, die erst auf die letzten sechs Monate Ihrer Mietzeit verrechnet werden, worüber im Vertrage quittiert wird. Im übrigen nehme ich auch Wechsel, mit dem Vermerk ›Valuta in Miete‹ zu meiner Sicherheit, die Sie auf beliebige Daten ausstellen können. In Geschäften bin ich kurz und bündig. Wir wollen noch festlegen, daß die Tür nach meiner Treppe geschlossen wird, die Sie zu benutzen keinerlei Recht haben … und zwar auf Ihre Kosten … und zugemauert wird. Aber seien Sie unbesorgt, für die Wiederherstellung nach Ablauf des Mietvertrages beanspruche ich keine Entschädigung; sie gilt als in den fünfhundert Franken mit einbegriffen. Sie werden sich überzeugen, daß ich immer gerecht bin.«
»Wir Kaufleute sind nicht so peinlich,« sagte der Parfümhändler, »bei einer solchen Beobachtung von Formalitäten käme kein Geschäft zustande.«
»Oh, im Handel ist das etwas ganz anderes, und besonders im Parfümeriehandel, wo alles wie am Schnürchen geht«, sagte der kleine Alte mit saurem Lächeln. »Aber in Mietsachen, Herr Birotteau, ist in Paris nichts unerheblich. Sehen Sie, da hatte ich in der Rue Montorgueil einen Mieter …«
»Lieber Herr,« sagte Birotteau, »ich bin untröstlich, daß ich Sie bei Ihrem Frühstück aufhalte: hier ist der Vertrag, ändern Sie ihn, ich bewillige alles, was Sie verlangen; morgen wollen wir ihn unterzeichnen, es genügt, wenn wir uns heute unser Wort geben, denn morgen muß mein Architekt mit der Arbeit beginnen.«
»Herr Birotteau,« fing Molineux mit einem Blick auf den Schirmhändler wieder an, »der Termin ist verstrichen und Herr Cayron will die Miete nicht bezahlen, wir wollen den Betrag zu seinen Wechseln hinzuschlagen, dann läuft Ihr Vertrag von Januar bis Januar. Das paßt dann besser.«
»Schön«, sagte Birotteau.
»Dann wäre noch der Sou pro Franken für den Portier …«
»Aber,« sagte Birotteau, »Sie schließen mich ja von der Treppe und dem Entree aus, da wäre es doch unbillig …«
»Oh, Sie sind eben Mieter,« sagte kategorisch der kleine Molineux, der sein Steckenpferd ritt, »Sie müssen auch Ihren Anteil an der Tür- und Fenstersteuer und an den Abgaben tragen. Wenn wir über alles dies einig sind, verehrter Herr, dann gibt es kein Bedenken mehr. Sie wollen sich erheblich vergrößern, die Geschäfte gehen wohl gut?«
»Jawohl«, sagte Birotteau. »Aber hierfür liegt ein anderer Grund vor. Ich habe einige Freunde eingeladen, einerseits zur Feier der Befreiung des Landes, dann um meine Aufnahme unter die Ritter der Ehrenlegion festlich zu begehen …«
»Ah, ah,« sagte Molineux, »eine wohlverdiente Belohnung.«
»Ja,« sagte Birotteau, »ich habe mich vielleicht dieser Auszeichnung und allerhöchsten Gnade würdig erwiesen, als Mitglied des Handelsgerichts und als Kämpfer für die Sache der Bourbonen auf den Stufen von Saint-Roch am 13. Vendémiaire, wo ich von Napoleon verwundet wurde; diese Ansprüche …«
»Gelten ebensoviel wie die unsrer tapfern Soldaten der alten Armee. Das Ordensband ist rot, weil es in das vergossene Blut getaucht ist.«
Auf diese dem Constitutionnel entnommenen Worte konnte Birotteau nicht umhin, den kleinen Molineux einzuladen, der sich in Dankesbezeugungen ergoß und sich bereit fühlte, ihm seine Geringschätzung zu vergeben. Er begleitete seinen neuen Mieter bis zur Treppe und überhäufte ihn mit höflichen Redensarten. Als sich Birotteau mit Cayron in der Mitte des Holländischen Hofes befand, warf er seinem Nachbarn einen spöttischen Blick zu.
»Ich habe nicht gedacht, daß es so beschränkte Menschen gibt!« sagte er, indem er die Bezeichnung »dumme« unterdrückte.
»Ach, verehrter Herr,« sagte Cayron, »es können eben nicht alle so begabt sein wie Sie.« – In Gegenwart des Herrn Molineux durfte sich Birotteau für einen überlegenen Menschen halten; die Antwort des Schirmhändlers entlockte ihm ein freudiges Lächeln und er verabschiedete sich von ihm mit einer königlichen Geste.
»Hier bin ich ja bei den Markthallen,« sagte Birotteau zu sich, »da kann ich gleich das Geschäft mit den Nüssen abmachen.«
Nachdem er eine Stunde herumgesucht hatte und von den Marktfrauen nach der Rue des Lombards gewiesen war, wo die für Zuckerwerk gebrauchten Nüsse verkauft wurden, erfuhr Birotteau endlich von seinen Freunden, den Matifats, daß die »trockene Frucht« en gros nur bei einer gewissen Frau Angelika Madou in der Rue Perrin-Gasselin vorrätig war, dem einzigen Geschäft, in dem man die echte provenzalische und die echte weiße Alpen-Haselnuß finden konnte.