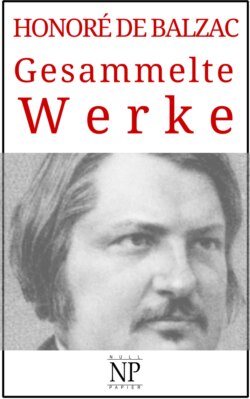Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 19
9
ОглавлениеDie Rue Perrin-Gasselin ist eine der Gassen in dem Labyrinth, das an den vier Seiten von dem Kai, der Rue Saint-Denis, der Rue de la Ferronnerie und der Rue de la Monnaie umschlossen wird, und gewissermaßen das Eingeweide der Stadt darstellt. Hier wimmelt ein unendliches Gemisch der heterogensten Waren durcheinander, übelriechende und reizvolle, Heringe und Musseline, Seide und Honig, Butter und Tüll, vor allem eine Menge kleiner Geschäfte, von denen man in Paris so wenig eine Ahnung hat wie die meisten Menschen von dem, was in ihrer Bauchspeicheldrüse vorgeht, und deren Blutsauger damals ein gewisser Bidault, genannt Gigonnet, ein Bankier, war, der in der Rue Grenétat wohnte. Hier sind ehemalige Pferdeställe mit Öltonnen angefüllt, Remisen enthalten Myriaden von baumwollenen Strümpfen. Hier befindet sich auch der Großhandel mit Eßwaren, die dann im Detail in den Markthallen verkauft werden. Frau Madou war früher eine Seefischhändlerin gewesen, hatte sich dann vor zehn Jahren auf »getrocknete Früchte« geworfen, infolge eines Verhältnisses mit dem früheren Besitzer ihres Geschäfts, und war lange Zeit die Zielscheibe des Klatsches in den Markthallen; sie besaß eine männliche, herausfordernde Schönheit, die jetzt aber in übermäßigem Fett versunken war. Sie bewohnte das Erdgeschoß eines gelben, verfallenen Hauses, dessen sämtliche Stockwerke nur noch durch Eisenkreuze zusammengehalten wurden. Ihrem Verflossenen war es gelungen, sich die Konkurrenz von Halse zu halten und sich für seinen Handel ein Monopol zu schaffen; trotz ihrer etwas mangelhaften Erziehung vermochte seine Erbin doch, ihm an Geschäftsgewandtheit gleich zu kommen; sie ging in seinen Lagerräumen, die aus Remisen, Ställen und früheren Ateliers bestanden, aus und ein und führte einen erfolgreichen Kampf mit den Insekten. Sie hatte weder Kontor noch Kasse, noch Geschäftsbücher, denn sie konnte nicht lesen und schreiben; einen Brief beantwortete sie mit Faustschlägen, weil sie ihn für eine Beleidigung hielt. Im übrigen war sie eine gute Seele, von roter Gesichtsfarbe, mit einem Schal über der Haube; mit ihrer Trompetenstimme hatte sie sich die Achtung bei den Fuhrleuten verschafft, die ihr ihre Waren brachten und mit denen sie Zwistigkeiten mit einer Flasche weißen Krätzers erledigte. Mit den Landwirten, die ihr ihre Früchte sandten, konnte es keine Differenzen geben; die Lieferung erfolgte gegen Barzahlung und die alte Madou suchte sie im Sommer persönlich auf. Birotteau traf diese wilde Händlerin inmitten von Säcken voll Haselnüssen, Kastanien und Wallnüssen an.
»Guten Tag, liebe Frau«, sagte Birotteau etwas ungeniert.
»Deine liebe?« sagte sie. »He, mein Junge, haben wir uns schon mal nähergestanden? Haben wir vielleicht zusammen die Schweine gehütet?«
»Ich bin Parfümhändler und außerdem städtischer Beigeordneter des zweiten Pariser Bezirks; als Beamter und als Kunde darf ich wohl verlangen, daß Sie in einem andern Ton mit mir reden.«
»Ich heirate, wann es mir paßt«, erwiderte das Mannweib. »Ich habe mit dem Rathaus nischt zu schaffen und von den Beigeordneten nischt zu bitten. Meine Kundschaft hab ich gerne, aber ich rede mit ihr auf meine Art. Und wenn sie nich zufrieden ist, dann kann sie sich anderswo beschwindeln lassen.«
»Das kommt bei einem Monopol heraus!« sagte Birotteau leise.
»Popole? Der is mein Patchen, der wird was ausgefressen haben; kommen Sie etwa seinetwegen, geehrter Herr Beamter?« sagte sie, indem sich ihre Stimme mäßigte.
»Nein; ich hatte schon die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß ich als Kunde komme.«
»Schön! Und wie heißt du, mein Junge? Du bist noch nie bei mir gewesen.«
»Bei solchem Benehmen müßten Sie eigentlich Ihre Nüsse billig abgeben«, sagte Birotteau und nannte ihr seinen Namen und seine Adresse.
»Ach, Sie sind der berühmte Birotteau mit der schönen Frau. Und wieviel wollen Sie denn von diesen zuckersüßen Nüssen haben, mein Geliebtester?«
»Sechstausend Pfund.«
»Das ist alles, was ich habe«, sagte die Händlerin mit einer Stimme wie eine heisere Flöte. »Sie müssen mächtig hinterher sein, die Mädels zu verheiraten und zu parfümieren. Gott segne Sie, Sie müssen viel zu tun haben. Entschuldigen Sie schon. Sie werden ein anständiger Kunde und eingeschrieben werden ins Herz von der Frau, die ich am liebsten in der Welt habe …«
»Welcher denn? …«
»Nu, der lieben Frau Madou.«
»Und was sollen die Nüsse kosten?«
»Für Sie, mein Lieber, fünfundzwanzig Franken den Zentner.«
»Fünfundzwanzig Franken?« sagte Birotteau, »das macht ja fünfzehnhundert Franken! Und ich werde vielleicht Tausende von Zentnern jährlich brauchen.«
»Aber sehen Sie sich doch bloß die schönen Früchte an, die sind barfuß gepflückt!« sagte sie und versenkte ihren roten Arm in einen Sack Haselnüsse. »Und keine tauben drunter, lieber Herr. Bedenken Sie doch, daß die Händler ihre Bettelware für vierundzwanzig Sous das Pfund verkaufen, und dabei tun sie auf vier Pfund mehr als ein Pfund taube drunter. Soll ich vielleicht Ihnen zuliebe bei meiner Ware zusetzen? Sie sind ja sehr nett, aber so schön gefallen Sie mir doch noch nich! Wenn Sie aber so viel brauchen, will ich auf zwanzig Franken runtergehn, denn einen Beigeordneten kann ich doch nich wieder wegschicken, das könnte ja den jungen Paaren Unglück bringen! Fühlen Sie bloß mal, wie schön die Ware is und wie schwer! Noch nicht fünfzig gehn aufs Pfund! Und alles voll. Kein Wurm drin!«
»Also dann schicken Sie mir sechstausend für zweitausend Franken, zahlbar in drei Monaten, Rue Faubourg-du-Temple, nach meiner Fabrik, und zwar morgens ganz früh.«
»Man wird sich beeilen, wie ein frisch verheiratetes Weibchen. Also adieu, Herr Bürgermeister, und sein Sie mir nich böse. Aber wenn es Ihnen nischt ausmacht,« sagte sie, als sie Birotteau in den Hof begleitete, »wärs mir lieber, wenn Sie in sechs Wochen zahlen wollten; ich hab Ihnen so’nen billigen Preis gemacht, ich kann doch nich noch die Zinsen einbüßen! Und der alte Gigonnet, mit seinem liebevollen Herzen, der zieht uns die Seele aus’m Leibe, wie ne Spinne ne Fliege aussaugt.«
»Also schön, in anderthalb Monaten. Aber wir wiegen genau nach, hohle kann ich nicht gebrauchen. Sonst wird nichts aus dem Geschäft.«
»Ach, der Hund, der versteht sich drauf«, sagte Frau Madou. »Dem kann man nischt vormachen. Das hat ihm sicher diese Bande aus der Rue des Lombards verraten! Diese Großkohze, die verständigen sich immer unter einander, damit sie so’n armes Lamm verschlingen können.«
Das arme Lamm war fünf Fuß lang und drei Fuß breit und sah aus wie ein in gestreifte Baumwolle gekleideter Grenzstein, ohne jeden Tailleneinschnitt.
Inzwischen ging der Parfümhändler in Gedanken versunken die Rue Saint-Honoré entlang, machte Pläne für den Kampf gegen das Makassaröl, dachte über die Etiketten und die Form der Flaschen nach und überlegte, wie die Pfropfen befestigt werden und welche Farbe die Anzeigen haben sollten. Und da sagt man noch, daß dem Handel die Poesie mangele! Newton hat sich über seinen berühmten binomischen Lehrsatz den Kopf nicht mehr zerbrochen als Birotteau über seine Comagen-Essenz, denn das Öl war inzwischen zur Essenz geworden, er kam von einer Benennung auf die andere, ohne ihre eigentliche Bedeutung zu kennen. Alle möglichen Kombinationen drängten sich in seinem Kopfe, und dieses Arbeiten ins Leere hielt er für eine vollwichtige Betätigung seiner Begabung. Er war so tief in Gedanken, daß er an der Rue des Bourdonnais vorbeiging und wieder umkehren mußte, als er sich an seinen Onkel erinnerte.
Claude-Joseph Pillerault, ein ehemaliger Eisenwarenhändler mit der Firma »Zur goldenen Glocke«, besaß eine jener Physiognomien, die in Ihrer Eigenartigkeit schön sind; alles war bei ihm im Einklang, Äußeres und Inneres, Verstand und Herz, Sprache und Gedanke, Reden und Handeln. Als einziger Verwandter der Frau Birotteau konzentrierte sich seine ganze Liebe auf sie und Cäsarine, nachdem er im Verlaufe seiner Geschäftstätigkeit seine Frau und seinen Sohn und dann noch ein Adoptivkind, den Sohn seiner Köchin, verloren hatte. Diese bitteren Verluste hatten den braven Mann zu einem christlichen Stoizismus geführt, einer edlen Denkungsart, die sein Leben verschönerte und seine letzten Jahre mit einem zugleich warmen und kalten Schimmer übergoß, wie ein winterlicher Sonnenuntergang. Sein hageres, hohles Antlitz von ernstem Ausdruck, auf dem rote und dunkle Töne harmonisch vereinigt waren, hatte eine frappante Ähnlichkeit mit dem des Gottes der Zeit, wie ihn die Maler darstellen, aber ins Gewöhnliche übertragen; denn die täglichen Gewohnheiten des Kaufmanns hatten bei ihm dessen monumentalen, abweisenden Charakter, den die Maler, die Bildhauer und die Bronzegießer bei der Anfertigung der Uhren zu übertreiben pflegen, gemildert. Von mittlerer Größe, war Pillerault eher untersetzt als dick, von Natur für die Arbeit und langes Leben bestimmt; seine Schulterbreite verriet einen kräftigen Knochenbau, sein Temperament war kühl, Erregungen sah man ihm nicht an; aber deshalb war er doch nicht unempfindlich. Wie sein bedächtiges Wesen und sein ruhiges Gesicht zeigten, gab er seinem Gefühl nicht nach außen hin Ausdruck; er war unerschütterlich und frei von jeder Phrase und Emphase. Seine grünen, schwarz punktierten Augen fielen durch ihre unveränderliche Leuchtkraft auf. Seine von geradlinigen Runzeln durchfurchte und vom Alter gelb gewordene Stirn war klein, schmal und hart, und sein kurzes, pelzartiges Haar silbergrau. Der feingeschnittene Mund verriet kluge Vorsicht, aber keine Habsucht. Sein lebhafter Blick zeugte von regelmäßiger Lebensweise. Ehrenhaftigkeit, Pflichtgefühl und echte Bescheidenheit ließen sein Gesicht im Glanze der Gesundheit leuchten. Sechzig Jahre lang hatte er das harte, nüchterne Leben eines unermüdlichen Arbeiters geführt. Es glich dem Cäsars, abgesehen von dessen Geschäftsglück. Bis zu seinem dreißigsten Jahre Angestellter, hatte er sein ganzes Vermögen noch in seinem Geschäfte stecken, als Cäsar schon seine Ersparnisse in Renten anlegen konnte; und schließlich hatte ihn das Härteste betroffen, daß seine Hacken und Eisenwaren requiriert wurden. Sein verständiger und zurückhaltender Charakter, seine Vorsicht und seine rechnende Überlegung bestimmten sein geschäftliches Gebaren. Seine meisten Geschäfte wurden mündlich abgeschlossen und er hatte dabei selten Differenzen gehabt. Wie alle nachdenklichen Leute war er ein scharfer Beobachter und studierte die Menschen, indem er sie reden ließ; dann lehnte er es meist ab, sich, wie seine Nachbarn, an scheinbar vorteilhaften Geschäften zu beteiligen; wenn es denen nachher leid tat, sagten sie, daß Pillerault eine feine Witterung für Betrüger habe. Er hielt sich lieber an den kleinen, aber sicheren Gewinn, als daß er große Beträge bei waghalsigen Geschäften aufs Spiel gesetzt hätte. Er handelte mit Kaminplatten, Rosten, schweren Feuerböcken, kupfernen und eisernen Kesseln, Hacken und landwirtschaftlichen Geräten. Diese wenig einträgliche Ware erforderte eine sehr anstrengende mechanische Arbeit. Der Gewinn stand in keinem Verhältnis zu der Anstrengung, es war nur wenig Nutzen bei diesem schweren Material, mit dem man so mühsam hantieren mußte, und das sich so schwer unterbringen ließ. Wieviel Kisten hatte er zunageln, wieviel ein- und auspacken, wieviel Wagensendungen abnehmen müssen!
Kein Vermögen war so anständig, so rechtmäßig, so ehrenhaft erworben worden wie das seinige. Niemals hatte er zu hohe Preise gefordert, niemals sich zu Geschäften gedrängt. Zuletzt sah man ihn vor seiner Ladentür, wie er seine Pfeife rauchte, die Vorübergehenden beobachtete und der Arbeit seiner Kommis zusah. Als er sich im Jahre 1814 zurückzog, bestand sein Vermögen erstens aus sechsundsechzigtausend Franken, die ins Staatsschuldbuch eingetragen waren und ihm fünftausend und einige hundert Franken Rente brachten; dann aus vierzigtausend Franken, die, ohne Zinsen zu bringen, in fünf Jahren zahlbar waren, dem Preise für sein Geschäft, das er an einen seiner Kommis verkauft hatte. Dreißig Jahre hindurch hatte er bei einem Jahresumsatze von hunderttausend Franken sieben Prozent daran verdient und die Hälfte des Gewinns für seinen Lebensunterhalt verbraucht. So war sein Vermögensstand. Seine Nachbarn, die ihn um dieses mäßige Vermögen nicht sehr beneideten, rühmten seine Einsicht, ohne Verständnis dafür zu haben. An der Ecke der Rue de la Monnaie und der Rue Saint-Honoré befindet sich das Café David, wo mehrere alte Kaufleute ebenso wie Pillerault abends ihren Kaffee tranken. Hier war bisweilen die Adoption des Sohnes seiner Köchin der Gegenstand mancher Neckereien gewesen, aber nur solcher, wie man sie sich gegen eine geachtete Persönlichkeit erlaubt, denn der Eisenwarenhändler genoß eine respektvolle Achtung, ohne eine solche jemals erstrebt zu haben, da ihm seine Selbstachtung genügte. Als Pillerault daher jenen jungen Menschen verlor, gaben ihm mehr als zweihundert Personen das Geleite bis auf den Kirchhof. In dieser Zeit zeigte er sich heroisch. Sein beherrschter Schmerz, wie er für alle starken Männer, die ihn nicht zur Schau tragen, charakteristisch ist, vermehrte noch die Sympathie des Viertels für diesen ›braven Mann‹, wie Pillerault mit besonderer Betonung dieses Wortes, die seine Bedeutung unterstrich und erhöhte, genannt wurde. Claude Pilleraults zur Lebensgewohnheit gewordene Mäßigkeit hielt ihn von den üblichen Vergnügungen eines untätigen Lebens fern, als er nach dem Aufgeben seines Geschäfts in den Ruhestand getreten war, der so viele Pariser Bourgeois erschlaffen läßt; er setzte seine gewohnte Lebensweise fort und hielt auch im Alter an seinen politischen Überzeugungen fest, die, wie wir sagen müssen, diejenigen der äußersten Linken waren. Pillerault gehörte jener Arbeiterpartei an, die sich infolge der Revolution an die Bourgeoisie angeschlossen hat. Sein einziger Charakterfehler war die Wichtigkeit, die er dieser Errungenschaft beilegte; er hielt an seinen Rechten fest, an der Freiheit, an den Früchten der Revolution; er hielt seinen Wohlstand und seine bürgerliche Sicherheit für bedroht von den Jesuiten, deren geheime Macht die Liberalen verkündeten, die sich durch die Anschauungen, die der »Constitutionnel« dem Bruder des Königs zuschrieb, für gefährdet hielten. Wie in seiner Lebensweise so war er auch in seinen Ansichten konsequent; aber seine politische Anschauung war nicht engherzig, er beschimpfte seine Gegner nicht, er fürchtete eine Höflingswirtschaft und glaubte an republikanische Tugend; er hielt Manuel für frei von jeder Übertreibung, den General Foy für einen großen Mann, Casimir Périer für nicht ehrgeizig, Lafayette für einen politischen Propheten und Courier für einen guten Kerl. So umgab er sich mit idealen Trugbildern. Dieser schöne alte Mann genoß das Familienleben, indem er bei den Ragons, seiner Nichte, dem Richter Popinot, Joseph Lebas und den Matifats verkehrte. Seine sämtlichen Bedürfnisse bestritt er mit fünfzehnhundert Franken. Sein übriges Einkommen verwendete er auf Wohltätigkeit und auf Geschenke für seine Großnichte; viermal im Jahre lud er seine Freunde zum Diner bei Roland, in der Rue du Hasard, und ins Theater ein. Er führte das Leben der alten Junggesellen, auf die die jungen Frauen Sichtwechsel ziehen, um ihre Wünsche zu erfüllen: eine Landpartie, einen Besuch der Oper, einen Ausflug in die Berge von Beaujon. Pillerault war glücklich, wenn er ein Vergnügen bereiten und die Befriedigung der andern genießen konnte. Als er sein Geschäft verkauft hatte, wollte er das Viertel, an das er gewöhnt war, nicht verlassen und hatte sich in der Rue des Bourdonnais eine kleine Wohnung von drei Zimmern im vierten Stock eines alten Hauses gemietet.
Genau so wie sich das Wesen Molineux’ in seinem eigenartigen Mobiliar widerspiegelte, so war Pilleraults reine und einfache Lebensweise an der inneren Einrichtung seiner Behausung zu erkennen, die aus einem Vorzimmer, einem Salon und einem Schlafzimmer bestand. Bis auf die Größenverhältnisse hätte man sie die Zelle eines Karthäusermönchs nennen können. Das Vorzimmer mit rotem gebohntem Fußboden hatte nur ein Fenster mit Vorhängen aus Perkal mit rotem Besatz und Mahagonistühle, die mit rotem Leder bezogen und mit vergoldeten Nägeln beschlagen waren; auf der olivengrünen Tapete hingen »Der Eid der Amerikaner«, das Porträt Bonapartes als Erster Konsul und die »Schlacht bei Austerlitz«. Der sicher vom Tapezierer arrangierte Salon hatte gelbe Möbel mit Rosetten, einen Teppich, eine unvergoldete bronzene Kamingarnitur, einen gemalten Kaminschirm, eine Konsole mit einer glasüberdeckten Blumenvase und einen runden Tisch mit einer Decke, auf dem ein Likörkasten stand. Die Neuheit dieses Zimmers zeigte zur Genüge, daß der alte Eisenwarenhändler, der selten Besuch hatte, den gesellschaftlichen Gebräuchen ein Opfer gebracht hatte. In seinem Schlafzimmer, das so einfach ausgestattet war wie das eines Geistlichen oder eines alten Soldaten, die das Leben am richtigsten zu schätzen wissen, überraschte ein Kruzifix mit einem Weihwasserbecken, das in seinem Alkoven aufgestellt war. Dieses Bekenntnis zu seinem Glauben war wahrhaft rührend bei einem republikanischen Stoiker. Eine alte Frau besorgte ihm die Wirtschaft, aber seine Achtung vor weiblichen Wesen war so groß, daß er sich nicht die Schuhe von ihr putzen ließ, die im Abonnement von einem Putzer gereinigt wurden. Seine Kleidung war einfach und immer die gleiche. Er trug ständig einen Überrock und ein Beinkleid von blauem Tuch, eine bunte baumwollene Weste, eine weiße Krawatte und sehr hoch hinaufgehende Schuhe; an Feiertagen legte er einen Frack mit Metallknöpfen an. Sein Aufstehen, sein Frühstück, seine Ausgänge, sein Mittagessen, seine Abendbesuche und sein Nachhausekommen waren auf das genaueste geregelt, denn nur die Regelmäßigkeit der Lebensgewohnheiten verbürgt Gesundheit und langes Leben. Zwischen Cäsar, den Ragons, dem Abbé Loraux und ihm wurde nie über Politik gesprochen, denn die Mitglieder dieser Gesellschaft kannten einander zu genau, als daß sie unter sich Proselyten zu machen versucht hätten. Wie sein Neffe und die Ragons hatte er großes Vertrauen zu Roguin. Ein Pariser Notar war für ihn immer ein verehrungswürdiges Wesen, die lebendige Personifikation der Ehrenhaftigkeit. Bezüglich des Terraingeschäftes hatte Pillerault eine Nachprüfung angestellt, die die Sicherheit, mit der Cäsar die Bedenken seiner Frau bekämpft hatte, rechtfertigte.
Der Parfümhändler stieg die achtundsiebzig Stufen, die zu der kleinen braunen Tür der Wohnung seines Onkels führten, hinauf und dachte sich, daß der alte Herr noch recht rüstig sein müsse, wenn er das täglich machte, ohne darüber zu klagen. Er sah seinen Rock und sein Beinkleid draußen auf dem Kleiderriegel hängen; Frau Vaillant bürstete und reinigte sie, während der alte Philosoph in seinem Morgenrock aus grauem Flanell am Kaminfeuer frühstückte und im »Constitutionnel« oder im »Journal du Commerce« die Parlamentsverhandlungen las.
»Lieber Onkel,« sagte Cäsar, »das Geschäft ist abgeschlossen, die Verträge werden schon aufgesetzt. Trotzdem können Sie, wenn Sie irgendwelche Besorgnisse oder Bedenken haben, immer noch zurücktreten.«
»Warum sollte ich zurücktreten? Das Geschäft ist gut, wenn die Realisation auch lange dauern wird, wie das übrigens bei allen sicheren Geschäften der Fall ist. Meine fünfzigtausend Franken liegen auf der Bank bereit, ich habe gestern das Restkaufgeld für mein Geschäft in Höhe von fünftausend Franken erhalten. Die Ragons legen ihr ganzes Vermögen hierbei an.«
»Schön. Aber wovon leben sie?«
»Sie werden zu leben haben, beruhige dich.«
»Ich verstehe Sie, lieber Onkel«, sagte Birotteau tief bewegt und drückte dem ernsten Alten die Hand.
»Und wie wird die Sache verteilt?« fragte Pillerault ablenkend.
»Ich nehme drei Achtel, Sie und Ragon jeder ein Achtel; ich kann Ihnen den Betrag vorschießen, bis der notarielle Vertrag abgeschlossen ist.«
»Schön, mein Junge! Bist du übrigens so reich, daß du da dreihunderttausend Franken hineinstecken kannst? Ich glaube, daß du dich hierbei stark außerhalb deines Geschäftes engagierst; wird das nicht darunter leiden? Aber das ist schließlich deine Sache. Solltest du in Verlegenheit kommen – die Renten stehen jetzt auf achtzig, ich könnte zweitausend Franken von meinen Konsols verkaufen. Aber denke daran, mein Junge: wenn du dich an mich wendest, so greifst du das Vermögen deiner Tochter an.«
»Wie Sie von so edlen Dingen reden, lieber Onkel, als ob es die einfachsten Sachen wären! Sie greifen mir ans Herz.«
»Der General Foy hat mir eben noch ganz anders das Herz bewegt! Also geh und schließe ab; die Terrains können uns nicht wegfliegen und werden uns zur Hälfte gehören; und wenn man auch sechs Jahre abwarten muß, wir werden immer einigen Ertrag haben, es sind da Lagerplätze, die man vermieten kann; es ist also kein Verlust zu befürchten, es sei denn, was ja aber eine Unmöglichkeit ist, daß Roguin mit unserm Gelde davongeht …«
»Trotzdem hat meine Frau heute Nacht zu mir gesagt, daß sie das befürchte.«
»Roguin sollte mit unserm Gelde davongehen?« sagte Pillerault lachend, »und warum das?«
»Weil er den üblen Nasengeruch hat, sagt sie, und wie alle Männer, von denen die Frauen nichts wissen wollen, wild ist hinter …«
Pillerault hatte nur ein ungläubiges Lächeln, riß von einem Block einen kleinen Bogen ab, schrieb die Summe auf und unterzeichnete.
»Hier ist ein Scheck auf die Bank über hunderttausend Franken für Ragon und mich. Die armen Leute haben diesem üblen Kerl, deinem du Tillet, ihre fünfzehn Worschiner Minenaktien verkauft, um den Betrag voll zu machen. Es preßt einem das Herz zusammen, wenn man brave Menschen in Not sieht. Und das sind so würdige, vornehme Menschen, die Blüte der alten Bourgeoisie! Ihr Bruder, der Richter Popinot, ahnt nichts davon. Sie halten das vor ihm geheim, um ihn nicht an seiner sonstigen Wohltätigkeit zu hindern. Und das sind Leute, die, wie ich, dreißig Jahre lang gearbeitet haben.«
»Gebe Gott, daß das Comagenöl einschlägt,« rief Birotteau aus, »ich würde in doppelter Beziehung glücklich darüber sein. Adieu, lieber Onkel, ich erwarte Sie am Sonntag zum Diner mit den Ragons, Roguin und Herrn Claparon, übermorgen wollen wir unterzeichnen, morgen ist ja Freitag und da mache ich keine Ge …«
»Bist du wirklich so abergläubisch?«
»Lieber Onkel, ich werde mich niemals überzeugen lassen, daß der Tag, an dem Gottes Sohn von den Menschen hingerichtet wurde, ein glücklicher Tag sein könne. Wir können die Sache ganz gut auf den 21. Januar verschieben.«
»Also auf Sonntag«, sagte Pillerault abbrechend.
»Abgesehen von seinen politischen Anschauungen,« sagte Birotteau zu sich, während er die Treppe hinabging, »gibt es, glaube ich, nicht seinesgleichen auf Erden. Was geht ihn eigentlich die Politik an? Er befände sich doch so wohl, wenn er gar nicht an so was dächte. Seine Verranntheit beweist, daß es eben doch keinen ganz vollkommenen Menschen gibt.«
»Schon drei Uhr«, sagte Cäsar, als er nach Hause kam.
»Sollen wir denn diese Wechsel nehmen, Herr Birotteau?« fragte Cölestin, und zeigte auf das Paket des Schirmhändlers.
»Ja, zu sechs Prozent, ohne Kommissionsgebühren. Liebe Frau, lege meine Sachen zurecht, ich will zu Herrn Vauquelin, du weißt weshalb. Vor allem eine weiße Krawatte.«
Birotteau gab seinen Kommis einige Befehle; da er Popinot nicht sah, nahm er an, daß sein künftiger Sozius sich ankleide, und ging selber schnell in sein Schlafzimmer, wo er den Stich der Dresdener heiligen Jungfrau vorfand, der, seiner Anordnung entsprechend, prachtvoll gerahmt war.
»Ei, das ist nett«, sagte er zu seiner Tochter.
»Aber Papa, sag’ doch lieber, daß es schön ist, sonst mokiert man sich ja über dich.«
»Nun seh einer dieses Mädel an, das seinen Papa ausschilt … Na, nach meinem Geschmack ist Hero und Leander ebenso schön. Die heilige Jungfrau, das ist ein religiöses Sujet, das gehört in eine Kapelle; aber Hero und Leander, die werde ich mir kaufen, bei den Flaschen für das Öl bin ich da auf Ideen gekommen …«
»Aber Papa, ich verstehe kein Wort.«
»Virginie, einen Wagen«, rief Cäsar mit schallender Stimme, während er sich rasierte und der ängstliche Popinot, Cäsarines wegen den Fuß noch mehr schleppend, erschien.
Der Liebende hatte noch gar nicht bemerkt, daß sein körperliches Gebrechen für seine Geliebte gar nicht vorhanden war. Ein herrlicher Liebesbeweis, den allein diejenigen, die unglücklicherweise mit einem Körperfehler behaftet sind, zu würdigen wissen.
»Herr Birotteau,« sagte er, »die Presse kann morgen in Tätigkeit gesetzt werden.«
»Was ist dir denn, Popinot«, fragte Cäsar, der Anselm erröten sah.
»Ach, lieber Herr, ich bin so glücklich, ich habe einen Laden mit einem Hinterzimmer, einer Küche nebst einigen Zimmern darüber und Magazinräumen zum Preise von zwölfhundert Franken in der Rue des Cinq-Diamants gefunden.«
»Du mußt sehen, daß du einen Mietvertrag auf achtzehn Jahre durchsetzt«, sagte Birotteau. »Aber jetzt müssen wir zu Herrn Vauquelin fahren, wir werden unterwegs darüber reden.«