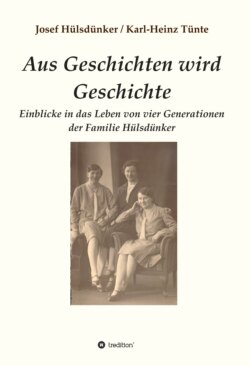Читать книгу Aus Geschichten wird Geschichte - Josef Hülsdünker - Страница 19
Оглавление„Der Schwatte“
Von Josef Hülsdünker
Um das Pferd, das „Schwatten“ genannt wurde, ranken sich wunderbare Geschichten. Auch meine ist mit diesem Pferd verbunden. Vielleicht gäbe es mich ohne dieses Pferd gar nicht. Aber der Reihe nach.
Meine Kindheit in den 50iger Jahren verbrachte ich zu einem beträchtlichen Teil auf dem Hof Elwermann in Endeln. Dafür gab es aus meiner Erinnerung heraus mindestens drei Gründe:
Der wohl wichtigste war die kindliche Freude am abwechslungsreichen bäuerlichen Leben, welches insbesondere bei mir und auch meinem Bruder Heinz Neugierde, Tatendrang und manchmal auch Erfindungsgeist freisetzte - natürlich in kindlichen Maßstäben. Wir beide hatten unglaubliche Freiheiten und ein riesiges Experimentierfeld von der Werkstatt mit Hobelbank im „Spieker“ über Trecker fahren und spielen mit Hund und Kälbern. Beliebt war auch unser Verstecken spielen auf diversen Heuböden über den Ställen oder in der Scheune.
Besonders wichtig und interessant waren für uns die Pferde, die damals noch richtige Arbeitspferde waren. Obwohl mit Trecker und Dreschmaschine erste Anzeichen der Mechanisierung Einzug gehalten hatten, wurden die Pferde immer noch bei der Feldarbeit gebraucht. Gelegentlich dienten sie auch als Reitpferde. Onkel Heinz war nämlich aktiver Reiter, der früher auf Turnieren geritten war und in den späten 50iger Jahren noch an den örtlichen Fuchsschwanzjagden des Reitervereins in Lembeck teilnahm. Mit den Pferden verhielt es sich damals so, dass ich zunächst nur den „Schwatten“ kennenlernte, das einzige Pferd auf dem Hof. Später kam „Meta“ hinzu. „Meta“ und der „Schwatte“ waren nur wenige Jahre zusammen, bis „Meta“ soweit „angelernt“ war, dass der „Schwatte“ altersbedingt den Hof verlassen musste und „Meta“ als einziges Arbeits- und Reitpferd übrigblieb.
Albert Hülsdünker startet mit Meta auf dem Hof Elwermann und beim Umzug der Lembecker Schützen
Die Feldarbeit mit den Pferden oblag meistens Heinrich Kock, den wir Kinder immer „Onkel Heinrich“ nannten. Onkel Heinz, der Bruder meiner Mutter und Hoferbe, ackerte stets mit dem Trecker. Onkel Heinrich nahm mich häufig mit, wenn er mit dem vom Pferd gezogenen Kipp-Pflug, mit der Egge oder dem Rechen an den Feldrändern arbeitete, wohin der Trecker mit seinem Pflug nicht hinreichte. In den Sommermonaten zogen die Pferde häufig auch die zweiachsigen Leiterwagen, mit denen Heu oder Korn eingefahren wurden und wetterbedingt alles sehr schnell gehen musste. Im Herbst und im Winter zogen die Pferde dann die einachsige „Stiätt-Kohr“. Damit wurden Runkeln oder Steckrüben zuerst in die „Runkelkuhlen“ eingelagert und dann im Winter von dort aus als Tierfutter für Kühe, Rinder und Pferde auf die „Daele“ befördert. Nicht selten durfte ich dann die Zügel halten und manchmal ein Stück auf dem Rücken der Pferde reiten. Später durfte ich sogar selbständig mit dem Kipp-Pflug „bauen“, wie das Pflügen auf Plattdeutsch genannt wurde. Danach war ich dann sehr stolz.
So wurde in den 50er Jahren geackert: Mal mit Pferd, mal mit Trecker. Auf seinem ersten Trecker Heinz Elwermann
Onkel Heinrich war erst Anfang der 50iger Jahre aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Er hatte als Kriegsgefangener viele Jahre im sowjetischen Karaganda im Bergbau arbeiten müssen und war jetzt Landarbeiter auf Elwermanns Bauernhof. Onkel Heinrich lebte mit seiner Familie auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber. Er war ein ruhiger, Pfeife rauchender, freundlicher Erwachsener, mit dessen fast gleichaltrigen Kindern Heinz und ich häufig zusammenspielten. Aufregen konnte ich Onkel Heinrich nur durch zu viel kindliche Neugier: „Warum hat der Bulle viel kürzere Hörner als die Kühe?“
Zum zweiten gab es nach Ende des Krieges aufgrund der vielen Flüchtlinge aus Osteuropa ein überaus knappes Wohnungsangebot. Die damalige Bundesregierung reagierte darauf unter anderem mit Zwangszuweisungen in wenig genutzten Wohnraum. Da Onkel Heinz noch nicht verheiratet war und mit seinem Vater, seiner Stiefmutter und Tante Kathrin in einem riesengroßen Bauernhaus wohnte, drohte auch hier die Zwangseinweisung einer Flüchtlingsfamilie. Kurzerhand wurde ich deshalb bei Elwermann angemeldet und belegte ein Zimmer, welches nun nicht mehr für eine Zwangszuweisung zur Verfügung stand. Dies hatte zur Folge, dass ich in den frühen fünfziger Jahren quasi auf dem Bauernhof wohnte und dort ein zweites Zuhause wähnte. Und weil es rund um Elwermannshof eine ganze Reihe gleichaltriger Kinder gab, fehlte es mir an nichts. Mit anderen Worten: Ich war gerne auf dem Hof.
Zum dritten wurde ich später erneut mehrere Male bei meinem Onkel Heinz Elwermann untergebracht. Der Grund hierfür waren ernste Erkrankungen meiner Mutter. Infolge der Geburt meiner jüngeren Schwester im November 1956 war sie ernsthaft krank und lange bettlägerig geworden. Da war ich fünf und wurde zu ihrer Entlastung wieder bei Elwermann einquartiert. Später, kurz nach meiner Einschulung 1958, laborierte sie an Nierensteinen und ich fand zu ihrer Entlastung wieder bei Elwermann mein Zuhause. Während meines ersten Schuljahres in der Volksschule Lembeck - Endeln fuhr ich deshalb von Elwermann aus täglich mit dem wunderbaren Fahrrad meines Onkels zur Schule. Nur ganz wenige Mal gab es Ärger mit Onkel Heinz. Wenn ich des Öfteren nach dem Spielen am Teich (meist zusammen mit meinem Bruder Heinz) mit Wasser gefüllten Stiefeln in die Küche kam, war er immer verärgert, weil er um unsere Gesundheit fürchtete. Verärgert war er auch (und das ist auch jetzt noch sehr präsent bei mir), wenn ich nach der Schule direkt zu meiner kranken Mutter fuhr, um sie zu besuchen. Ich erinnere mich gut daran, dass ich ihr im Herbst 1958 oft eine „Blutbirne“ von den beiden Birnenbäumen vor unserem Haus als Geschenk mit ans Krankenbett brachte. Mein Onkel fand das nicht gut, weil meine Mutter Ruhe brauchte und ich zudem für einige Zeit vom Schulweg „abgekommen“ und deshalb zu spät zum Mittagessen war.
Die Pferde auf dem Bauernhof hatten es mir besonders angetan. Onkel Heinz, der in seiner Jugend ein aktiver Reiter auf Turnieren war, sah es deshalb gern, dass ich mich für Pferde und Reiterei interessierte. Anfangs durfte ich gelegentlich auf einem der Pferde reiten, wenn es raus zur Feldarbeit ging oder wir davon zurückkamen. Die Pferde gingen dann in ihrem Arbeitsgeschirr und mein Bruder oder ich durften dann schon mal aufsitzen. Dabei standen wir natürlich unter der wachsamen Aufsicht von Onkel Heinrich oder Onkel Heinz.
Mit einer Reiter-Standarte wurden Heinz und Anneliese Elwermann an ihrem Hochzeitstag von der Lembecker Kirche zum Hof Elwermann begleitet.
Erst im Alter von etwa zehn Jahren konnte ich das Pferd „Meta“ alleine satteln und damit ausreiten. Noch ein wenig später durfte ich mit „Meta“ zum Lembecker Schloss reiten, wo ich zusammen mit den fünf gräflichen Kindern und einigen anderen die Voltigier-Gruppe des Lembecker Reitervereins bildete. Das Voltigier-Pferd hatte ich mitgebracht, geübt wurde im Schlosspark. Aufführungen unserer Voltigier-Gruppe gab es einige Male im Rahmen der alljährlich stattfindenden Fuchsschwanz-Jagden des Lembecker Reitervereins, die immer eine Menge Zuschauer anlockten.
In dieser Voltigier-Gruppe fühlte ich mich allerdings gar nicht wohl. Die Gruppe bestand nämlich aus den fünf Kindern der Gräfin und einigen anderen, meist älteren Kindern. Deren Eltern hatten zuvor ihre Bauernhöfe für den Neubau der neuen Stadt Wulfen zu Geld gemacht und waren allesamt Millionäre geworden. Diese Kinder legten ein anderes Sozialverhalten und auch einen anderen Lebensstil an den Tag als ich. Damals habe ich nicht verstanden, dass mein Unwohlsein mit der sozialen Lage unserer Familie zu tun hatte: Mein Vater war bei diesen Fuchsschwanzjagden einer der Kellner, die am Bierstand von Konstantin Cosanne bedienten, während die Eltern der anderen Voltigier-Gruppenmitglieder zu den Ehrengästen dieser bäuerlichen Veranstaltung zählten.
Die beiden Pferde, die ich bei Onkel Heinz kennen- und reiten lernte, waren beide pechschwarz, aber ihre Geschichten unterschieden sich deutlich. „Meta“ wurde erst gegen Ende der fünfziger Jahre gekauft und kam so auf den Hof. Dieses junge Pferd sollte die Arbeit des sehr viel älteren Pferdes, des „Schwatten“, übernehmen. Der „Schwatte“ kam auf anderen Wegen auf den Hof Elwermann. Aus den Erzählungen meines Vaters weiß ich, dass der „Schwatte“ zusammen mit einem Schimmel gegen Ende des Krieges von flüchtenden deutschen Wehrmachtsangehörigen im Kuhstall unseres Hauses an der Rhader Straße 209 zurückgelassen worden waren. Mein Vater war damals, unmittelbar nach dem Krieg noch nicht verheiratet, aber wohl auf Brautschau. Angeblich hatte er einen Blick auf meine Mutter, Elisabeth Elwermann, geworfen. Mein Vater, der als Eisenbahner gegen Kriegsende wohl eher zufällig (aber rechtzeitig) auf Heimaturlaub war, konnte die Pferde nicht gebrauchen und wahrscheinlich nicht einmal ordentlich füttern. Was tun? Nun, er verteilte die beiden Pferde auf die benachbarten Bauernhöfe Elwermann und Pass. So kam, weil das Pferd kein Namensschild trug, der „Schwatte“ auf den Hof Elwermann und der „Witte“ auf den Hof Pass.
Bei Elwermann blieb es dann bei dem Namen „Schwatten“ für das Pferd. Dass ich Jahre später noch viel Spaß und Freude mit diesem Pferd haben sollte, war natürlich nicht absehbar.
v.l.: Willi, Hugo, Johann, Fritz und Albert Hülsdünker
Wenn man rückblickend auf die damaligen Ereignisse schaut, dann ist aus der Sicht unserer Familie das Ende des Krieges mit dem Weiterreichen von zwei Pferden nur unzureichend erfasst. Vieles hing damals am seidenen Faden, vieles hätte ganz anders kommen können. Dass es mich, der diese Geschichte schreibt, überhaupt gibt, ist rückblickend eine glückliche
Fügung. Nicht nur mein Vater, auch alle seine Brüder und Halbbrüder kamen mit dem Ende des Krieges zurück. Sie landeten nicht in lange anhaltender russischer Kriegsgefangenschaft (wie etwa Onkel Heinrich). Sie galten als nicht „belastet“, weil wohl keiner eine Uniform mit Kragenspiegel von SS oder SA getragen hatte und sie waren einigermaßen gesund und unversehrt geblieben. Das war angesichts des Elends und des Leids, welches dieser Krieg und auch die Nazi-Herrschaft über die Menschen gebracht hatten, keineswegs selbstverständlich. Während in manchen Familien der Verlust von einem oder mehreren Söhnen zu beklagen war, hatte die Familie Hülsdünker Glück, weil alle fünf Söhne meiner Oma aus dem Krieg zurückgekommen waren. Auch meine Oma Maria hatte viel Glück, als bei Kriegsende ein alliierter Soldat in ihrem Haus durch die geschlossene Wohnzimmertür feuerte und sie nur knapp verfehlte. Noch heute ist das reparierte Einschussloch in dieser Tür zu erkennen.
Die Familie meiner Mutter hatte dieses Glück nicht. Ihr Bruder Bernhard und ihre Schwester Hedwig verloren ihr Leben, der eine als Soldat in der Schlacht um Monte Cassino und Tante Hedwig auf freiem Feld bei einem Tieffliegerangriff. Bei diesem Tieffliegerangriff wurde auch meine Mutter sehr schwer verletzt. Sie überlebte dank des Einsatzes von Penicillin, das die amerikanischen Soldaten im Gepäck hatten. Ein Glück - auch für mich.