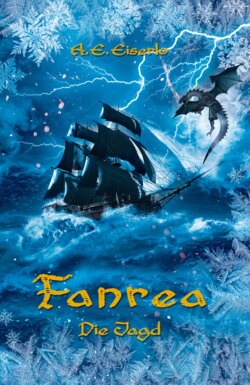Читать книгу Fanrea Band 3 - A. E. Eiserlo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schneesturm
ОглавлениеAnnie und John ritten durchs Gebirge, um ein entlaufenes Kalb zu suchen, das zur Herde ihres Vaters gehörte. Der stahlblaue Himmel bildete einen starken Kontrast zum frisch gefallenen Schnee. Das sonst so karge Land wirkte wie in flüssige Sahne getaucht. Fast klirrte die Luft vor Kälte, sodass beim Ausatmen kleine Wolken entstanden. Die Hufe der Pferde hinterließen eine deutlich sichtbare Spur in der weißen Pracht. Dies machte es leicht, den Abdrücken des Kalbes zu folgen. Den Blick auf den Boden gerichtet, führten die beiden jungen Menschen ein intensives Gespräch. Dabei achteten sie nicht weiter auf die Wolken, die den Himmel zwar langsam, aber stetig verdunkelten. Erst als ein kalter Wind einsetzte, nahmen sie die Wetterveränderung wahr.
»Ein Sturm kommt auf! Hoffentlich ist es kein Blizzard!«, stellte John besorgt fest. Er ärgerte sich, dass er so unaufmerksam gewesen war.
»Wir schaffen es nicht zurück, bis es losgeht! Hier in der Nähe ist eine alte Hütte, dort können wir Unterschlupf finden.«
»Und das Kalb? Dein Vater verlässt sich auf uns!«
Entrüstet sah das Mädchen ihn an. »Wir müssen uns in Sicherheit bringen! Hast du vergessen, wie schlimm die Eisstürme hier werden können?« Annie schnalzte mit der Zunge. Die Stute verfiel in Trab.
»Du hast recht, lass uns die Hütte aufsuchen!« John passte sein Tempo an.
Schneidender Wind peitschte die Haut der beiden Reiter. Erste kleine Flocken tanzten wirbelnd umeinander, verdichteten sich allmählich zu einem Schneegestöber. Die Freunde blieben eng beieinander, um sich nicht in der schemenhaften Umgebung zu verlieren.
»Hier, fang auf!«, rief der Lakota, während er Annie ein Lasso zuwarf. »Bind es fest, falls der Sturm schlimmer wird! Wir dürfen uns nicht trennen!«
Geschickt fing das Mädchen das Seil und befestigte es am Sattelknopf. »Weiter!«
Dicke Flocken vermischten sich mit harten Eiskristallen, die wie kleine Steine auf die Haut prasselten. Der Wind nahm an Kraft zu und blies ihnen mit Wucht entgegen, sodass Pferde und Reiter die Körper dagegenstemmen mussten. Der Weg verjüngte sich und führte leicht abwärts. Links von ihnen ragte der Berg hoch, rechts gähnte ein Abgrund.
John verlängerte das Lasso, damit die Pferde hintereinandergehen konnten. Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung wahr. Als die Sicht für einen Moment besser wurde, schaute er genauer hin. Schemenhaft erkannte der Lakota das gesuchte Kalb, das rechts unterhalb von ihm auf einen kleinen Felsvorsprung herabgestürzt war. Dieser hatte ihm das Leben gerettet und vor einem Sturz in die Tiefe bewahrt. Zitternd stand das Tier auf dem Plateau dicht am Abgrund, wo es erbärmlich blökte.
»Schau, Annie, das Kalb! Es scheint unverletzt. Ich klettere hinunter und hole es!«
»Nein! Wir reiten weiter, der Sturm wird immer schlimmer!«
Doch John hörte nicht auf sie und sprang vom Pferd. Er steckte seine Handschuhe in die Jackentasche, band ein Lasso um die Taille und befestigte es am Sattelknopf. Dann gab er die Zügel an Annie weiter. »Ich bin gleich zurück.« Bevor sie widersprechen konnte, ging er Richtung Abhang, stemmte sich den Böen entgegen und kletterte die terrassenförmig übereinanderlappenden Felsen ein Stück weit hinunter. Die Hände fast taub vor Kälte, rutschte John mehrmals auf dem mit Eis überfrorenen Stein aus. Es gelang ihm gerade noch, sich zu fangen. Schnee verdeckte einige Eisflächen, sodass er unvorbereitet auf die spiegelglatten Flächen trat. Als er an eine besonders steile Stelle kam, verlor der Lakota den Halt und schlitterte dem Kalb entgegen. Er rutschte an dem Tier vorbei und schoss über die Klippe. Im letzten Moment gelang es ihm, den Ast einer Kiefer zu packen. Sekundenlang baumelte der Junge über dem Abgrund. Er versuchte, sich mit einem Klimmzug hochzuziehen. Da knackte es – der morsche Ast brach ab …
*
Nach der Versöhnung von Soraya und Nijano lief es besser zwischen den beiden. Sie gaben sich große Mühe, nicht zu streiten.
Jaspis und Rosenquarz versuchten, ihre Meinung nicht dauernd kundzutun.
Aber Nijano blieb unruhig. Ihm ging Red Fire nicht aus dem Kopf. Der Jungdrache wusste, dass er den Tod von Bernsteinauge rächen musste, sonst fände er keinen Frieden. Die Gelegenheit zur Vergeltung würde kommen, und er wollte vorbereit sein!
Täglich übte Nijano waghalsige Flugmanöver, trainierte Kraft sowie Ausdauer. Manchmal flog er stundenlang über die Berge, wo er verschiedene Flügelschläge ausprobierte, um den Körper mit dessen Grenzen besser kennenzulernen. Der Drache lernte, die Aufwinde zu nutzen, mit den Fallwinden umzugehen und lang auf der Stelle zu schweben, wenn der entsprechende Wind ihn unterstützte. Es gab Orte am Berg, die den Flug begünstigten, da dort die Luft glatt und aufsteigend war. Mit diesen Bedingungen lernte Nijano umzugehen und sie zu nutzen. Teilweise erwarteten ihn aber auch gefährliche Windbereiche, in denen die Luft abfallend oder turbulent reagierte. Hier wurde er brutal nach unten geschleudert, es gelang ihm nur mit Mühe, nicht vor eine Felswand zu prallen. Einmal geriet er unter den Wind, sodass er hart von der Luftströmung zu Boden geschleudert wurde.
Zwischen den Bergen entdeckte der Drache zufällig eine weitere spannende Stelle, wo der Wind wilde Kapriolen vollführte. Permanent wechselte dieser die Richtung und traf Nijano ebenso überraschend wie unberechenbar. Hier half keine Erfahrung weiter, sondern nur der pure Wille. Bis zur völligen Erschöpfung übte der Sturkopf an diesem speziellen Ort. Die Erfahrungen, die er an der Steilwand machte, waren oft sehr schmerzhaft, aber auch lehrreich.
Mehr als einmal sehnte Nijano sich danach, Bernsteinauge als Lehrerin an seiner Seite zu haben. Manchmal kramte er in deren Erinnerungen, um mehr über Red Fire und seine Art zu kämpfen zu erfahren.
Obwohl Nijano stetig weiterwuchs, wusste er, dass er Red Fire an Stärke, ebenso an Kampferfahrung unterlegen sein würde. Also musste der junge Drache diesen Mangel anders wettmachen: mit Schläue, List, Gewandtheit und Taktik. Durch die Verbindung zu Melvin fand ein Wissensaustausch statt, sodass Nijano einiges über strategische Kriegsführung erlernen konnte. In diesem Punkt war der Jungdrache dem wilden Red Fire überlegen, der nur aus Muskeln, übersteigertem Ego und Kampfeslust bestand. Diesen Vorteil musste Nijano ausspielen, um gegen den aggressiven Muskelberg eine Chance zu erhalten.
Mehr als einmal geriet der Jungdrache in Versuchung, Soraya von seinem Flugtraining zu erzählen, aber er befürchtete, dass sie deswegen mit ihm schimpfte. Deshalb unterließ er es lieber. Mit seinem Reiter Melvin hätte er darüber sprechen und gemeinsam die Flugmanöver üben können, doch der war nicht da.
Die Sehnsucht nach seinem Reiter wuchs stetig. Manchmal fühlte der Drache körperliche Qual, weil er jenen so lang nicht gesehen hatte. Der Schmerz bohrte sich tief ins Herz hinein, raubte den Atem und ließ erst Minuten später wieder nach. In solch einsamen Momenten brüllte der Gigant die Seelenpein hinaus, schrie die Felsen an, die ihn umgaben und versengte die Umgebung vor zügelloser Wut.
All dies verschwieg er Soraya, damit sie ihn nicht für einen Schwächling hielte. Allein der Gedanke daran brachte Nijano aus dem Gleichgewicht. Bewundern sollte sie ihn!
Bestimmt konnte seine Freundin nicht verstehen, was in seinem Inneren brodelte. Es reichte, dass sie ihm nicht zutraute, sich gegen einen der älteren Drachen zur Wehr zu setzen, weder gegen Songragan noch gegen Red Fire. Das ärgerte den Grüngeschuppten ziemlich, stachelte ihn aber auch gleichzeitig an, besser zu werden.
*
Ben ertrug es ebenfalls nicht länger ohne seinen Drachen. Er wurde von der Sehnsucht getrieben, mit ihm über die Berge Fanreas zu gleiten, die Aufwinde zu nutzen und sich immer höher zu schrauben. Das Gefühl der grenzenlosen Freiheit, das ihn dabei stets ergriff, hatte ihn süchtig gemacht. Eins zu sein mit dem gigantischen Wesen und wie ein König die Lüfte zu beherrschen, das brauchte er wie die Luft zum Atmen. Die Verbindung zueinander war intensiv, es bereitete Ben ebenfalls körperliche Schmerzen, so lang von Nijano getrennt zu sein. Traurigkeit legte sich auf das Herz des Jungen.
In manchen Nächten träumte er von glänzenden Schuppen im Sonnenlicht, spürte Feueratem auf der Haut. Hitze, die ihn nicht versengte, sondern sanft streichelte. Der Geruch von Rauch und Asche stieg in seine Nase, warmer Atem aus weichen Nüstern streifte die Stirn. Drachenherz, Vulkanglut, Mitternachtsflug, Sternenlicht.
Immer öfter brannte tagsüber Bens Mal auf der Schulter, kaum noch konnte er die Qual ertragen. Manchmal überfielen ihn stechende Kopfschmerzen, während dabei der Name des geflügelten Giganten durch seine Gedanken geisterte. Die Schmerzen hielten noch nicht lang an, allerdings steigerte die Dauer sich von Mal zu Mal.
Abends nahm der Junge das Drachenbuch zur Hand, das Emma ihm in Frankreich geschenkt hatte, um darin zu blättern. Neben ihm lag die versteinerte Schuppe, das Geschenk Magors als Erinnerung an Bernsteinauge. Zunächst las Ben etwas über die Technik Nafgaard, die bedeutete, dass der Reiter sich in die Sinne seines Drachen einklinken konnte. Das wollte der Junge unbedingt ausprobieren: mit Augen und Gehör des Drachen wahrnehmen!
Nach diesem Kapitel schlug er zufällig die letzten Seiten auf und stutzte. Da standen neue Sätze, die vorher nicht dagewesen waren! Verblüfft begann er zu lesen:
Ein Reiter sollte nicht zu lang von seinem Drachen getrennt bleiben, das kann sich auf Psyche und Körper negativ auswirken. Der Drache leidet und wird von großer Traurigkeit erfasst, dem Reiter ergeht es ebenso. Zunächst ensteht nur große Sehnsucht, doch später kann es zu körperlichen Symptomen kommen.
Das Sprechen in Gedanken muss stetig trainiert werden, je mehr Training, desto größer die Entfernung, die Reiter und Drache per Gedanken überbrücken können.
»Das ist ja krass! Ich denke, das ist eine Aufforderung an mich«, murmelte Ben und griff nach dem Handy, um Emma ein paar Zeilen wegen des eben Gelesenen zu schreiben: Muss Gedankensprache mit Nijano üben.
Zügig kam die Antwort: Nein, wir gehen jetzt nicht nach Fanrea, um so was zu trainieren!
Mir tut alles weh, ich werde krank ohne meinen Drachen, tippte Ben.
Blödsinn! Du störst, lese gerade!
Ben seufzte. Steht in dem Buch, das du mir geschenkt hast!
Die Antwort war typisch für Emma: Ist klar!
»Mist!«, brummte der Junge. Sie glaubte ihm nicht! Es wäre bestimmt einfacher, Emma von Angesicht zu Angesicht zu überzeugen. Er musste den richtigen Moment abpassen, um ihr genau zu erklären, was mit ihm geschah. Aber das funktionierte nicht gut übers Handy. Trotzdem schoss er ein Foto von dem Text und schickte ihn Emma.
Als Ben das Buch schließen wollte, bildeten sich neue Buchstaben auf den Seiten. Den Atem anhaltend starrte er auf die Zeilen:
Zwei sind verloren,
wer ist zur Rettung auserkoren?
Schwer ist der Weg wie nie,
denn verloren geht Magie.
Kehrt zu euch selbst zurück,
Stück für Stück.
Das Blut die Krone bedroht,
am Ende steht der Tod.
Hass vernebelt die Gedanken,
wird er wanken?
Der Diener zum Führer wird,
von dem, dessen Geist verwirrt.
»Oh, Scheiße! Das bedeutet mit Sicherheit nichts Gutes!«, fluchte Ben. Er versuchte, mit seinen Fingern die Schrift wegzuwischen, doch es gelang nicht. »Nein, nicht noch eine Prophezeiung! Am besten erzähle ich Emma nichts davon, sie macht sich sonst Sorgen.«
Missmutig starrte er auf die Worte. Ihm blieb der Sinn hinter den Zeilen verborgen, deshalb schleuderte der Junge das Drachenbuch unbeherrscht quer durchs Zimmer. Diese blöden Prophezeiungen, die in Rätseln geschrieben waren, mochte er nicht. Vor lauter Unmut rief er das Feuer, ließ Flämmchen auf den Fingerspitzen entstehen, aus denen er schließlich zwei glühende Bälle formte, mit denen er jonglierte. Am liebsten hätte er damit das Buch angezündet. Erst als er Schritte auf der Treppe vernahm, gebot Ben dem Feuer, zu erlöschen.
*
John fiel, bis das Lasso spannte. Es schnürte ihm die Luft ab, mühsam versuchte er, die Füße gegen den Felsen zu stemmen. Er befürchtete, dass der Strick ihn nicht lang hielte. Mit den Händen gelang es ihm, den Zug des Seils zu lockern, sodass sein Oberkörper nicht mehr zerdrückt wurde. Nach einem tiefen Atemzug zog er sich hoch und presste die Füße gegen den Stein. Auf diese Art kletterte er so schnell es ging nach oben.
Über ihm kämpfte Annie um den Freund. Sie hatte geahnt, dass etwas schiefginge, deshalb das Lasso mehrfach gesichert und sich bereitgehalten. Als John stürzte, trieb sie sofort sein Pferd zurück und hielt das Seil stramm. Als die Spannung schließlich nachließ, betete die Indianerin, dass er auf dem kleinen Plateau gelandet, statt abgestürzt war. Sie bewegte sich nicht vom Fleck, sondern hoffte, dass John gerade das Kalb rettete.
Inzwischen stand dieser tatsächlich bei dem verängtigten Tier und verschnaufte ein paar Sekunden. Auf die steif gefroren Hände blies er warmen Atem.
Das Kalb blökte jämmerlich und zitterte. Unbeweglich verharrend blickte es dem Menschen entgegen.
Vorsichtig näherte John sich, rutschte aus, stürzte. Eine spiegelglatte Eisfläche überzog den Felsen. Der Wind heulte, Schneekristalle peitschten schmerzhaft auf der Haut. Ächzend kam der Junge wieder hoch, setzte bedächtig einen Fuß vor den anderen, während er beruhigend auf das Tier einredete. Es starrte ihn nur an, wich nicht zurück, sondern schien zu spüren, dass John ihm helfen wollte. Schließlich gelang es ihm, es hochzuheben und über die Schultern zu legen. Es zappelte kaum, als er mit ihm den Aufstieg begann. Er gab ein Signal nach oben zu Annie, indem er mehrfach am Seil ruckte. Sie schien ihn zu verstehen, das Lasso wurde strammgezogen.
Schon beim zweiten Schritt brach der bröckelige Felsen unter dem Gewicht ab, fast wäre dem Jungen das Kalb von den Schultern gerutscht. Er zwang sich zur Ruhe. Da er das Element Erde beherrschte, konnte er den Stein erfühlen. Also verband er sich mit dem Felsen, ertastete in Gedanken, wo dieser, verborgen unter Eis und Schnee, stabil genug war, um ihn mit seiner Last zu tragen. Unterstützt durch Magie und Annies Hilfe kletterte John den Felsen hoch. Als er oben ankam, spürte er vor Kälte kaum noch die Hände.
Das Mädchen rannte mit den Pferden auf ihn zu, hob sogleich das Tier von seinen Schultern. »Du bist verrückt! Wie konntest du dich nur so in Gefahr bringen?« Doch insgeheim platzte sie vor Stolz auf ihn und bewunderte den Mut.
Der Lakota zog die Handschuhe wieder an, legte das Kalb vor seinen Sattel und bestieg dann selbst das Pferd. »Komm weiter zur Hütte, Annie. Danke für deine Hilfe! Du wusstest genau, was zu tun war. Auf dich ist Verlass!«
Das Kompliment freute Annie, sodass sie über’s ganze Gesicht strahlte. Sie trieb die Stute an und ritt voraus.
Der Sturm nahm an Intensität noch zu, die Temperatur fiel weiter. Wie Geschosse bombardierten kalte Kristalle die Haut. Deshalb gingen die beiden Indianer auf ihren Pferden in Deckung, indem sie sich an den Hals der Tiere pressten. Es gelang nicht mehr, sich zu verständigen, so laut heulte der Wind. Die Sicht wurde immer geringer. Der Lakota glaubte nicht mehr daran, dass Annie den Weg fände. Der schmale Pfad führte weiter bergab. Es wurde zu gefährlich, auf den Pferden zu bleiben, besser war es, sie am Zügel zu führen.
Der Sturm brüllte und zerrte an der Kleidung. Die Pferde stapften mit gesenktem Kopf durch den hohen Schnee, während sie sich gegen den Wind stemmten. An einigen Stellen erschwerten Verwehungen oder spiegelglatte Eisflächen das Vorwärtskommen. Entschlossen kämpften die Freunde gegen die Naturgewalten an, verloren jegliches Zeitgefühl. Scharfe Eiskristalle peitschten in die Augen. Die Kälte biss schmerzhaft in die Haut. Mühsam eroberten die zwei Teenager jeden weiteren Schritt.
»Weißt du noch, wo die Hütte ist?«, schrie John gegen den tosenden Sturm an.
»Ich glaube, ja!«, rief das Mädchen zurück. »Wir haben es gleich geschafft!«
Vor ihnen lag eine weite, weiße Fläche, es gab kaum Orientierungspunkte und auch keinen Pfad mehr. Weiter, immer weiter. Die Andeutung eines Waldrandes huscht durch ihr Blickfeld. Endlich hob Annie mühsam den Arm und zeigte nach vorn. Da war sie, die Holzhütte! Kaum hatten sie diese gesichtet, verschwand sie auch schon im Schneegestöber. Der Junge strengte sich an, die Richtung zu halten. Viel zu leicht konnte man bei solch einem Unwetter dicht am Ziel vorbeilaufen.
Nach weiteren mühsamen Minuten erreichten sie endlich völlig durchgefroren und entkräftet die Hütte. Ein kleiner Schuppen fungierte als Stall, in den sie die Pferde mit dem Kalb unterstellten. Nachdem die Freunde die Tiere versorgt hatten, gingen beide zum Eingang und traten ein. Der Wind fegte so heftig, dass John kaum die Tür zubekam. Er drückte mit der ganzen Kraft dagegen. Annie kam ihm zu Hilfe und gemeinsam gelang es ihnen, die Tür zu schließen.
»Das war knapp!« John drehte sich zu der Freundin um und grinste erschöpft. »Jetzt siehst du wirklich wie White Bird aus – oder wie ein Schneemann.«
»Du siehst nicht besser aus«, kicherte Annie.
»Wir müssen die nassen Klamotten ausziehen und uns trocknen!«
Ein erschrockener Ausdruck trat in ihre Augen. »Ganz nackt?«
Er lachte lauthals. »Von mir aus!«
»John!«
»Du hast eine Frage gestellt, ich hab dir eine Antwort gegeben.«
Sie lächelte. »Aber eine freche!«
Flüchtig musterte der Lakota die Hütte. Ein offener Kamin mit einer grob gezimmerten Bank und Holzstapel davor, ein schmales Bett mit fadenscheiniger Decke, zerbeulte Töpfe, Schrank, Tisch mit zwei Stühlen.
Als das Mädchen die Kleidung bis auf T-Shirt und Unterwäsche ablegte, konnte John sich nicht verkneifen, hinzusehen. Verlegen hielt Annie die Jacke vor den Körper.
Ertappt schaute der Indianer weg und entzündete das Feuer. Das Mädchen besaß wunderschön geformte, muskulöse Beine, denen er noch einen weiteren verstohlenen Blick zuwarf.
Endlich flackerte das Feuer, und die beiden saßen leicht bekleidet vor den wärmenden Flammen. Fürsorglich breitete der Junge die Decke um die Schultern der Freundin.
»Komm mit hier drunter«, bot das Mädchen an und lüftete die raue Decke. Es gab nur die eine.
Er nahm das Angebot an, Annie schmiegte sich zitternd an ihn. Als er den Arm um sie legte, spürte er, wie eisig sie war. Ihre beiden Körper bebten vor Kälte, die nassen T-Shirts klebten an der Haut.
»Hast du Hunger?«, fragte Annie. »Ich habe einen Beutel mit Nüssen dabei.«
»Wie früher! Irgendetwas hast du immer aus deinen Taschen gezaubert, du bist nie ohne Verpflegung losgezogen.«
»Du warst oft froh, dass es so war!«
John lächelte. »Stimmt! Jetzt bin ich es auch wieder.«
Die Indianerin griff nach der Tasche, wühlte darin herum und beförderte einige Nüsse zutage.
Als sie alle aufgegessen hatten, bemerkte John, dass das Mädchen noch zitterte. »Wir ziehen besser unsere T-Shirts aus, sie sind zu nass. Sonst werden wir krank«, schlug er betont sachlich vor. Innerlich schüttelte er den Kopf über sich. In was war er hier nur hineingeraten? Annie wirkte äußerst reizvoll. Es wäre besser, er bliebe auf Abstand. Stattdessen warfen sie ständig mehr Kleidung ab. Die ganze Situation brachte den Lakota in einen starken Gewissenskonflikt, er dachte an Emma und sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Dem einen Glatteis konnte er entkommen, aber gerade begab er sich auf ein weitaus gefährlicheres. Wie fände er es, wenn Emma mit einem Jungen erlebte, was er hier tat? Aber es bestand die Notwendigkeit, den Körper zu wärmen! Das Kribbeln im Bauch sprach allerdings eine eigene Sprache … Emma! Warum rief sie ihn nicht zu sich? Weshalb offenbarte sie ihm nicht endlich ihre Gefühle und sprach offen von Liebe? Als Annie das T-Shirt auszog, verdrängte John die Gedanken an Emma. Er legte seines ebenfalls ab und hing fürsorglich die nassen Sachen zum Trocknen auf.
Schließlich saßen die zwei Jugendlichen Haut an Haut, nur die Unterwäsche trugen sie noch. Verlegen sahen beide in die Flammen und spürten intensiv die Nähe des anderen.
Die Indianerin legte den Kopf an die Schulter des Freundes, sodass die nassen Haare seine Haut streiften. Verstohlen musterte das Mädchen die proportionierten Muskeln und konnte nicht verhindern, dass eine Hand den Bizeps streichelte.
Die Berührung ließ John zusammenzucken. Er hielt kurz die Luft an. Gleichzeitig schoss das Tempo des Herzschlags in die Höhe.
»Du trainierst viel, oder?«, fragte Annie mit Bewunderung in der Stimme.
»Ja, jeden Tag. Ich bin daran gewöhnt, ich kann gar nicht anders.«
»Du siehst toll aus, John!«
»Danke! Du siehst auch nicht übel aus! Um ehrlich zu sein: Du bist verdammt hübsch!«
Das Kompliment ließ Annie erröten, doch sie freute sich. »Erzähl mir noch mehr von Fanrea«, bat sie.
»Was möchtest du denn wissen?«
»Viel mehr über die Magie. Am besten zeigst du mir deine Elementemagie!«
»Nein! Das ist voll angeberisch!«
»Komm schon, stell dich nicht so an! Bitte!«
Als John ihren flehenden Blick sah, gab er nach. »Okay! Wie du weißt, ist mein Element die Erde. Dazu gehören auch Pflanzen und Bäume. Siehst du die Holzschale da im Regal?«
»Ja!«
Er hob eine Hand, mit der er kleine Fingerbewegungen machte. Die Schale hob ab und schwebte in Annies Hand.
»Oh, wie toll!« Sie strahlte ihn an, die Augen voller Begeisterung.
Zunächst ließ John das gestapelte Feuerholz umherwirbeln, das er anschließend neu sortierte. Der Boden war mit Staub und einigen Erdkrümeln bedeckt. Durch einen Schlenker der Hand brachte der Junge diese dazu, sich auf einem Haufen zu sammeln.
Fasziniert beobachtete die Freundin die Zauberei. »Erspart einem das Kehren!« Sie lächelte ihn matt an. »Vermisst du Fanrea?«
Ein wehmütiger Ausdruck trat in Johns Augen. Er seufzte. »Ja, sehr! Die Erde ist wunderschön. Ich bin froh, dass ich mir mit meinem Freund viel angesehen habe. Aber die Menschen darauf sind oft grausam und egoistisch. Es fällt mir immer besonders auf, wenn ich Nachrichten höre oder lese. Jedes Mal bin ich danach traurig. Es geht ständig um Korruption, Grausamkeit, Skandale, Umweltsünden. Sogar vor Morden schrecken sie nicht zurück.«
»Das stimmt leider. Aber es gibt manchmal auch Erfreuliches.«
»Was denn? Mir fällt nichts ein! Trotz aller Schönheit deprimiert mich die Erde. Viel zu viele Menschen sind süchtig nach Macht und Geld. Um ihre Ziele zu erreichen, holzen sie den Regenwald ab, überfischen die Meere, fälschen Untersuchungsergebnisse, leiten Gift ins Grundwasser, manipulieren und betrügen. Wie Marionetten der Mächtigen tanzen die Politiker nach deren Plan, sie dienen nur sich selbst und den großen Strippenziehern.«
»Ach John, du hast ja recht! Aber es gibt auch großartige Menschen auf der Erde, die sich für Arme einsetzen. Sie helfen uneigennützig und unermüdlich. Das darfst du nicht vergessen! Je mehr du mir von Fanrea erzählst, glaube ich, dass ich dort ebenfalls glücklicher wäre!«
Erstaunt musterte er Annies Gesicht und las darin ihre Sehnsucht. »Du würdest gut dahin passen. Ja, dir würde es gefallen, White Bird!« Nachdenklich stocherte er mit einem Stock im Feuer. Es knisterte, Holz zersprang. Funken flogen hoch und leuchteten kurz auf. Licht und Schatten spielten miteinander, verwandelten die einfache Hütte in einen romantischen Zufluchtsort. »Dieses Lügengebilde auf der Erde schnürt mir die Luft zum Atmen ab. Fast nichts ist so, wie es dargestellt wird! Erfindungen werden nicht auf den Markt gebracht, weil sie irgendeinen Profit gefährden. Riesige Summen Geld werden von den Mächtigen hin und her geschoben, aber viele zu viele Menschen haben kaum etwas zu essen. Sinnlose Kriege werden angezettelt, damit die Waffenindustrie Gewinne einfährt. Es ist eine Endloskette aus Schmutz, Lug und Betrug!« Er verfiel in Schweigen.
Niedergeschlagen und erschöpft starrten beide ins Feuer. Seine Worte hallten in den Köpfen nach. Nach einer Weile bemerkte Annie, wie ihr die Augen zufielen, die Anstrengungen forderten ihren Tribut. »Ich bin müde, John.«
»Ich auch. Komm, wir legen uns hin!«
Wärme suchend kuschelten sie sich unter der Decke auf dem schmalen Bett aneinander.
Annie lag ganz nah bei John. Er spürte ihren Atem am Hals und wagte nicht, sich zu bewegen. »Wir müssen schlafen«, flüsterte er heiser.
»Ja!«
Stille. Nur das Prasseln der Flammen und der heulende Wind waren zu hören.
Verlegen zuppelte das Mädchen die kratzige Decke zurecht. »Weißt du noch, wie wir als Kinder zusammen im See gebadet und anschließend die Wolken betrachtet haben? Wir überlegten, woher sie kamen und wohin sie fliegen würden.«
John lachte leise. »Stimmt! Oder wir haben stundenlang Figuren geschnitzt.«
»Du hast mir beigebracht, Tierstimmen nachzumachen.«
»Dafür kann ich durch dich Maisfladen backen. Oder nähen und weben!«
»Du warst der beste Lehrmeister fürs Bogenschießen oder wie ich Kaninchen mit einer Schlinge fangen kann«, ergänzte die Indianerin und zögerte kurz. »Du hast mir meinen ersten Kuss gegeben!«
»Nein, du hast mich zuerst geküsst!«, widersprach John.
»Du meinst so?« Sie beugte sich über ihn und gab ihm einen flüchtigen Kuss auf den Mund. Ein leichter Pfirsichgeruch umgab sie.
Doch der Lakota hielt Annie fest und küsste sie, zärtlich und verlangend zugleich.
Sie erwiderte den Kuss, ihre Lippen spielten mit seinen. Es fühlte sich gut an.
Verwirrt ließ John von ihr ab, drehte sich abrupt weg. »Schlaf schön, White Bird!« Seine Worte klangen gepresst.
»Du auch«, hauchte sie verlegen, schmiegte sich aber trotzdem noch enger an ihn, sodass er jeden ihrer Atemzüge spürte.
Als der Lakota am nächsten Morgen aufwachte, hatte der Sturm nachgelassen. Stille umgab die Hütte. Annie schlief noch. Zärtlich betrachtete John ihr entspanntes Gesicht. Die langen Wimpern lagen auf den Wangen, die vollen Lippen waren leicht geöffnet. Vorsichtig streichelte er das zarte Kinn, um sie zu wecken.
Als sie die Augen aufschlug und John sah, spiegelte ihre Miene das Glücksgefühl im Inneren.
»Guten Morgen, Kleine!«
»Hi, du!«
»Wir sollten direkt aufbrechen, damit sich deine Eltern nicht allzu große Sorgen machen!«
»Okay!«
Auf dem Heimritt bei strahlendem Sonnenschein verhielt John sich schweigsamer als sonst. Er dachte über die vergangene Nacht nach und was hätte passieren können, wenn er nicht so beherrscht gewesen wäre. Sein Herz gehörte Emma, er war sich der Liebe zu ihr so sicher gewesen, es gab nicht den geringsten Zweifel daran, dass er sie liebte. Dennoch … Letzte Nacht hatte er Annie begehrt, selbst jetzt noch brannte der Kuss auf seinen Lippen. Was geschah nur mit ihm? Zerrissenheit quälte ihn! Seit er in Fanrea gestrandet war, fühlte er sich geerdet, er lebte genau dort, wo er hingehörte. Fanrea wurde zur Heimat. Dann trat Emma in sein Leben und wirbelte sämtliche Gefühle durcheinander, zwang ihn dazu, das Leben erneut zu überdenken. Der Gedanke, Fanrea zu verlassen, fiel ihm nicht leicht, aber aus Liebe zu Emma war er bereit dafür.
Nun kam auch noch Annie dazu, und er wusste überhaupt nicht mehr, wohin er gehörte. Wo und wie wollte er leben? Mit wem vor allen Dingen? Das Beste schien ihm, das Reservat zu verlassen, um seine Gedanken neu zu sortieren. Die Nähe zu seiner Jugendfreundin machte ihn schwindelig.
Erleichtert lieferte er die Indianerin bei den Eltern ab, froh, sich den kreisenden Gedanken allein stellen zu können. Er liebte Emma nach wie vor, doch momentan spukte nur Annie in seinem Kopf herum und die gemeinsame Nacht in der Hütte. Konnte er zwei Mädchen lieben? Bedeutete das mit Annie lediglich Begehren? Nein, eindeutig nicht, er empfand viel für sie, immer schon. Als Kind und Jugendliche war sie für ihn einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben gewesen, er hatte sie nur all die Jahre aus den Gedanken verdrängt.