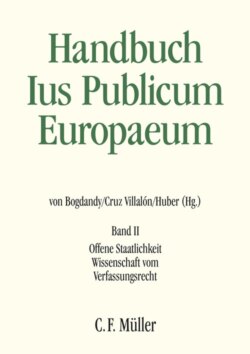Читать книгу Handbuch Ius Publicum Europaeum - Adam Tomkins - Страница 118
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die „europäische Dimension“ und die Parlamentssouveränität
Оглавление1
In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Einfluss der europäischen Integration auf die britische Verfassungsstruktur und mit den verfassungsrechtlichen Mechanismen für die europäische Integration im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Beleuchten möchten wir dabei vor allem die Natur und das Ausmaß der Europäisierung der Verfassungsordnung, namentlich mit Blick auf das Verhältnis zwischen den Verfassungsorganen.
2
In vielerlei Hinsicht ist die Verfassung des Vereinigten Königreichs sehr insular. Sie ist ungeschrieben. Sie beruht auf dem Common Law, welches in vielen Teilen der Welt Einzug gehalten hat, nicht allerdings auf dem europäischen Kontinent. Die Entwicklung der englischen Verfassung wurde von der Beziehung und den Konflikten zwischen der Krone und den Reichsständen bestimmt. Aus dieser Beziehung resultiert auch die Bedeutung des Begriffes der Souveränität, so wie er grundsätzlich bis heute verstanden wird. Die Mitgliedschaft in der EU zwingt allerdings zu einer Modernisierung des britischen Souveränitätsverständnisses. Diese Frage der Modifikation des englischen Souveränitätsbegriffes ist für das britische Recht ähnlich schwierig wie die Frage, ob das europäische Recht den Grundrechtsgarantien des deutschen Grundgesetzes standhält, für das deutsche Verfassungsrecht.
3
Die Doktrin der Parliamentary Sovereignty (Parlamentssouveränität) beinhaltet den Grundsatz, dass kein Parlament seine Nachfolger binden kann und dass seine Rechtsakte von keiner Institution oder Person überprüfbar sind. Dies ist ein Ausdruck der politischen Souveränität des Volkes, welches das Parlament repräsentiert. Diese in sich ruhende, auf den Nationalstaat ausgerichtete Doktrin der Parlamentssouveränität war an die Bedingungen anzupassen, welche die Mitgliedschaft in der EU mit sich brachte. Die Inkorporierung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch den Human Rights Act 1998 und der Dezentralisierungsprozess in Schottland und Wales führten zu weiteren Modifikationen der Doktrin.
4
Trotz dieser Entwicklungen wurde die Parlamentssouveränität in ihrem rechtlichen Sinne beibehalten. Der britische Begriff der Souveränität bezieht sich insbesondere auf institutionelle Stabilität und Haltbarkeit. Die repräsentative Natur des Parlaments sollte die Interessen schützen, auf denen es beruhte – das Parlament garantierte die verfassungsrechtliche Ordnung der Rechte und Freiheiten der Bürger (Untertanen). Praktische Begrenzungen dieser Doktrin sind jedoch seit Generationen akzeptiert worden.
5
Das Common Law, welches von Richtern angewendet wird, denen gemäß dem Act of Settlement im Jahre 1701 ihre Amtszeit auf Lebenszeit garantiert ist, hat sich schrittweise entwickelt, indem es die Praktiken der Vergangenheit als Präzedenzfälle für die Entwicklungen in der Zukunft nutzt. Das britische Rechtssystem unterscheidet sich insoweit stark von allen kontinentalen Systemen, unter denen es natürlich auch unterschiedliche Traditionen gibt. Trotz dieser Unterschiede hat das Vereinigte Königreich einen bemerkenswerten Grad an Integration und Europäisierung in seiner verfassungsrechtlichen Praxis und Rechtsdogmatik erreicht.
6
Der britischen Tradition liegt in verfassungsrechtlicher Hinsicht „offiziell“ keine „offene Staatlichkeit“ zugrunde. Die britische Tradition ist geprägt durch Einflussnahme auf andere, nicht durch die Rezeption fremder Maßstäbe und Rechtssätze. In Zeiten des britischen Empire war die Übernahme einheimischer Eigenarten in den Kolonien zwar ein bekanntes Phänomen; aber es gab umgekehrt keine wirklich maßgeblichen Einwirkungen fremder Rechtsordnungen auf die verfassungsrechtliche Ordnung und Entwicklung des Vereinigten Königreichs. Seine Verfassung beruht auf dem Common Law, dessen genauer Inhalt allerdings bis heute nicht vollkommen geklärt ist. Eine auf dem Common Law beruhende Verfassung basiert auf den Gebräuchen, Praktiken und Präzedenzfällen der regierenden Institutionen. Die Parameter einer solchen Verfassung werden im Rahmen von gegenseitig anerkannten Limitierungen durch Entscheidungen dieser Institutionen festgelegt. Es war daher die Richterschaft, die Natur und Ausmaß der Parlamentssouveränität bestimmte und prägte, nicht der Gesetzgeber. Dies hat eine gewisse Zwangsläufigkeit, denn das Common Law gibt der Krone ihre Befugnisse (prerogatives) und entscheidet über deren Grenzen sowie seit den 1980er Jahren auch über die Rechtmäßigkeit ihrer Ausübung. Es wird deshalb vertreten, dass das Common Law auf dem so genannten „Fundamental Law“ beruhe, dem Recht des Volkes. Das verfassungsrechtliche Erbe ist reichlich versehen mit Bezugnahmen auf dieses „Fundamental Law“, auf dem das englische Verfassungsrecht angeblich historisch basiert.[1]
7
Mit einer jüngeren Generation von Common Law-Juristen aus Großbritannien und dem Commonwealth hat der Rückgriff auf eine auf dem Common Law beruhende Verfassung eine zunehmend globale Dimension erlangt, wobei versucht wird, Werte wie Rationalität und Menschenrechte in die Tradition des Common Law einzubeziehen.[2] In der Tat sind die Grundsätze des internationalen Gewohnheitsrechts als Bestandteile des Common Law anzusehen, und auch eine zunehmende Internationalisierung des nationalen öffentlichen Rechts ist evident. Dies ermöglicht vielleicht ein Kontinuum von nationalen zu internationalen Normen, kann diese Doktrin doch über viele Jahrhunderte zurückverfolgt werden.[3]
8
Mit der zunehmenden Internationalisierung der Weltordnung seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die britische Rechtstradition zunehmend positivistisch und daher mehr auf die Parlamentssouveränität sowie auf einen rechtlichen Dualismus fixiert. Beide Aspekte nahmen 1973 im Kontext des Beitritts zur EWG und seiner Regelung durch den European Communities Act 1972 einen hohen verfassungsrechtlichen Stellenwert ein. Während die Ratifikation völkerrechtlicher Verträge ausschließlich der Exekutive, der Krone, vorbehalten ist, muss eine Änderung des materiellen Rechts auf der nationalen Ebene vom Parlament durch einen Gesetzgebungsakt bewirkt werden. Infolgedessen musste das Recht der Europäischen Gemeinschaften durch den European Communities Act 1972 im britischen Recht implementiert[4] werden. Diesen Ansatz bekräftigend ist im European Parliamentary Elections Act 2002 mittlerweile darüber hinaus festgelegt, dass jegliche Erweiterung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments vom englischen Gesetzgeber vor der Ratifizierung des entsprechenden völkerrechtlichen Vertrages legitimiert werden muss.[5]
9
Die britischen Gerichte teilen diesen Ansatz, worin durchaus eine Parallele zur Haltung des deutschen Bundesverfassungsgerichtes in der Maastricht-Entscheidung[6] gesehen werden kann. Soweit jedoch kein Gesetz vorliegt, können weder das Parlament noch die Gerichte über den Abschluss von Verträgen Kontrolle ausüben. Das Parlament wird normalerweise von dem Abschluss eines Vertrages lediglich unterrichtet.[7] Im Fall Rees-Mogg beantragte der Herausgeber der Times festzustellen, dass dem Außenminister die Kompetenz zur Ratifizierung des Maastrichter Vertrags gefehlt habe.[8] Obwohl das House of Lords Zweifel an der rechtlichen Überprüfbarkeit der Frage hegte, entschied es doch in der Sache.
10
Die Gerichte nutzen völkerrechtliche Verträge zudem als Auslegungshilfen für die Interpretation der Gesetze, durch welche die Verträge in nationales Recht umgesetzt worden sind, wovon sie vor allem in jüngerer Zeit mehr und mehr Gebrauch machen. Die Bereitschaft, internationale Verträge in dieser Weise anzuwenden, hat in einem zu begrüßenden Ausmaß zugenommen, wie u.a. das Gerichtsverfahren im Fall Pinochet zeigt. Die Mehrheit der Law Lords entschied hier, dass allgemeine Regeln des Völkerrechts, welche Folter, Völkermord und Geiselnahme verbieten, belegen, dass ein entsprechendes Verhalten nicht akzeptabel ist, auch nicht für ein ehemaliges Staatsoberhaupt. Da Folter und Geiselnahme nach britischem Recht Straftaten sind, für die das Vereinigte Königreich auch extraterritorial zuständig sei, könnten diese Handlungen auch Gegenstand eines Strafprozesses im Inland sein. In einer neuen Verhandlung entschied das House of Lords in anderer Zusammensetzung, dass die fraglichen Verbrechen, derentwegen Pinochet angeklagt war, außerhalb des Hoheitsbereiches des Vereinigten Königreichs begangen worden seien, im Vereinigten Königreich jedoch gleichwohl verfolgt werden könnten, wenn sie im Zeitpunkt der Tat auch Verbrechen nach englischem Recht waren.[9]
11
Es besteht ferner wie im Fall European Roma Rights Centre v. Immigration Officer at Prague Airport die Bereitschaft, Normen des Völkergewohnheitsrechts für die Interpretation von nationalem Recht heranzuziehen, wenn es um die Verantwortlichkeit von Hoheitsträgern geht.[10]