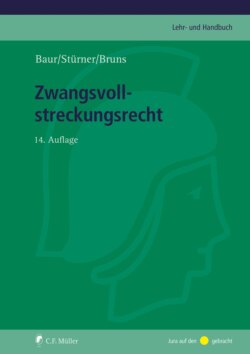Читать книгу Zwangsvollstreckungsrecht, eBook - Alexander Bruns - Страница 418
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Inhalt der Schadensersatzpflicht
Оглавление15.48
Für die Schadensersatzpflicht gelten die §§ 249–255 BGB. Zu ersetzen ist nicht nur die beigetriebene oder „freiwillig“ erbrachte Leistung selbst, sondern jeder unmittelbare und mittelbare Schaden, der dem Schuldner durch die Vollstreckung des Urteils oder durch eine Leistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung entstanden ist[95]. Keinesfalls ist erforderlich, dass der Gläubiger durch die Vollstreckung etwas erlangt hat[96].
So muss auch der Schaden ersetzt werden, den der Schuldner durch einen gegen ihn gerichteten, aber vergeblich gebliebenen Vollstreckungsversuch erlitten hat, z.B. durch Aufbrechen seiner Türen oder Behältnisse. Der Ersatzanspruch umfasst ferner beispielsweise den Schaden, den der Schuldner dadurch erleidet, dass er Geld als Sicherheit zum Vollstreckungsschutz hinterlegen muss, welches er sonst Gewinn bringend anderweitig hätte verwerten können[97]; nicht dagegen den Schaden, der durch andere Maßnahmen zur Abwendung der Zwangsvollstreckung als durch Zahlung, Hinterlegung oder Sicherheitsleistung entstanden ist, also z.B. aus der Erklärung der Zahlungseinstellung oder durch den Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens[98]. Nicht von § 717 Abs. 2 erfasst sind nach der Rechtsprechung des BGH auch „Begleitschäden“ am Inventar bei Räumungsvollstreckung, die aber nach den Grundsätzen der Amtshaftung ersatzfähig sein können (§ 839 BGB, Art. 34 GG)[99]. Sehr zweifelhaft ist, ob unter die Ersatzpflicht auch ein Vermögensschaden fällt, der erst Folge einer durch die Zwangsvollstreckung hervorgerufenen seelischen Erkrankung ist, oder ein Schaden, der in der Zurückhaltung möglicher Geschäftspartner wegen vollzogener Vollstreckungen begründet liegt[100]. Beides sollte man – entgegen dem BGH – bejahen, sofern es nicht um Schäden geht, die in der Verurteilung als solcher ihre Ursache haben.