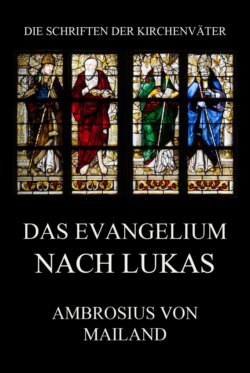Читать книгу Das Evangelium nach Lukas - Ambrosius von Mailand - Страница 6
Erstes Buch, Luk. 1, 1―25 1. Der Prolog zum Evangelium, Luk. 1,1-4
Оглавление
Verwandte Erscheinungen in der alt- und neutestamentlichen Heilsgeschichte: wahre und falsche Propheten (1). Apokryphe Evangelien (2). Die Wirksamkeit der Inspirationsgnade im Hagiographen (3). Das Wort, nicht das Wunder das Mittel der Glaubensverbreitung (4). Vom Schauen des Wortes Gottes (5—7). Intention und Handlung, die beiden Tugendfunktionen im Vollkommenen (8—9). Der menschliche Wille und die Inspiration (10). Nicht Vollständigkeit, sondern Sorgfältigkeit ein formaler Vorzug der Lukasschrift (11). Das Evangelium ein den Gläubigen anvertrautes Pfand (12). Vom Mottenfraß der Häresie (13). Vom Rost der Sünde an der Seele (14).
1.
[ ] * „Weil denn viele versucht haben, eine geordnete Darstellung von den Tatsachen zu geben"42. Die Geschichte unserer Zeit weist in ihrer Entwicklung vielfach die gleichen Erscheinungen und Ursachen auf wie die altjüdische, teilt mit ihr analoge Vorgänge, die den gleichen Lauf und Verlauf nehmen, hat Geschehnisse mit ihr gemeinsam, die sich vom Anfang bis zum Ende ähneln. Wie43 nämlich viele in jenem Volk auf Eingebung des göttlichen Geistes geweissagt haben, andere hingegen nur sich anheischig machten zu weissagen und ihren Beruf durch Lügenhaftigkeit herabwürdigten ― sie waren mehr Pseudopropheten als Propheten, wie Ananias, der Sohn Azots44; das Volk aber besaß die Gabe der Unterscheidung der Geister45, um zu erkennen, welche es zur Zahl der Propheten rechnen, welche es dagegen gleich einem tüchtigen Münzkontrolleur für unecht erklären solle, nachdem an ihnen mehr die trübe Farbe eines falschen Münzstückes denn das Blinken echten Metallglanzes hervorträte ― so haben wir dieselbe Erscheinung auch jetzt noch im Neuen Testament: Viele haben versucht, Evangelien zu schreiben, welche die guten Münzkenner als unecht befunden haben. Nur eines* aber, in vier Büchern dargestellt, glaubten sie aus allen (als echt) auswählen zu müssen.
2.
Noch ein anderes Evangelium zwar ist im Umlauf, angeblich von den Zwölfen verfaßt46. Auch Basilides47 unterfing sich, ein Evangelium zu schreiben, das sogenannte ‚Evangelium nach Basilides'. Wiederum ein anderes Evangelium zirkuliert unter dem Titel ‚Nach Thomas'48. Eine weitere Schrift kenne ich ‚Nach Matthias'49. Wir haben einige (Apokryphen) gelesen, um ihrer Lektüre zu steuern; gelesen, um nicht im Unwissenden darüber zu sein; gelesen, nicht um sie zu behalten, sondern zurückzuweisen; um zu wissen, welcher Art die Schriften sind, worin jene (Gnostiker) mit großem Getue „ihr Herz erheben"50. Doch die Kirche hat, obschon im Besitze von nur vier Evangelienschriften, die ganze Welt voll Evangelisten, die Häresien trotz deren Menge nicht einen; denn viele haben wohl „den Versuch gemacht", doch durch Gottes Gnade ohne Erfolg. So manche auch haben diejenigen Abschnitte aus den vier Evangelienschriften, die ihrer Meinung nach mit dem Gift ihrer Lehren übereinstimmten, zu* einem* Ganzen vermengt. ― So lehrt nun die Kirche in dem* einen* Evangelium, das sie besitzt, nur* einen* Gott, jene hingegen, nach welchen der Gott des Alten Testamentes von dem des Neuen verschieden ist, haben den vielen Evangelien zufolge nicht einen, sondern mehrere Götter geschaffen.
3.
[Forts. ] „Weil denn viele versucht haben". Ja nur „versucht" haben sie’s, die nichts zu Ende führen konnten. Daß viele daran gegangen, aber nicht zu Ende gekommen sind, bezeugt nun mehr denn hinlänglich auch der heilige Lukas, indem er hervorhebt, gar viele hätten den Versuch gemacht. Wer es nämlich bloß zum Versuch einer geordneten Darstellung brachte, setzte nur sein eigenes Mühen ein und brachte nichts zu Ende; denn die Charismen und die Gnade Gottes belassen es nicht beim bloßen Versuch. Diese pflegt vielmehr den Geist des Schriftstellers im Augenblick, da sie sich in ihn ergießt, zu befruchten, so daß er nicht darbt, sondern reichlich überquillt. Nicht beim Versuche blieb ein Matthäus stehen, nicht beim Versuch ein Markus, nicht beim Versuch ein Johannes, nicht beim Versuch ein Lukas, sondern kraft des göttlichen Geistes, der ihnen die Fülle aller Aussprüche und Taten (des Herrn) darbot, führten sie das Begonnene ohne alle Anstrengung zu Ende. Darum fügt nun (Lukas) passend hinzu: „Weil denn viele versucht haben, eine geordnete Darstellung von den Tatsachen zu geben,* die in uns erfüllt worden sind", bezw.: „die in uns in Fülle vorhanden sind"*.
4.
Was nämlich in Fülle da ist, dessen mangelt niemand, und was in Erfüllung gegangen, das bezweifelt keiner, weil die Verwirklichung Glaubwürdigkeit begründet, der schließliche Ausgang sie offen dartut. So ist nun das Evangelium eine erfüllte Tatsache und strömt (in seiner Überfülle) über auf alle Gläubigen auf dem ganzen Erdkreise und befruchtet den Geist und bestärkt den Sinn aller. Mit Recht hebt darum (der Evangelist), der „im Felsen (Christus) gründend"51 die ganze „Fülle des Glaubens"52 und die Kraft der Standhaftigkeit in sich aufgenommen, hervor: „die* in uns* erfüllt worden sind". Denn nicht mit Zeichen und Wundern, sondern durch das Wort scheiden diejenigen das Wahre und Falsche auseinander, welche die Heilsgeschichte des Herrn darstellen, oder welche ihren Sinn auf das Wunderbare an ihm hinlenken. Denn was wäre so vernünftig als der Glaube, daß die Werke übermenschlicher Art, von denen man liest, Wirkungen einer höheren Natur sind, oder aber der Glaube, daß das Sittliche53, von dem man liest, das Erlebnis einer wirklich angenommenen Menschheit54 ist? So gründet denn unser Glaube in Wort und Vernunft, nicht in Wunderzeichen.
5.
„Wie es uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an selbst Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind"55. Dieser Satz will nicht sagen, daß wir mehr Wert auf den Dienst als auf das Anhören des Wortes legen sollen. Es wird vielmehr damit überhaupt nicht das gesprochene Wort, sondern jenes wesenhafte Wort bezeichnet, das „Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat"56. Darum wollen wir darunter auch nicht das Wort im gewöhnlichen Sinn, sondern jenes himmlische verstehen, in dessen Dienst die Apostel standen. Es steht indes im Buche Exodus zu lesen: „Das Volk sah die Stimme des Herrn"57. Die Stimme sieht man doch nicht, sondern man hört sie. Denn was ist die Stimme anders als ein Laut, den man nicht mit Augen sieht, sondern nur hört. Demgegenüber war es Moses zu tun, gar tiefsinnig zu erklären, wie Gottes Stimme sich schauen lasse; mit des Geistes Auge im Innern nämlich lasse sie sich schauen. Im Evangelium hingegen schaut man nicht die Stimme, sondern jenes Wort, das vorzüglicher ist denn die Stimme. Darum versichert auch der heilige Evangelist Johannes: „Was von Anfang war, was wir gehört und was wir gesehen, mit eigenen Augen geschaut und unsere Hände geprüft haben vom Worte des Lebens: und das Leben ist offenbar geworden, und wir haben es geschaut und bezeugen und verkündigen euch vom Leben, welches beim Vater war und uns erschienen ist"58. Du siehst also, wie die Apostel das Wort Gottes sowohl schauten wie hörten. Sie schauten nämlich den Herrn nicht bloß als Menschen, sondern auch als das Wort: sie, die mit Moses und Elias die Herrlichkeit des Wortes schauten59, schauten das Wort; denn nur die, welche im Lichte der eigenen Verklärung schauten, vermochten Jesus zu schauen, andere schauten ihn nicht: sie vermochten nur seinen Leib zu sehen; denn nicht mit leiblichem, sondern mit geistigem Auge wird Jesus geschaut.
6.
So schauten denn die Juden Jesus nicht, obschon sie ihn sahen. Es schaute ihn aber Abraham; denn es steht geschrieben: „Abraham hat meinen Tag geschaut und frohlockt"60. Es schaute ihn Abraham, obschon er doch den Herrn nicht im Leibe gesehen. Doch da er ihn im Geiste schaute, schaute er ihn auch im Leibe; wer ihn aber nur leiblich sah und nicht geistig schaute, der schaute im Leibe nicht, was er sah. Es schaute ihn Isaias und schaute ihn, weil er ihn im Geiste schaute, auch im Leibe: „Nicht hatte er, so sprach er denn, seine Gestalt noch Schönheit"61. Nicht schauten ihn die Juden; denn „verblendet war ihr törichtes Herz"62. Er selbst auch bezeugt die Unfähigkeit der Juden, ihn zu schauen, mit den Worten: „Blinde Führer, die ihr die Mücke seiht, das Kamel aber verschluckt!"63 die schrieen: „Kreuzige, kreuzige ihn!"64 „Denn hätten sie ihn geschaut, würden sie nimmermehr den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt haben"65. Wer also Gott schaute, schaute auch den Emanuel, d. i. er schaute den Gott-mit-uns66; wer aber den Gott-mit-uns nicht schaute, konnte den nicht schauen, den die Jungfrau geboren. Es glaubten denn auch jene, welche an den Sohn Gottes nicht glaubten, auch nicht an den Sohn der Jungfrau.
7.
Was heißt nun ‚Gott schauen'? Frag nicht mich! Frag das Evangelium, frag den Herrn selbst! Vielmehr vernimm gleich seine Antwort: „Philippus, wer mich geschaut, hat auch den Vater geschaut, der mich gesendet hat. Wie kannst du sprechen: zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im Vater bin und der Vater in mir ist?"67 Kein Körper kann doch in einem anderen, kein Geist in einem anderen geschaut werden: indes jener Vater allein wird im Sohn geschaut, bezw. dieser Sohn im Vater geschaut; denn Unähnliches läßt sich nicht in Unähnlichem schauen, vielmehr kann nur unter der Voraussetzung der Einheit des Wirkens und der Kraft der Sohn im Vater und der Vater im Sohne geschaut werden. „Die Werke, die ich vollbringe, versichert er, vollbringt auch jener"68. In den Werken wird Jesus geschaut, in den Werken des Sohnes auch der Vater wahrnehmbar. Der schaute Jesus, der jenes Geheimnis in Galiläa schaute, weil ja niemand außer dem Herrn der Welt Elemente verwandeln konnte69. Ich schaue Jesus, wenn ich lese, wie er einen Blinden die Augen mit Erde bestrich und das Augenlicht zurückgab70; denn ich erkenne den wieder, der den Menschen aus Erde bildete und ihm den Geist des Lebens, das Licht der Augen eingoß71. Ich schaue Jesus, da er Sünden vergibt; denn niemand kann Sünden nachlassen als Gott allein72. Ich schaue Jesus, da er den Lazarus auferweckt73, während ihn die Augenzeugen (des Vorganges) nicht schauten. Ich schaue Jesus, schaue desgleichen den Vater, da ich die Augen zum Himmel erhebe, nach den Meeren wende, zur Erde zurücklenke; „denn was an ihm unsichtbar ist, wird in den geschaffenen Dingen geistig wahrgenommen"74.
8.
„Wie es uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind." Ein Zweifaches erheischt die Tugend im Vollkommenen: Intention und Handlung. Beide Funktionen nun legt der heilige Evangelist den Aposteln bei; denn sie waren, wie er hervorhebt, nicht bloß Schauer, sondern auch Diener des Wortes. Das Schauen intendierte den im Handeln bestehenden Dienst. Zweck der Intention aber ist die Handlung, das Erste in der Handlung die Intention. Und um uns speziell des Beispieles der Apostel zu bedienen: Die Intention besteht darin, daß Petrus und Andreas, sobald sie die Stimme des Herrn: „Ich will euch zu Menschenfischern machen" hatten rufen hören, ohne Verzug den Ruderpflock verließen, dem Worte folgten75. Doch in der Intention ist nicht ohne weiteres auch die Handlung eingeschlossen. Nicht einmal dort ist noch von einer Handlung, sondern erst von der Intention die Rede, wo Petrus klagt: „Herr, warum sollte ich Dir jetzt nicht folgen können? Mein Leben will ich für Dich einsetzen"76. Das war nämlich erst die Intention, war aber noch nicht die Leidenstat, mochte auch im Fasten, mochte im Wachen, mochte im Verzicht auf sinnliche Genüsse immerhin bereits ein Handeln liegen; es ist dies ja das Handeln eines Christen. Nicht in allem Tun liegt nämlich Intention und Handlung zugleich, sondern während bei dem einen ein Handeln vorliegt, ist bei einem anderen erst die Intention gegeben. So hat gerade auch Petrus, obschon er bereits vieles mit unermüdlichem, apostolischem Tugendeifer vollführt hatte, dennoch erst später auf des Herrn Ruf „du folge mir"77 sein Kreuz getragen, ist dem Worte nachgefolgt und hat der Tat des Leidens sich unterzogen. Doch mochte immerhin bei Petrus, Andreas, Johannes und den übrigen Aposteln Intention und Handlung gleicherweise vorhanden sein:
9.
Manchmal liegt indes der Schwerpunkt mehr in der Intention als im Handeln, oder aber mehr im Handeln als in der Intention. Einen solchen Unterschied gewahren wir im Evangelium zwischen Maria und Martha. Die eine lauschte dem Worte, die andere hatte es eilig mit der Bedienung. Da hielt letztere inne und sprach: „Herr, kümmert es Dich nicht, daß sie mich allein bei der Bedienung ließ? Sage ihr also, daß sie mir helfe!" Und er antwortete ihr: „Martha, Martha, Maria hat den besten Teil erwählt, der ihr nicht genommen werden wird"78. Die eine also gab sich eifrig intensivem Lauschen, die andere übereifrig dienstgefälligem Handeln hin. Gleichwohl waren beide auf beide Tugendfunktionen hinlänglich bedacht. So hätte doch gewiß einerseits Martha, wenn sie dem Worte nicht gelauscht hätte, nimmer sich seinem Dienste unterzogen, einem Handeln, das die Intention verrät. Andererseits lernte Maria aus der vollkommenen Übung beider Tugendfunktionen soviel Gefälligkeit, daß sie die Füße Jesu salbte, mit ihren Haaren trocknete und das ganze Haus mit dem Wohlgeruche ihres Glaubens erfüllte79. Manchmal auch ist die Strebsamkeit (intentio) sehr groß, das Handeln unfruchtbar: so wenn jemand sein Interesse der Arzneikunde zuwendet, dieselbe aber nicht beruflich ausübt, wiewohl er alle ärztlichen Kenntnisse besitzt. So kommt es dann, daß, weil unfruchtbar sein Handeln, auch unfruchtbar sein Streben bleibt. Manche auch entfalten dann und wann ein rühriges Handeln, aber zu geringe Strebsamkeit: so wenn jemand das Geheimnis der heilbringenden Taufe empfängt und der notwendigen Kenntnis der verschiedenen Tugendvorschriften kein Interesse zuwenden wollte. So kommt es vielfach, daß er wegen lässiger Strebsamkeit der Frucht des Handelns verlustig geht. Daher die Notwendigkeit, die Vollkommenheit beider Tugendfunktionen anzustreben, wie sie die Apostel zu erlangen vermochten, von denen es heißt: „welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind". Daß sie Augenzeugen waren, offenbart ihr Streben nach der göttlichen Erkenntnis; daß sie Diener waren, ihr Handeln.
10.
[Forts. ] * „So hat es gefallen"*80. Es kann nicht ihm allein nur gefallen haben, wenn er erklärt „es habe ihm gefallen". Denn nicht kraft menschlichen Willens allein81 hat es ihm gefallen, sondern wie es dem gefiel, „der in mir redet, Christus"82, der bewirkt, daß das, was gut ist, auch uns als gut erscheinen kann. Denn wessen er sich erbarmt, den ruft er auch83. Darum kann, wer Christus folgt, auf die Frage, warum er Christ werden wollte, antworten: „Es hat mir gefallen". Wenn er so spricht, leugnet er nicht, daß es Gott gefallen hat; denn „von Gott wird der Wille der Menschen bereitet"84. Gottes Gnade ist es, wenn Gott von einem Heiligen verherrlicht wird. So wollten denn gar viele ein Evangelium schreiben, aber nur vier, die des göttlichen Gnadenbeistandes gewürdigt wurden, fanden Aufnahme.
11.
„So hat es auch mir gefallen, nachdem ich über alles von Anfang an genaue Kunde eingeholt habe der Reihenfolge nach"85. Daß unser Evangelium sorgfältiger berichtet als die übrigen, dürfte niemand bezweifeln. Darum sind es nicht falsche, sondern wahre Dinge, die es zum Gegenstand seiner Darstellung hat. Auch vom heiligen Paulus wurde ihm denn auch das verdiente Zeugnis der Sorgfältigkeit ausgestellt: „Der wegen seines Evangeliums bei allen Gemeinden Lob findet"86, versichert er. Fürwahr der muß Lob verdienen, der von dem großen Völkerlehrer des Lobes gewürdigt ward87. ― Nicht über weniges, sondern über alles, wie er versichert, holte er Kunde ein. Und nachdem er Kunde eingeholt, hat es ihm gefallen ― nicht alles, sondern aus allem niederzuschreiben; denn nicht ‚geschrieben' hat er alles, sondern „Kunde hat er eingezogen" über alles. „Wollte man nämlich, so heißt es, alles aufschreiben, was Jesus getan, würde, wie ich glaube, die ganze Welt es nicht fassen"88. Man merkt auch, wie er selbst solches, was von anderen aufgezeichnet wurde, absichtlich übergangen hat. So bricht sich denn die Gnade im Evangelium in mannigfachem Lichte, und zeichnet jedes Buch durch Sondergut an wunderbaren Geheimnissen und Geschehnissen sich aus; denn es teilten sich die Streiter Christi in seine Kleider89. Eine erschöpfendere Erklärung über letztere Stelle wird an seinem Platz gegeben werden90.
12.
[Forts. ] Adressiert aber ist das Evangelium an Theophilus, d. i. den Gottgeliebten. Wenn du Gott liebst, ist es an dich geschrieben; wenn es an dich geschrieben ist, nimm das Geschenk des Evangelisten hin! Bewahre des Freundes Pfand im Inneren des Herzens! „Bewahre die schöne Hinterlage durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist"91, betrachte sie häufig, erwäge sie oftmals! Treue gebührt vor allem dem Pfande; der Treue folgt Sorgfalt, daß nicht Motte oder Rost die dir anvertrauten Pfänder verzehre92; denn verzehrbar ist, was dir anvertraut ist. Das Evangelium ist ein schönes Pfand, doch sieh zu, daß nicht in deinem Herzen Motte oder Rost es verzehren! Mottenfraß ist’s, wenn du der guten Lektüre schlechten Glauben schenkst.
13.
Eine Motte ist der Häretiker, eine Motte Photinus, eine Motte für dich Arius. Es zernagt das Kleid (der Gottheit), wer das Wort von Gott trennt. Es zernagt das Kleid Photinus, da er liest: „Im Anfange war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war"; denn unversehrt bleibt das Kleid, wenn du liest: „Und Gott war das Wort"93. Es zernagt das Kleid, wer Christus von Gott trennt. Es zernagt das Kleid, wer liest: „Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich erkennen, den alleinigen wahren Gott"94, wenn er nicht auch Christus erkennt. Denn nicht allein den Vater wahrhaft als Gott erkennen, ist ewiges Leben, sondern auch Christus als wahren Gott erkennen, als den Wahren vom Wahren, als Gott von Gott, ist unsterbliches Leben. Mottenfraß ist’s, Christus erkennen zu wollen ohne den Glauben an seine Gottheit oder ohne das Geheimnis seiner Menschheit. Eine Motte ist Arius, eine Motte ist Sabellius. Diese Motten duldet nur der Geist der Glaubensschwachen. Diese Motten duldet nur der Geist, der nicht glaubt, daß der Vater und der Sohn eins sind in der Gottheit. Das Schriftwort: „Ich und der Vater sind eins"95 zernagt, wer das „eins" durch die Annahme verschiedener Wesenheiten teilt. Diese Motte duldet nur der Geist, der nicht glaubt,„daß Christus im Fleische gekommen ist"96: und er selbst ist eine Motte; denn er ist ein Antichrist97. Die aber aus Gott sind, halten am Glauben fest und können darum die Motte nicht dulden, die das Kleid zerteilt. Denn alles, was unter sich geteilt ist, wie des Satans Reich, kann nicht ewig sein98.
14.
Es gibt auch einen Rost der Seele, wenn der scharfe Stahl des religiösen Eifers von der Kruste weltlicher Begierden belegt oder des Glaubens Reinheit von der Dunstschicht des Unglaubens getrübt wird. Ein Rost des Geistes ist die Begierde nach Hab und Gut; ein Rost des Geistes ist die Lauheit; ein Rost des Geistes ist ein Streben nach Würden, wenn man hierin das höchste Hoffnungsideal des gegenwärtigen Lebens setzt. Darum laßt uns, dem Göttlichen zugewendet, den Geist schärfen, die Begeisterung entflammen, daß wir jenes Schwert, das der Herr um den Erlös des Rockes zu kaufen heißt99, stets bereit und blank gleichsam in der Scheide des Geistes verwahrt zu halten vermögen! Denn die geistigen, tapfer „für Gott (kämpfenden) Waffen zur Zerstörung von Bollwerken“ 100 müssen den Streitern Christi stets zur Hand sein, damit nicht der Führer der himmlischen Heerschar101 bei seiner Ankunft über den Zustand unserer Waffen aufgebracht wird und uns vom Verband seiner Legionen ausschließt.