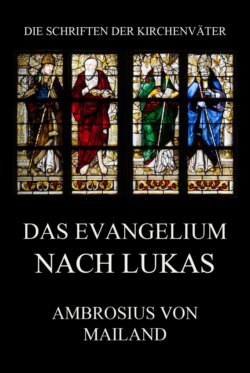Читать книгу Das Evangelium nach Lukas - Ambrosius von Mailand - Страница 7
2. Zacharias und Elisabeth; des Zacharias Opfer und Engelserscheinung, Luk. 1, 5―12
Оглавление
Eltern und Ahnen der Stolz der Kinder. Die Ruhmestitel und der religiöse Erbadel des Täufers (15 f.). Die Möglichkeit eines sündelosen Lebenswandels nach Taufe und Bekehrung (17). Das „Gerechtsein vor Gott“: Gott urteilt nach der inneren Absicht, nicht nach dem äußeren Erfolg (18—20). Des Täufers Lob bei Lukas ein ,volles Lob' (21). Zacharias anscheinend ein Hoherpriester. Der durch das Los erkorene, wechselnde Hohepriester im Alten Bunde Typus des ewigen Hohenpriesters Christus im Neuen Bunde (22—23). Der biblische Begriff ‚erscheinen'. Theophanien, Engelserscheinungen. Vorbedingungen des Schauens Gottes und der Engel (24―27). Die ,Rechte' Metapher für Huld und Hilfe Gottes (28).
15.
[Forts. ] * „Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Reihe Abias; und sein Weib war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Beide waren gerecht und wandelten in allen Geboten und Urteilen des Herrn untadelig"102.*
Es lehrt uns die Göttliche Schrift, daß bei Männern, die des Ruhmes würdig sind, nicht bloß dem sittlichen Wandel, sondern auch den Eltern Lob gebührt: wie ein überkommenes Erbe leuchtet an denen, welchen unser Lob gilt, der Vorzug makelloser Lauterkeit hervor. Was anders auch bezweckt der heilige Evangelist an unserer Stelle als den Ruhm aufzuzeigen, in welchem Eltern, Wunder, Wandel, Beruf und Leidenstod den heiligen Johannes erstrahlen lassen? So erfährt auch des heiligen Samuel Mutter Anna Lob103; so erbte Isaak von den Eltern den Adel der Frömmigkeit, den er auf die Nachkommen fortpflanzte. So war denn Zacharias „Priester", nicht bloß Priester, sondern auch „aus der Reihe Abias", d. i. eines Edlen von Geburt unter den Altvordern104.
16.
[Forts. ] „Und sein Weib war von den Töchtern Aarons." Also nicht bloß von den Eltern, sondern auch von den Altvordern leitet sich der Adel des heiligen Johannes her: nicht von weltlicher Machthoheit strahlend, sondern ehrwürdig als religiöser Erbadel. Solche Vorfahren nämlich waren dem Vorboten Christi vonnöten, damit es offenbar würde, daß er den Glauben an die Ankunft des Herrn, den er verkündete, nicht von ungefähr angenommen, sondern von den Vorfahren überkommen und gleichsam von Natur eingepflanzt erhielt.
17.
„Es waren beide gerecht und wandelten in allen Geboten und Urteilen des Herrn untadelig." Was sagen hierzu jene, die als Schild über ihre Sünden den Trostgedanken halten105, es könne der Mensch nicht ohne häufiges Sündigen leben, und hierfür auf den Schriftvers im Buche Job sich beziehen: „Niemand ist rein von Makel, und selbst wenn sein Leben nur einen Tag dauerte; eine große Zahl von Monden auf Erden hängt von ihm (Gott) ab"106. Diesen nun ist zunächst entgegenzuhalten, sie mögen genau den Sinn der Worte angeben: „der Mensch sei ohne Sünde"; heißt das: er habe überhaupt niemals gesündigt, oder: er habe zu sündigen aufgehört? Halten sie nämlich das „ohne Sünde sein" gleichbedeutend mit ‚aufgehört haben zu sündigen', bin auch ich einverstanden ― „denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes"107 ― leugnen sie aber, daß derjenige von Verfehlungen sich freihalten könne, welcher die frühere Verirrung gut gemacht und zu einer Lebensweise sich durchgerungen hat, die ihm die Meidung der Sünde ermöglicht, kann ich ihrer Ansicht nicht beipflichten, weil wir lesen: „So hat der Herr die Kirche geliebt, daß er selbst sich dieselbe herrlich darstellte, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, daß sie vielmehr heilig und fleckenlos sei"108. Da nämlich die Kirche aus Heiden, d. i. aus Sündern gesammelt ward, wie könnte sie aus Sündebefleckten fleckenlos sein, wenn nicht in erster Linie auf Grund der Gnade Gottes, weil von Schuld rein gewaschen; sodann auf Grund der Enthaltsamkeit von weiterer Schuld kraft der Fähigkeit zum Nichtsündigen? Also nicht von Anfang war sie makellos ― das ist der menschlichen Natur unmöglich ― ihre Makellosigkeit erklärt sich vielmehr aus der Gnade Gottes und der eigenen Fähigkeit, nicht mehr zu sündigen.
18.
Nicht umsonst nannte sie (der Evangelist) „gerecht vor Gott109, wandelnd in den Geboten und Urteilen des Herrn". Er redet also hier vom allmächtigen Vater und dem Sohne. Daß der Sohn es ist, der das Gesetz gegeben, die Gebote vorgeschrieben, erklärt hiermit auch der heilige Evangelist. Und zutreffend heißt es: „gerecht vor Gott". Denn nicht jeder, der vor dem Menschen gerecht ist, ist auch vor Gott gerecht. Anders sehen die Menschen, anders Gott: die Menschen ins Gesicht, Gott ins Herz. Und so kann es geschehen, daß mir einer, der sich vor den Leuten als gut ausgibt, als gerecht erscheint, aber nicht gerecht vor Gott ist, wenn seine Gerechtigkeit nicht der Ausdruck der unverfälschten Gesinnung wäre, sondern auf heuchlerischer Verstellung beruhte; denn das Verborgene in ihr vermag der Mensch nicht zu schauen. Das vollkommene Lob liegt darum im „Gerechtsein vor Gott". Daher auch des Apostels Beteuerung: „(Das ist ein Jude,) dessen Lob nicht aus Menschen, sondern aus Gottes Mund kommt"110. Selig fürwahr, wer in den Augen Gottes gerecht ist! Selig, wen der Herr des Wortes würdigt: „Sieh, ein wahrer Israelite, in welchem kein Falsch ist!"111 Ein wahrer Israelite nämlich ist, wer Gott schaut und weiß, daß er von Gott geschaut wird, und ihm das Verborgene des Herzens aufdeckt112. Denn nur der ist ein vollkommener Mensch, der von jenem erprobt erscheint, der nicht getäuscht werden kann. Denn „die Urteile des Herrn sind wahr"113, die Urteile der Menschen aber beruhen oft auf Täuschung, so daß sie häufig ebenso Ungerechten den Vorzug der Gerechtigkeit zuschreiben, wie sie den Gerechten mit Haß verfolgen oder mit Lüge anschwärzen. „Der Herr aber kennt die Wege der Makellosen"114 und hält den, der Lob verdient, nicht für einen Sünder und den Sünder nicht für des Lobes würdig, sondern (beurteilt) jeden nach Maßgabe der in Frage kommenden Verdienste; denn er ist Zeuge des Denkens und Handelns zugleich. Gottes Urteile bemessen das Verdienst des Gerechten nach der Beschaffenheit seiner Absicht, keinesfalls nach dem Ausgang seines Handelns. Vielfach wird ja eine gute Absicht durch den Ausgang einer anfechtbaren Handlung verkannt oder aber ein ruchloser Gedankenanschlag durch eine glänzende äußere Tat verschleiert. Doch selbst dein gutes Tun kann, wenn dein Denken böse ist, durch Gottes Urteil nicht gebilligt werden; denn es steht geschrieben: „Was recht ist, dem sollst du auf rechte Weise nachtrachten"115. Bestände nicht die Möglichkeit, Rechtes auf unrechte Weise zu tun, würde niemals gesprochen worden sein: „Was recht ist, dem sollst du auf rechte Weise nachtrachten". Daß sicher Rechtes auch auf unrechte Weise geschehen kann, hat uns der Erlöser selbst mit der Mahnung gelehrt: „Wenn du Almosen gibst, so posaune nicht vor dir her, und wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler!"116. Etwas Gutes ist die Mildtätigkeit, etwas Gutes das Gebet, aber es kann auf unrechte Weise geschehen, wenn man etwa einem Armen aus Prahlerei geben wollte, um von den Leuten gesehen zu werden.
19.
[Forts. ] Der heilige Evangelist sagt darum nicht bloß: „gerecht vor Gott und wandelnd in allen Geboten und Urteilen des Herrn", sondern auch: „untadelig" wandelnd. Das stimmt wunderbar zum prophetischen Wort, das der heilige Salomo in den Sprüchen gebrauchte, indem er mahnte: „Faß ins Auge stets das Gute vor Gott und den Menschen!"117 Keinen Tadel also gibt es, wo gutes Denken gutem Tun entspricht, und gar oft fordert nur die Härte der Gerechtigkeit der Leute Tadel heraus.
20.
[Forts. ] Beachte aber auch genau, wie zutreffend die Wahl und wie folgerichtig die Anordnung der Ausdrücke ist! „Wandelnd in den Geboten und Urteilen des Herrn": Das erste ist das Gebot, das zweite das Urteil. Folgen wir sonach den himmlischen Geboten, wandeln wir in den Geboten des Herrn; urteilen wir und urteilen wir sachgemäß, so halten wir uns offenbar an die Urteile des Herrn.
21.
[Forts. ] Es liegt sonach ein erschöpfendes Lob ausgesprochen, das Geschlecht, Wandel, Amt, Handeln und Urteilen umfaßt: das Geschlecht der Ahnen, den Wandel in Gerechtigkeit, das Amt im Priestertum, das Handeln nach dem Gebote, ein Urteilen nach gerechtem Maßstab.
22.
„Es geschah aber, da Zacharias nach der Ordnung seiner Reihe vor Gott dem Herrn den Priesterdienst nach der Sitte des Priestertums versah, kam er durch das Los daran, in den Tempel des Herrn zu treten und die Räucherung vorzunehmen. Und das ganze Volk betete draußen zur Stunde des Rauchwerkes"118.
Es scheint, daß Zacharias hier als Hoherpriester bezeichnet wird, weil er nur einmal im Jahre den Tempel betrat. Vom vorderen Gezelte nämlich steht zu lesen, daß die Priester, welche die Dienste verrichteten, es jederzeit betreten durften, in das hintere Gezelt aber ging nur einmal im Jahre der Hohepriester allein, nicht ohne das Blut, „das er für sich und des Volkes Sünden darbringt"119. Jener Hohepriester ist hier gemeint, der noch durch das Los erkoren wird, weil man den wahren noch nicht kennt; denn wen das Los kürt, das entzieht sich menschlicher Einsicht. Jener (wahre) nun ward gesucht, jener andere vorgebildet: jener wahre Priester in Ewigkeit ward gesucht, dem das Wort gegolten: „Du bist Priester in Ewigkeit"120; der nicht mit dem Blute der Opfertiere, sondern mit seinem eigenen Blute Gott den Vater versöhnte. Damals hingegen war es nur ein vorbildliches Blutvergießen, eine vorbildliche Priesterweihe; jetzt, da die Wahrheit erschienen, laßt uns das Vorbildliche verlassen, der Wahrheit folgen! Und zwar gab es damals steten Wechsel, jetzt aber stetige Fortdauer. So war denn und war sicher bereits derjenige (typisch) da, dessen Dienst auch abwechselnd versehen wurde121.
23.
„Durch das Los" wurde (Zacharias) erlesen, in den Tempel einzutreten. Wenn nun im vorbildlichen Ritus niemand als Zeuge beigezogen werden konnte, was anders wurde hierdurch versinnbildet als die Ankunft jenes Priesters, dessen Opfer nichts gemein hätte mit den übrigen; der sein Opfer nicht in den von Menschenhand erbauten Tempeln122 für uns darbrächte, sondern im Tempel des eigenen Leibes unsere Sünden zunichte machen würde. ― „Durch das Los" wurde der Priester ausgesucht. Vielleicht warfen auch die Soldaten nur deshalb das Los um die Kleider des Herrn123, damit das Loswerfen auch am Herrn, da er sich anschickte, in seinem Tempel für uns das Opfer darzubringen, die Gesetzesvorschrift zur Erfüllung brächte. Daher seine Versicherung: „Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen"124. Er gerade sollte hierdurch als der im Alten Testamente Erwartete und durch Gottes Willen Erkorene erscheinen. So fiel auch über den Apostel Matthias das Los125, daß nicht die Apostelwahl von der alttestamentlichen Gesetzesvorschrift abzuweichen schiene.
24.
„Da erschien ihm ein Engel zur Rechten des Rauchaltares stehend"126. Nicht umsonst tritt ein sichtbarer Engel im Tempel auf; denn schon wurde die Ankunft des wahren Priesters verkündet und das himmlische Opfer zubereitet, bei dem die Engel dienen sollten. Und zutreffend heißt es, er sei dem, der seiner plötzlich gewahr wurde, „erschienen". Diesen Ausdruck pflegt die Göttliche Schrift speziell sei es von den Engeln sei es von Gott zu gebrauchen, so daß mit ‚erscheinen' ein unvorhergesehenes Eintreten derselben bezeichnet wird. Denn so liest man: „Es erschien Gott dem Abraham bei der Steineiche Mambre"127. Man sagt eben von einem, den man vorher nicht merkt, sondern plötzlich vor Augen sieht, er erscheine. Nicht gleicherweise nämlich treten sinnenfällige Gegenstände und tritt derjenige in die Sichtbarkeit, in dessen Willen das Sichtbarwerden gelegen ist. Zu seiner Natur gehört das Unsichtbarsein, das Sichtbarwerden hängt von seinem Willen ab: will er nicht, bleibt er unsichtbar, will er, wird er sichtbar. So erschien Gott dem Abraham, weil er wollte. Einem anderen erschien er nicht, weil er nicht wollte. Auch dem Stephanus, da er vom Volk gesteinigt wurde, erschien der Himmel offen; auch erschien (ihm) Jesus zur Rechten Gottes stehend128, während er dem Volke nicht erschien. Es schaute Isaias den Herrn der Heerscharen129, ein anderer indes vermochte ihn nicht zu schauen, weil er eben dem erschien, welchem er wollte.
25.
[Forts. ] Doch was sprechen wir von den Menschen, nachdem wir selbst von den himmlischen Kräften und Gewalten lesen, „daß niemand Gott je gesehen hat"?130 Und der Evangelist fügte bei, was über die himmlischen Gewalten hinausweist: „Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, er hat es uns kund getan"131. Wenn also „niemand Gott den Vater je gesehen hat", so hat man sich entweder mit der Annahme zu bescheiden, daß im Alten Bunde nur der Sohn erschienen sei, und es mögen dann die Irrlehrer abstehen, ihm, der bereits sichtbar war, bevor er aus der Jungfrau geboren wurde, den Ursprung aus der Jungfrau zu geben; oder es kann sicherlich auch die Annahme nicht als irrig zurückgewiesen werden, der Vater oder der Sohn oder gewiß auch der Heilige Geist ― wenn es sonst eine Erscheinung des Heiligen Geistes gibt: nämlich auch vom Geiste hören wir, er sei in Form einer Taube erschienen132 ― werde nur in einer Gestalt sichtbar, wie sie der Wille wählt, nicht die Natur ausformt. Darum nun „hat niemand Gott je gesehen", weil niemand jene Fülle der Gottheit, die in Gott wohnt133, schaute, niemand mit dem geistigen oder leiblichen Auge sie ergründete134. „Hat gesehen" ist nämlich auf beides zu beziehen; erst mit dem Zusatz: „der eingeborene Sohn. . ., er hat es kund getan" wird es mehr als ein geistiges denn leibliches Schauen erklärt. Eine Gestalt wird sichtbar, eine Kraft kund; ersterer wird man mit den Augen, letzterer mit dem Geiste gewahr.
26.
Doch was brauche ich von der Trinität sprechen? Auch der Seraph erschien, wann er wollte, und Isaias allein vernahm seine Stimme135. Eben erscheint ein Engel und ist jetzt da, doch man sieht ihn nicht; denn das Sehen liegt nicht in unserer Gewalt, wohl aber in seiner Gewalt das Erscheinen. Doch mag es an der Fähigkeit des Schauens fehlen, die Gnade, sich die Fähigkeit hierzu zu verdienen, ist da. Wer also die Gnade besitzt, verdient sich die Möglichkeit hierzu. Wir verdienen uns die Möglichkeit nicht, weil wir die Gnade des Gottschauens nicht besitzen.
27.
Was Wunder auch, wenn der Herr in dieser Welt nur dann erscheint, wenn er will? Selbst bei der Auferstehung ist ein Gottschauen nur denen möglich, die reinen Herzens sind: darum „selig, die reinen Herzens sind; denn sie nur werden Gott schauen"136. Wie viele hatte der Herr bereits selig gepriesen, ohne ihnen jedoch die Fähigkeit des Gottschauens zu verheißen! Wenn demnach nur die, welche reinen Herzens sind, Gott schauen werden, dann werden eben andere (ihn) nicht schauen. Denn nicht Unwürdige werden Gott schauen, noch vermag derjenige Gott zu schauen, der ihn nicht schauen wollte. Auch nicht örtlich, sondern mit reinem Herzen läßt Gott sich schauen, nicht mit leiblichen Augen läßt Gott sich suchen, nicht mit dem Blick sich messen, nicht mit tastender Hand sich greifen, nicht in Tönen sich vernehmlich, nicht mit Schritten sich merklich machen. Glaubt man ihn fern, schaut man ihn; ist er zugegen, schaut man ihn nicht. Schauten doch selbst die Apostel nicht alle Christus. Daher seine Klage: „Solange bin ich bei euch, und ihr habt mich noch nicht erkannt"137. Nur wer erkannt hat, „welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei" und „die alles übersteigende Liebe Christi"138, „schaut Christus, schaut auch den Vater"139. Wir kennen ja Christus nicht mehr dem Fleische140, sondern nur dem Geiste nach; „denn Geist ist vor unserem Angesichte Christus der Herr"141, der uns in seiner Barmherzigkeit „bis zur ganzen Fülle der Gottheit zu erfüllen"142 sich würdigt, auf daß er von uns geschaut werden könne. ― Es ‚erschien' also dem Zacharias ein Engel zur Rechten des Rauchaltares, weil er erschien, wann er wollte, und nicht erschien, wann er nicht wollte.
28.
[Forts. ] Er erschien aber „zur Rechten" des Rauchaltares, weil er einen einzigartigen Erweis des göttlichen Erbarmens zu überbringen hatte; „denn der Herr steht mir zur Rechten, daß ich nicht wanke"143; und an einer anderen Stelle: „Der Herr ist dein Schirm über der Hand deiner Rechten"144. O daß auch uns bei der Beräucherung des Altares, bei der Darbringung des Opfers der Engel zur Seite stünde, ja sichtbar erschiene! Denn zweifle nicht an der Gegenwart des Engels, wenn Christus zugegen ist, Christus geopfert wird! „Denn unser Osterlamm ist geopfert, Christus"145. Auch fürchte nicht, es möchte dein Herz durch die Erscheinung des Engels verwirrt werden ― wir geraten nämlich in Verwirrung und von Sinnen, wenn wir von der Erscheinung einer höheren Gewalt überrascht werden ―; denn der nämliche Engel, der uns erschiene, würde uns auch stärken können, wie er den anfänglich verwirrten Zacharias ermutigte und stärkte, indem er ihn beschwichtigte: