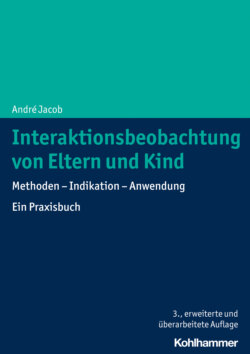Читать книгу Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind - André Jacob - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4 Verfahrensübersicht in Steckbriefen
Im folgenden Kapitel wird nun anhand eines verfahrensbezogenen »Steckbriefs« versucht, wesentliche interaktionsdiagnostische Verfahren zu beschreiben. Dieser Steckbrief soll neben den gängigen Beschreibungsmerkmalen auch Aussagen enthalten zur inhaltlichen Orientierung in Anlehnung an die w. o. vorgestellten funktional-inhaltlichen Kategorien sowie zur Praktikabilität des Verfahrens. Interaktionsdiagnostische Instrumente, die deutschsprachigen Fachkräften nicht ohne Weiteres zugänglich sind, die für einen fachlich sehr eng umgrenzten Einsatz konstruiert wurden oder deren Verwendbarkeit fachlich überholt scheint, folgen im Anschluss in einer Art »Kurzstreckbrief«. Der Umfang der dargestellten Verfahren erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und gibt im Wesentlichen auch nur die mehr oder weniger begründete Meinung des Autors wieder. Zum Ende des Kapitels werden einige Schlussfolgerungen gezogen, die sich auf die Auswahl von Verfahren für die eigene Praxis beziehen sowie die hauptsächlich verwendeten Kategorien und Dimensionen im Überblick zusammengefasst.
4.1 Ausführliche Steckbriefe (in alphabetischer Reihenfolge der Kurztitel)
Tab. 4.1: Beavers Interaktionsskalen
Tab. 4.2: Bonner Modell zur Interaktionsanalyse
Tab. 4.3: CARE-Index
Tab. 4.4: Eltern-Kind-Interaktionsprofil
Tab. 4.5: Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den Signalen des Kindes
Tab. 4.6: Heidelberger Marschak Interaktionsmethode
Tab. 4.7: INTAKT
Tab. 4.8: Lausanner Trilogspiel (mit Family Alliance Assessment Scale)
Tab. 4.9: Mannheimer Beurteilungsskala zur Erfassung der Mutter-Kind-Interaktion im Säuglingsalter
Tab. 4.10: Münchner klinische Kommunikationsskala
Tab. 4.11: Spielfeinfühligkeit (SCIP: Sensitive Challenging Interactive Play)
Die Video-Interventions-Therapie von George Downing (2010) ist im engeren Sinne kein ausschließlich für die Diagnostik zu verwendendes Verfahren. Dennoch sollen die veröffentlichten Beurteilungskategorien hier aufgrund ihrer heuristischen Potenz vorgestellt werden.
Tab. 4.12: Video-Interventions-Therapie
4.2 Kurz gefasste Steckbriefe10
In diesem Abschnitt werden Beurteilungsverfahren vorgestellt, die für die deutschsprachigen Praktikerinnen und Praktiker eher kompliziert einzusetzen sind – entweder, weil sie bisher nicht in die deutsche Sprache übersetzt worden sind, weil sie sich als schwierig verfügbar bzw. anwendbar erwiesen haben oder aber, weil sie fachlich und methodisch zu spezifisch oder überholt scheinen.
Tab. 4.13: Maternal Behavior Rating Scale
Tab. 4.14: DC:0-5. Diagnostische Klassifikation seelischer Gesundheit und Entwicklungsstörungen der frühen Kindheit (vormals: Zero to Three: Diagnostische Klassifikation 0–3)
Tab. 4.15: Bethlem Mother-Infant Interaction Scale
Tab. 4.16: Parental-Child-Relationship-Inventory
Tab. 4.17: Kategoriensystem zur Beschreibung familialer Interaktion
Tab. 4.18: Systematische Interaktionsbeurteilung
Tab. 4.19: Practice Parameter of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
Tab. 4.20: Emotional Availability Scale
Tab. 4.21: Feeding Scale
Tab. 4.22: Auswertungsmanual zur dyadischen Mutter-Kind-Interaktion: Umgang mit kindlichen Gefühlen in einer Distress-induzierten Situation
Tab. 4.23: NCAST Caregiver/Parent-Child Interaction Feeding/Teaching Manual
4.3 Schlussfolgerungen
4.3.1 Verfahrensbeurteilung
Zur leichteren Orientierung bei der Verfahrensauswahl in der Praxis wurden drei Beurteilungskriterien zusammengestellt, die der folgenden Tabelle entnommen werden können:
Tab. 4.24: Beurteilungskriterien
Bezieht man diese Beurteilungskriterien und ihre Ausprägungen auf die interaktionsdiagnostischen Verfahren, die eher einen »Breitbandcharakter« aufweisen und die in einem ausführlichen Steckbrief vorgestellt wurden, so lässt sich trotz der erwähnten Einschränkungen und mit größter Vorsicht beim Versuch, die Bewertungen zu generalisieren, eine gewisse Rangfolge in Bezug auf die inhaltliche Verwendbarkeit und die Praktikabilität abbilden. Folgende Übersicht listet die Bewertungsergebnisse auf:
Tab. 4.25: Verfahrensbeurteilungen
Eine relativ hohe Bewertung erhalten damit das Eltern-Kind-Interaktionsprofil (EKIP), der CARE-Index, die Mannheimer Beurteilungsskalen (MBS-MKI), die Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode (H-MIM), die Münchner klinische Kommunikationsskala (MKK), das Bonner Modell zur Interaktionsanalyse (BMIA) sowie das Lausanner Trilogspiel (mit FAAS).
Die Verwendbarkeit dieser Instrumente wird in den Kap. 6 und 7 anhand unterschiedlicher Fragestellungen diskutiert.
4.3.2 Synoptische Betrachtung der Beurteilungskategorien
In einer ersten Version soll hier – einem Vorschlag von Westhoff, Terlinden-Arzt und Klüber (2013) folgend – der Versuch unternommen werden, sog. »Konstruktfacetten« zusammenzutragen und diesen – soweit möglich – Indikatoren zuzuordnen. Die Facetten sind qualitativ bestimmte, »regelgeleitete Operationalisierungen« eines Konstrukts (ebd., S. 202). Dieser Begriff löst die bisher im Text verwendeten Begriffe »Kategorie«, »Dimension« und »Bereich« ab. Die folgende Tab. 4.26 zeigt – stark verkürzt – diesen Ansatz.
Tab. 4.26: Facetten des Konstruktes »Eltern-Kind-Interaktion« in vier Perspektiven
Im Anhang ( Anlage 1) findet sich eine um Definitionen dieser Facetten und deren Indikatoren angereicherte Fassung dieser Übersicht, die sich auch als eine Art Checkliste für die Praxis oder als eine Forschungsvorform für weitere Untersuchungen verwenden ließe. Die w. o. vorgeschlagene Operationalisierung der Indikatoren nach den vier Bewertungsaspekten Quantität, Modus, Angemessenheit und Kontinuität nach Patry und Perrez (2003) findet in dieser Facetten-Indikatoren-Liste noch keinen systematischen Eingang, sondern bleibt späteren Entwicklungen vorbehalten.
10 Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Systematik in der Reihenfolge erhoben.
11 Ein Gesamturteil lediglich durch die Summierung der Beurteilungsnoten zu bilden, ist sicherlich hoch problematisch und sollte daher nur einer ersten Orientierung dienen.