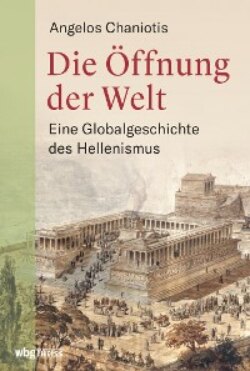Читать книгу Die Öffnung der Welt - Ангелос Ханиотис - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеAlexander der Makedone, Sohn Philipps, … bezwang Dareios, den König der Perser und Meder und wurde König an seiner statt … Er führte viele Kriege, eroberte Festungen und erschlug die Könige der Erde. Er zog bis ans Ende der Welt und plünderte eine Vielzahl von Völkern … Alexander regierte zwölf Jahre lang und starb. Seine Gefolgsleute übernahmen die Macht, jeder in seinem eigenen Gebiet. Und nach seinem Tod setzten sie sich alle die Königskrone auf, und viele Jahre lang hielten es ihre Kinder nach ihnen ebenso und sie vermehrten das Elend auf Erden.
Diesen Auszug aus dem 1. Buch der Makkabäer, einem hebräischen Text aus dem späten 2. Jahrhundert v. Chr., der in griechischer Übersetzung erhalten ist, kann man als subjektive Zusammenfassung der „hellenistischen“ Epoche lesen, also der Zeit zwischen den Kriegszügen Alexanders (334–324 v. Chr.) und dem Tod Kleopatras (30 v. Chr.). Die Erzählperspektive ist dabei die eines militanten Vertreters einer eroberten Provinz, die gegen griechische Könige und ihre hellenisierten jüdischen Unterstützer zu den Waffen griff.
Es gibt gute Gründe dafür, ein Buch über die Geschichte der Griechen in einem kosmopolitischen Zeitalter mit einem Zitat aus einem jüdischen Text zu beginnen: Denn erstens zeigt das, dass es verschiedene Perspektiven und abweichende Meinungen gab; zweitens ist es bemerkenswert, dass ein Buch, das die kulturelle und politische Vormachtstellung der Griechen infrage stellte, ausgerechnet auf Griechisch gewissermaßen als Lingua franca Verbreitung fand; und drittens verdankt die hellenistische Epoche ihren Namen den „Hellenisten“, einer jüdischen Gruppierung, die die griechische Lebensart übernahm. Das 1. Buch der Makkabäer spiegelt daher einige der Gegensätze und Widersprüche dieser Epoche wider.
Was ist das hellenistische Zeitalter? Warum erforschen wir es? Und ist es angemessen, seinen traditionellen Endpunkt im Jahr 30 v. Chr. nach hinten zu verlagern und noch die ersten 150 Jahre der Kaiserzeit hinzuzunehmen, beides gemeinsam als „langes hellenistisches Zeitalter“ zu erfassen? Als bedeutender Wendepunkt in der Geschichte des antiken Griechenland kann Einleitung der Tod Alexanders des Großen in der Tat als Anfangspunkt beibehalten werden. Die durch seine Nachfolger begründeten Dynastien sind vermutlich der sichtbarste und sicherlich der neuartigste Aspekt der Jahrzehnte nach seinem Tod. Ohne Zweifel vermehrten sie das Elend auf der Welt, vielleicht nicht jenes Elend, das der jüdische Autor des Makkabäerbuches im Sinn hatte – die religiöse und kulturelle Unterdrückung der Juden –, aber mit Sicherheit jenes, für das endlose Kriege, private und öffentliche Verschuldung und bürgerkriegsähnliche Unruhen ursächlich waren. Natürlich wäre es einseitig und falsch, das hellenistische Zeitalter lediglich als eine Zeit des Elends zu charakterisieren. Die Epoche ist weit mehr als nur die Summe der Kriege zwischen den Nachfolgern Alexanders, den von ihnen begründeten Dynastien, Rom, barbarischen Stämmen, fremdländischen Königen, Städten und Städtebünden. Welche Aspekte dieser drei Jahrhunderte sind es sonst noch wert, genauer unter die Lupe genommen zu werden?
In unserer Alltagssprache sagen wir, dass jemand einen kolossalen Irrtum begangen hat oder dass eine Person etwas stoisch erträgt. Wir sprechen manchmal von einem Pyrrhussieg, und im Urlaub an einem fremden Ort gehen wir möglicherweise in ein Museum. Manche hatten zu Schulzeiten ihre Freude an euklidischer Geometrie, andere hassten sie. Wenn wir unerwartet die Lösung eines Problems finden, rufen wir „Heureka!“ Und auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, wie sie funktionieren, sind hydraulische Pumpen und Zylinder aus unserem Leben nicht wegzudenken. Was die Begriffe kolossal, stoisch, Pyrrhussieg, Museum, euklidisch, heureka und hydraulisch verbindet, ist, dass sie ihren Ursprung in der hellenistischen Zeit haben. Die philosophische Schule der Stoiker wurde im späten 4. Jahrhundert v. Chr. gegründet. Pyrrhus war ein Kriegsherr des frühen 3. Jahrhunderts v. Chr. „Heureka!“ (Ich habe es gefunden!) rief angeblich Archimedes um 230 v. Chr., als er feststellte, dass das Volumen des Wassers, das er verdrängte, als er in eine Badewanne stieg, dem Volumen des Teils seines Körpers entsprach, der sich unter Wasser befand. Und Euklid war ein Mathematiker und Ingenieur, der im frühen 3. Jahrhundert v. Chr. unter Ptolemaios I. in Alexandria lebte, dem König, der das Mouseion, den „Schrein der Musen“, gründete, ein seinem Palast angeschlossenes Bildungszentrum. In diesem Mouseion setzte der Mathematiker und Ingenieur Ktesibios sein theoretisches Wissen über Wasserkraft in die Praxis um und erfand die erste Pfeifenorgel (hydraulis), die mit Wasserdruck funktionierte. Der Koloss war eine riesige Statue des Sonnengottes, die 280 v. Chr. im Hafen von Rhodos aufgestellt wurde und zusammen mit dem Pharos – dem monumentalen Leuchtturm von Alexandria – zu den Sieben Weltwundern gezählt wurde. Die Wirkmächtigkeit einer historischen Epoche lässt sich oft an den Wörtern und Ausdrücken bemessen, die sie der Nachwelt vermacht hat.
Wissenschaftliche, künstlerische, intellektuelle und kulturelle Errungenschaften wie die eben erwähnten sollten nicht aus ihrem Kontext gerissen betrachtet werden. Das Mouseion von Alexandria, die ihm angeschlossene Bibliothek und die unzähligen Beiträge der dort tätigen Gelehrten und Wissenschaftler existierten nur, weil Alexander die Stadt gegründet hatte und weil die Könige des hellenistischen Ägypten über immense Ressourcen geboten, die sie für die Weiterentwicklung des Wissens zur Verfügung stellten. Dass sich die kulturelle Führungsrolle von Athen in Griechenland nach Ägypten und Asien verlagerte, war Teil eines Prozesses, der damit begann, dass griechische Einwanderer in den neugegründeten Städten in den von Alexander eroberten Gebieten angesiedelt wurden. Der Koloss wurde anlässlich eines militärischen Sieges errichtet; der Pharos von Alexandria stand in enger Verbindung mit der gestiegenen Bedeutung des Schiffsverkehrs im östlichen Mittelmeer; die stoische Philosophie stand in einem andauernden dialektischen Verhältnis zu politischem Leben und gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Geschichte der sozialen Konflikte, Kriege, politischen Experimente und Innovationen in den Städten und Königreichen des hellenistischen Zeitalters ist für ein Verständnis von Kunst und Wissenschaft, Philosophie und Literatur, Technologie und Religion unverzichtbar. Es lassen sich also gute Gründe für eine Beschäftigung mit der hellenistischen Epoche anführen.
Die Kriegszüge Alexanders sind ein guter Anfangspunkt. Aber wo hören wir auf? Man definiert das Ende des hellenistischen Zeitalters herkömmlicherweise mit dem Selbstmord Kleopatras 30 v. Chr. und der Annektierung ihres ägyptischen Königreichs durch Rom. Das ist sicher ein bedeutender Wendepunkt der politischen Geschichte. Er markiert das Ende des letzten großen hellenistischen Königreichs und den Beginn des Prinzipats – einer Ausprägung monarchischer Herrschaft, die unter Augustus und seinen Nachfolgern Gestalt annahm. In der Gesellschafts-, Wirtschafts-, Religions- und Kulturgeschichte hingegen stellt das Jahr 30 v. Chr. keine Zäsur dar. Entwicklungen, die wir in hellenistischer Zeit beobachten können, setzten sich in den zwei Jahrhunderten nach Kleopatras Tod fort. Um diese umfassend verstehen zu können, müssen wir auch spätere Quellen miteinbeziehen. Umgekehrt können wir die politischen Institutionen, die gesellschaftlichen Strukturen, die wirtschaftliche Situation, die Kultur und Religion des griechisch-römischen Ostens der ersten beiden Jahrhunderte der Kaiserzeit nur verstehen, wenn wir auch deren hellenistische Wurzeln berücksichtigen. Die Zeitspanne von Alexanders Kriegszügen im Osten bis ungefähr zu den Regierungsjahren Marc Aurels (161–180 n. Chr.) sollte daher als eine zusammenhängende historische Epoche ins Auge gefasst werden – ich nenne sie das „lange hellenistische Zeitalter“. Innerhalb dieses Zeitraums von annähernd 500 Jahren lassen sich rückblickend verschiedene Phasen ausmachen – die Kapiteleinteilung dieses Buches spiegelt sie wider –, die Entwicklung war jedoch kontinuierlich.
Der ereignisgeschichtliche Teil des Buches endet mit dem Tod Hadrians im Jahr 138 n. Chr., obwohl sich die Situation in den griechischsprachigen Provinzen unter seinem Nachfolger Antoninus Pius nicht wesentlich änderte. Erst mit dem Beginn der Partherkriege unter Marc Aurel 161 n. Chr. setzte allmählich ein Wandel ein. Ich habe die Herrschaft Hadrians nicht deshalb als Endpunkt dieses Buches genommen, weil dieser Kaiser etwa einer breiteren Leserschaft vertrauter wäre als sein Nachfolger oder weil er die Grenzen des Römischen Reiches befestigte und so die große Offensive unter seinem Vorgänger Trajan zu Ende führte. Meine Wahl liegt darin begründet, dass die Einrichtung des Panhellenions – eines Ratsgremiums, in dem sich zumindest theoretisch alle Städte griechischen Ursprungs versammelten – gewissermaßen den Kreis schloss, der mit den Bemühungen Philipps II. von Makedonien und seines Sohnes Alexander, alle Griechen zu vereinen, seinen Anfang genommen hatte. Da die Frage der Einheit der Griechen eines der übergreifenden Themen dieses Buches ist, schien es mir angemessen, den Panhellenenbund Philipps und Alexanders und das Panhellenion Hadrians als Eckpunkte zu nehmen.
Alexander begann den Kriegszug gegen das Perserreich als Anführer einer griechischen Allianz mit dem erklärten Ziel, die griechischen Städte Kleinasiens von barbarischer Herrschaft zu befreien und die Zerstörung griechischer Heiligtümer durch die Perser im Jahr 480 v. Chr. zu rächen. Den Spartanern konnte er es nie verzeihen, dass sie sich der Allianz nicht anschlossen – womit sie Alexanders Anspruch vereitelten, einen Kriegszug aller Griechen anzuführen. Nach seinem ersten Sieg am Granikos sandte er eine Weihgabe für Athena nach Athen. Die kurze Weihinschrift erniedrigte den einzigen Feind, den Alexander nicht in direktem Kampf hatte besiegen können: „Alexander, Sohn Philipps, und die Griechen, außer den Lakedämoniern, von den Barbaren, die in Asien leben.“
Hadrian versuchte nicht, dort erfolgreich zu sein, wo Alexander versagt hatte; sein Panhellenion hatte mit der militärischen Allianz des Makedonen nichts gemein. Eben dieser Gegensatz zwischen zwei Formen griechischer Einheit – die eine gegen einen barbarischen Feind gerichtet, die andere eine Vereinigung innerhalb des administrativen Rahmens des Römischen Reiches – macht Hadrians Herrschaft zu einem geeigneten Endpunkt für dieses Buch. Viereinhalb Jahrhunderte nach Alexanders Kriegszug waren die griechischen Städte – und dieses Mal alle griechischen Städte – längst wieder einer imperialen Großmacht unterworfen: dem Römischen Reich. Alexanders Geburtsort Pella war eine römische Kolonie; Alexandria, die nach ihm benannte Stadt in Ägypten, war immer noch der wichtigste Hafen im Mittelmeer; es hatte aber seine Bedeutung als Zentrum politischer Macht verloren, die es den Großteil des 3. Jahrhunderts v. Chr. über innegehabt hatte. Auch wenn sich die politischen Machtverhältnisse radikal verändert hatten und beinahe alle Gebiete, in denen Griechen und griechischsprachige Bevölkerungsgruppen lebten, dem Römischen Reich einverleibt worden waren, hatte sich eines nicht geändert: Es gab noch immer eine griechische Identität, die die Hellenen von den anderen unterschied. Es ist daher angebracht, für die Zeit der Römerherrschaft eine eigenständige griechische Geschichte zu schreiben, ebenso wie wir die Geschichte der Juden, Germanen, Iberer, Briten oder jedes anderen unterworfenen Volkes untersuchen können. Diese „griechische Identität“ war zugegebenermaßen wandelbar. Da war es sogar möglich, dass gewitzte griechische Schriftsteller die Römer zu Abkömmlingen eines griechischen Stammes erklärten, wenn es ihnen half, mit der römischen Herrschaft ins Reine zu kommen; und eine hellenisierte Stadt in Kleinasien konnte dem Panhellenion beitreten, indem man Belege dafür erfand, dass sie von einem griechischen Heros oder Kolonisten gegründet worden war. So gut wie jede Person, die eine griechische Bildung vorweisen konnte und aus einer Stadt tatsächlichen oder erfundenen griechischen Ursprungs stammte, konnte als Grieche durchgehen, ganz egal, ob ihr Name griechisch, thrakisch, iranisch oder römisch war.
Intellektuelle in Athen, Ephesos und Alexandria mögen vielleicht verächtlich auf die hellenisierte Bevölkerung Asiens oder des Balkans herabgeblickt haben, in der kosmopolitischen Welt des Römischen Reiches mit seinen weitreichenden politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und religiösen Netzwerken kann eine „Geschichte der Griechen“ jedoch nicht auf die Gebiete beschränkt bleiben, in denen es bereits vor Alexanders Kriegszügen griechische Städte und Kolonien gegeben hatte; sie muss auch Einleitung die Gegenden berücksichtigen, in denen unter Alexanders Herrschaft und in den Königreichen seiner Nachfolger Griechen siedelten. Dementsprechend ist meine Herangehensweise an die Geschichte der Griechen von Alexander bis Hadrian gewissermaßen „geographisch inklusiv“. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Gebieten, die in unseren Quellen am besten dokumentiert sind und die höchste Konzentration griechischer Siedlungen aufwiesen: Griechenland, die Ägäis, Kleinasien, Syrien, die Kyrenaika und das Nildelta in Ägypten. Sowohl im ereignisgeschichtlichen Teil als auch in der Darstellung der politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Entwicklungen habe ich mich aber auch bemüht, die Griechen im Westen (Sizilien und Unteritalien), die griechischen Städte an der West- und Nordküste des Schwarzen Meeres sowie die Griechen in Zentralasien – in Afghanistan, Pakistan und Nordindien – mit einzubeziehen.
Die verbindenden Elemente im „langen hellenistischen Zeitalter“, die dieses auch von vorhergehenden Epochen unterscheiden, sind: die Bedeutsamkeit monarchischer Herrschaftsformen; die starke imperialistische Tendenz als Kennzeichen der Politik sowohl hellenistischer Könige als auch des römischen Senats; die enge Verflechtung politischer Entwicklungen im Balkanraum, in Italien, der Schwarzmeerregion, Kleinasien, im Nahen Osten und in Ägypten; die erhöhte Mobilität der Bevölkerung in diesen Gebieten; die Verbreitung städtischer Lebensformen und Kultur; technologische Fortschritte; und die allmähliche Homogenisierung von Sprache, Kultur, Religion und Institutionen. Die meisten der eben genannten Phänomene hatte es vor Alexanders Kriegszügen nicht in einem vergleichbaren Ausmaß gegeben. Die Epoche kann tatsächlich als das kosmopolitische Zeitalter der Griechen bezeichnet werden, denn kein Zeitraum vorher kam ihr darin gleich.
Viele der Phänomene, die sich im „langen hellenistischen Zeitalter“ beobachten lassen, finden eine Entsprechung in der modernen Welt, und unter anderem diese „Modernität“ macht die Epoche so attraktiv. Auf vier dieser Phänomene will ich kurz eingehen: Globalisierung, Megacities, neue Religionen und Regierungsgewalt.
Aufgrund der Vernetzung großer Teile Europas, Asiens und Nordafrikas sieht man die hellenistische Welt und das Römische Reich zu Recht als frühe Beispiele von „Globalisierung“ an. Der moderne Begriff Globalisierung kann hier eigentlich nur in Anführungszeichen verwendet werden. Denn erstens umfassten die hellenistischen und römischen Netzwerke nicht den gesamten Globus, sondern nur den Bereich, der als oikoumene (bewohnte Welt) galt, und zweitens stellten sich die meisten Menschen damals die bewohnte Welt nicht als Kugel, sondern als eine vom Ozean umgebene Scheibe vor. Die Reichweite der Vernetzung innerhalb der den Griechen und Römern bekannten Gebiete ist nichtsdestotrotz beeindruckend. Mit seinen Eroberungen errichtete Alexander kein dauerndes Weltreich, er schuf jedoch die Voraussetzungen für ein gewaltiges politisches Netzwerk aus Königreichen, halb unabhängigen Dynasten und poleis (Stadtstaaten), das sich von der Adria bis nach Afghanistan und von der Ukraine bis nach Äthiopien erstreckte. Diese Staaten unterhielten Verbindungen nach Italien, zu den griechischen Kolonien in Südfrankreich, zu Karthago in Nordafrika und zum Mauryareich in Indien und bildeten so ein Netzwerk, das die gesamte bekannte Welt, mit Ausnahme von China, umfasste. Die römische Expansion brachte eine Erweiterung dieser vernetzten Welt, indem sie ihr Zentral- und Westeuropa sowie große Teile Nordafrikas hinzufügte. Polybios, ein Staatsmann und Historiker, der die Frühphase der römischen Expansion analysierte, war sich dieser Vernetzung innerhalb des gesamten Mittelmeerraums bereits in der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. in vollem Umfang bewusst; er prägte dafür den Begriff symploke (Verflechtung; s. S. 176).
Wie sich diese Veränderung auf das Leben der Menschen und auf die Institutionen und Kulturen sehr unterschiedlicher Gemeinwesen auswirkte, ist eine spannende Frage. Oberflächlich betrachtet lässt sich in verschiedenen Lebensbereichen eine stärkere Vereinheitlichung feststellen. Griechisch wurde zur Lingua franca in den hellenistischen Königreichen Asiens und Afrikas und später in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches; auch in Italien und den westlichen Provinzen wurde es häufig verwendet, vor allem von Intellektuellen und Einwanderern aus dem Osten. Griechische und römische Rechtsinstitutionen drangen bis in entlegenste Gebiete vor. Die meisten Aspekte des kulturellen Lebens wiesen eine bemerkenswerte Konformität auf und folgten den Trends in den größeren politischen und kulturellen Zentren: vom Erscheinungsbild der Städte selbst bis hin zur Mode, bei Männern der Gesichtsbehaarung, bei Frauen den Frisuren, vom Stil der Kunstwerke bis hin zur Form der Lampen, die man bei nächtlichen Aktivitäten als Lichtquellen nutzte, von der Rhetorik bis zu den verschiedenen Formen der Unterhaltungskultur.
Diese Prozesse kultureller Konvergenz für die hellenistische Zeit als „Hellenisierung“ und für die Kaiserzeit als „Romanisierung“ zu bezeichnen, wie dies oft getan wurde, wäre irreführend. Beide Begriffe implizieren eine einseitige Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie – die Entwicklung Einleitung einer kulturellen koine (einer gemeinsamen Ausdrucksform) im „langen hellenistischen Zeitalter“ war aber das Ergebnis längerer und weitaus komplexerer Prozesse. Ihre Protagonisten waren nicht nur Personen mit politischer Autorität, sondern auch reisende Künstler, Redner und Dichter, Soldaten und Sklaven sowie Magier und Traumdeuter, die sich über Grenzen hinwegbewegten. Es war also die erhöhte Mobilität in den multiethnischen Königreichen und im Römischen Reich, die eine solche kulturelle Konvergenz brachte; sie führte auch dazu, dass verschiedene religiöse Vorstellungen verschmolzen, was als „Synkretismus“ bezeichnet wird. Wenn ich in diesem Buch die Begriffe „Hellenisierung“ und „hellenisiert“ verwende, beziehe ich mich auf die Übernahme der griechischen Sprache und Schrift durch nicht-griechische Bevölkerungsgruppen, im vollen Bewusstsein, dass lokale Bräuche und spezifische Identitäten unter der Oberfläche einer gemeinsamen Sprache fortbestehen konnten. Zwei- und dreisprachige Inschriften auf Griechisch und Latein, Griechisch und Ägyptisch, Griechisch und Hebräisch, Latein und Aramäisch usw. sind sichtbarer Ausdruck dieser unverwüstlichen kulturellen Komplexität. Der dynamische Austausch zwischen Griechen, einheimischen Bevölkerungsgruppen in Asien und Ägypten und später Einwanderern aus Italien hatte zur Folge, dass sich die Kultur kontinuierlich wandelte. Am deutlichsten erkennt man nicht-griechische Elemente bei religiösen Praktiken und Personennamen; sie lebten jedoch mit Sicherheit auch in vielen anderen Bereichen fort, wie in der Mythologie, im kollektiven Gedächtnis und in Jenseitsvorstellungen, gesellschaftlichen Konventionen, Begräbnispraktiken, in der Kleidung, Essenszubereitung oder in landwirtschaftlichen Methoden.
Multikulturalismus war naturgemäß eher ein Merkmal der Megacities dieser Zeit. Städte wie Alexandria, Antiochia, Athen, Ephesos, Thessalonike, Korinth und Pergamon, mit Einwohnerzahlen zwischen 100.000 und einer Million, lassen sich nicht mit modernen Megacities von zehn Millionen Einwohnern oder mehr vergleichen. Dennoch: Ihren Zeitgenossen erschienen sie als überdimensional. Im frühen 3. Jahrhundert v. Chr. beschrieb der Dichter Theokrit die Reaktionen zweier aus Syrakus nach Alexandria eingewanderter Frauen, als sie während eines Festes durch eine stark bevölkerte Straße gehen: „Himmel, was für eine Menschenmenge! Wie und wann sollen wir da jemals durchkommen? Sie sind wie Ameisen – zahllos und unzählbar.“ Die Einwohner großer Städte mit einer heterogenen Bevölkerung, wie Alexandria, sahen sich mit vielen Problemen konfrontiert, die auch uns nicht unbekannt sind, wie etwa: Gefahren für die Sicherheit, Spannungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Anonymität, das Gefühl von Verlorenheit, der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit. Je mehr die Möglichkeiten des Einzelnen zur politischen Teilhabe in seiner Gemeinschaft eingeschränkt wurden, desto stärker wurde das Bedürfnis, diesen Verlust durch die Teilnahme an einer anderen Form von Gemeinschaft auszugleichen – sei diese religiöser, beruflicher oder anderer Natur.
Einigen dieser Bedürfnisse begegneten, wie auch heute, „neue Religionen“; sie verhießen Geborgenheit zu Lebzeiten und Glückseligkeit nach dem Tod. Exotische Kulte wurden importiert und einer griechischen Umgebung angepasst. Die Anhänger organisierten sich in freiwilligen Kultvereinen; diese waren einerseits exklusiv, insofern sie eine Initiation erforderten, andererseits inklusiv, da sie in der Regel jedem offenstanden, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und gesellschaftlichem Status. Solche Vereinigungen – religiöse oder auch andere – gaben ihren Mitgliedern ein Gefühl von Zugehörigkeit.
Auch wenn die Königreiche und großen Städtebünde übergeordnet waren, blieb doch die polis der Hauptschauplatz politischen, gesellschaftlichen und religiösen Lebens. In keiner anderen Epoche der griechischen Geschichte, nicht einmal im Zeitalter der großen Kolonisation vom 8. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr., wurden so viele neue Städte gegründet wie im späten 4. und im 3. Jahrhundert v. Chr. Alte und neue poleis, und später die römischen Kolonien, die vom späten 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum frühen 2. Jahrhundert n. Chr. in Griechenland, Kleinasien und im Nahen Osten gegründet wurden, besaßen alle ein gewisses Maß an Souveränität und beträchtliche Selbstverwaltungskompetenzen. Doch dieser Eigenständigkeit wurden auch Grenzen gesetzt, zunächst durch die Könige, nach 146 v. Chr. durch die Einrichtung einer römischen Provinzverwaltung und später durch die alles überschattende Präsenz des römischen Kaisers. In den Städten gab es zwar weiterhin Institutionen, die eine bürgerliche Beteiligung an Entscheidungsprozessen ermöglichten, wie beispielsweise die Volksversammlung, aber sie waren in zunehmendem Maß auf Zuwendungen vonseiten begüterter Wohltäter angewiesen. Zusammen mit den direkten Eingriffen der Könige und römischen Autoritäten zugunsten oligarchischer Institutionen veränderte dies die Städte schrittweise von gemäßigten Demokratien zu Oligarchien. Mussten wohlhabende Männer zunächst noch ihre Macht mit der Bürgerschaft verhandeln, mit den ihnen Gleichrangigen um Ämter konkurrieren und für ihr Tun Rechenschaft ablegen, hingen nun politische Rechte und Macht von den Vermögensverhältnissen ab. Dieser Gegensatz zwischen nomineller Volkssouveränität und -teilhabe und wirklicher Macht, auch heutigen Demokratien nicht fremd, führte dazu, dass sich die Angehörigen der Elite, aber auch die Könige, theatrale Verhaltensweisen aneigneten, um inszeniert volksnah und zugleich angemessen distanziert zu wirken – ein Verhaltensmuster, das dem heutigen Populismus nicht unähnlich ist. Verschuldete, Enteignete, Unterprivilegierte und Diskriminierte probten gelegentlich den Aufstand, vermochten es aber nicht, Reformen herbeizuführen. Solange die „Honoratioren“ willens waren, einen Teil ihres Vermögens für die heutzutage als „öffentliche Ausgaben“ bezeichneten Aufwendungen zur Verfügung zu stellen, wurde ihre Herrschaft nicht hinterfragt. Den gesellschaftlichen Verhältnissen des „langen hellenistischen Zeitalters“ lagen komplexe Formen der Reziprozität zugrunde.
Den heutigen Leser werden so augenscheinlich aktuelle Aspekte der in diesem Buch besprochenen historischen Epoche zweifelsohne verblüffen. Der antike Leser würde sich für zwei andere Dinge begeistern, die in der hellenistischen Epoche und der Kaiserzeit zuhauf belegt sind: peripeteiai (plötzliche Schicksalswendungen) und paradoxa (unvorhergesehene Ereignisse). Das „lange hellenistische Zeitalter“ konfrontiert uns mit Gegensätzen und Widersprüchen: Fortbestehen von Traditionen versus technologische Revolutionen – zum Beispiel wurde der Mechanismus von Antikythera in dieser Zeit entwickelt, eine komplexe Apparatur, die Erscheinungen der Himmelskörper und Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte; Rationalität versus Aberglaube, Monarchie versus Volksteilhabe, die kleine Welt der polis versus die große Welt der Königreiche und des Römischen Reiches, das Lokale versus das Globale. Dies war auch der kulturelle Kontext, in dem das Christentum sich entwickelte. Dieses Zeitalter bietet Denkanstöße für wachsame Beobachter von heute. Alles in allem hoffentlich Grund genug, um in die Seiten dieses Buches einzutauchen.