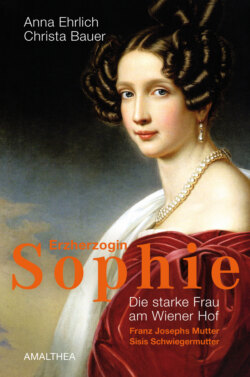Читать книгу Erzherzogin Sophie - Anna Ehrlich - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Herzog ohne Land zum
König von Napoleons Gnaden
ОглавлениеBei der Geburt von Sophies Vater Max war nicht vorauszusehen gewesen, dass er einmal über Bayern regieren würde, stammte er doch aus einer Pfälzischen Seitenlinie der Wittelsbacher. Sein Vater Friedrich Michael von Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler (1724–1767) kommandierte wie schon seine Vorfahren ein französisches Regiment, trat aber im Siebenjährigen Krieg in österreichische Dienste und konvertierte deshalb zum Katholizismus. Seine Mutter, die Wittelsbacherin Maria Franziska Dorothea von Pfalz-Sulzbach (1724–1794), wurde ab 1760 wegen einer leidenschaftlichen Liebesaffäre mit einem Schauspieler in Klosterhaft gehalten. Max’ Erziehung lag genau wie die seines älteren Bruders Karl August (1746–1795) in den Händen seines Onkels und Vormunds, Christian IV. von Birkenfeld und Zweibrücken (1722–1775), der seinen Neffen für die militärische Laufbahn bestimmte. Seine Lehrer bezeichneten Max als »reichbegabt und fähig«, es entwickelten sich sein »Geist und Körper gleichmäßig, ohne Schulzwang und Überfülle von Kenntnissen, mit welchen man Prinzen häufig betäubt und oftmals alles richtige Gefühl in ihnen erstickt«.
König Maximilian I. Joseph
Max wird als schöner Jüngling beschrieben, man bescheinigte ihm ein freundliches und gütiges Wesen sowie Großzügigkeit, er galt als einfach und ehrlich und besaß gesunden Menschenverstand. Völlig undiplomatisch sagte er stets offen und manchmal mit recht derben Worten genau das, was er dachte. Mit seiner Entscheidungsfähigkeit stand es allerdings nicht zum Besten, dafür verfügte er über die Gabe, fähige Ratgeber um sich zu scharen.
Max’ Lehrer, der französische Offizier Agathon de Guynement Chevalier de Keralio (1723–1788), prägte ihm ein: »Vergessen Sie nie, dass Sie die große Hoffnung eines illustren Hauses sind.«1 Er war seinem Schüler nicht nur Lehrer, sondern auch väterlicher Freund und legte mehr Wert auf die Charakterbildung des jungen Prinzen als auf das Erlernen höfischer Umgangsformen. »In Gesellschaft hat er besser abgeschnitten, als erwartet; denn ich lehrte ihn wenig oder richtiger gesagt gar nichts, was man Höflichkeit nennt aus Besorgnis, ihn falsch zu machen«2, berichtete er einer Tante seines Schülers erfreut. Falschheit war tatsächlich das Letzte, was man Max nachsagen konnte.
1770 trat Max in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm das Elsässer Regiment, das unter französischem Befehl stand. Er lebte meist in Straßburg und führte das typische Leben eines adeligen jungen Offiziers. Besonders heiratswillig war er nicht, obwohl sein Vormund Herzog Christian schon eine Braut für ihn zu suchen begonnen hatte, als er gerade einmal 16 Jahre alt war. Erst 1785, mit fast 30 Jahren, war er unter Druck bereit, die protestantische Prinzessin Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt (1765–1796) zu ehelichen. Entgegen den herrschenden Sitten musste sie nicht konvertieren, sich jedoch verpflichten, die gemeinsamen Kinder im katholischen Glauben zu erziehen.
1795 starb sein älterer Bruder Karl August, und Max folgte ihm als Herzog von Zweibrücken nach. Noch im selben Jahr wurden seine Herrschaftsgebiete während der Koalitionskriege von Frankreich besetzt. Max floh mit seiner Familie zuerst ins Schloss Rohrbach bei Heidelberg. Dort starb 1796 Auguste Wilhelmine, die ihm vier kleine Kinder hinterließ. Die Flucht ging weiter nach Mannheim und, als es auch dort zu Kämpfen kam, nach Ansbach in Preußen. Max war nun ein Herzog ohne Land.
Inzwischen hatte sich auch Erbprinz Karl Ludwig von Baden (1755–1801) mit seiner Familie nach Ansbach geflüchtet. Seine Frau Amalie von Hessen-Darmstadt (1754–1832) war eine Cousine von Max. Das Paar hatte sieben Kinder, einen Sohn und sechs Töchter. Die ältesten Töchter Karoline Friederike Wilhelmine (1776–1841) und Amalie Christiane (1776–1823) waren Zwillinge, beide sehr hübsch und selbstbewusst – vor allem Karoline. Als der bereits 40-jährige Witwer Max das nur halb so alte Mädchen sah, verliebte er sich Hals über Kopf: »Ich bin ein amoureux fou – es ist lächerlich in meinem Alter, aber ich kann es nicht ändern!«3
Königin Karoline
Karoline war weniger begeistert. Sie fand den Freier zu alt, stimmte aber unter dem Einfluss ihrer Mutter der Heirat schließlich zu. Wie schon seine erste Frau musste sich die ebenfalls protestantische Karoline bereit erklären, die gemeinsamen Kinder im katholischen Glauben zu erziehen. Dafür wurde ihr zugesichert, dass sie »als künftige Gemahlin allezeit die vollkommenste Gewissensfreiheit genießen und solche zu keiner Zeit an keinem Ort und unter keinerlei Umständen in der Übung der protestantischen Religion eingeschränkt und verhindert werden.«4 Die Trauung erfolgte am 1. März 1797 in Karlsruhe, und die 20-jährige Karoline war nun die Stiefmutter von zwei Mädchen und zwei Knaben. Max’ ältester Sohn Ludwig war nur zehn Jahre jünger als sie. Im Oktober 1797 ließ sich die Familie in Mannheim nieder.
Wenige Monate später reisten Karoline und Max nach München zu Kurfürst Karl Theodor (1724–1799). Max war dessen nächster Verwandter und stand somit als Nachfolger bereits fest. Karl Theodor hatte keinen legitimen Sohn, und trotz der Heirat des Siebzigjährigen mit der 18-jährigen Maria Leopoldine von Österreich-Este (1776–1848) war auch kein Nachwuchs mehr zu erwarten. Als der Kurfürst am 16. Februar 1799 starb, sah es dennoch kurz so aus, als ob Max leer ausgehen sollte: Maria Leopoldine war schwanger. Zu seinem Glück gab sie jedoch mit schockierender Offenheit zu, dass keineswegs ihr Gatte der Urheber dieses Zustands war. Somit war der Weg frei, und Max wurde Kurfürst. Das Volk begrüßte den neuen Herrscher begeistert, es erwartete sich von ihm Reformen, Religionsfreiheit und ein Ende der absolutistischen Regierungsform. Ein Bürger reichte ihm beim Einzug die Hand in den Wagen: »Nun Max, dass du nur da bist!«
Max wurde den Erwartungen durchaus gerecht, er führte gemeinsam mit seinem Berater Maximilian de Montgelas (1759–1838) zahlreiche innenpolitische Reformen durch und erließ 1808 und 1818 Verfassungen im Sinne der Aufklärung, womit Bayern sich zu einem modernen Staat entwickeln konnte. Karoline war ihrem Gatten eine tatkräftige Ratgeberin und außerdem karitativ tätig, kein Notleidender wurde abgewiesen. Im Volksmund dichtete man: »Geht dir die Not bis obenhin, so gehst du zu der Karolin«.
Beim Einzug in München war Karoline schwanger, ihr Sohn wurde aber tot geboren. Ein weiterer Sohn starb noch im Kleinkindalter, erst ihre Töchter, darunter zwei Zwillingspärchen, erwiesen sich als lebensfähig: Elisabeth und Amalie wurden 1801 geboren, Maria Anna Leopoldine und Sophie 1805 – der stolze Vater fand die Geburt »rühmlich« und die »Folge eines braven und geregelten Lebens«. Ludovika folgte 1808 und Maximiliane 1810. Das Ehepaar war in München somit von einer zehnköpfigen Kinderschar umgeben.
Während der Koalitionskriege näherte sich Max an Frankreich an. Es bestand die Gefahr, dass Bayern im Dritten Koalitionskrieg zwischen Österreich und Frankreich aufgerieben würde. Doch Frankreichs Kaiser Napoleon (1769–1821) garantierte nicht nur den Erhalt Bayerns, er sagte Max außerdem neue Gebiete im Falle eines erfolgreichen Kriegsverlaufs zu. Nach Österreichs Niederlage konnte Max Bayerns Grenzen daher nicht nur halten, sondern sie zur Belohnung sogar erweitern. Außerdem erhob Napoleon Max in den Rang eines Königs, womit alte Wittelsbacher’sche Träume endlich Wirklichkeit geworden waren, wenn auch auf ungeahnte Art. Die Zeremonie fand am 1. Jänner 1806 in der Münchener Residenz statt. Eine öffentliche Krönung oder Salbung gab es wohl aus Rücksicht auf gewisse antifranzösische Ressentiments im Volk nicht, außerdem fehlte eine Königskrone. München war nun eine königliche Haupt- und Residenzstadt und alle Prinzen und Prinzessinnen des bayrischen Königshauses durften den Titel Königliche Hoheit führen, somit auch die damals erst einjährige Sophie. Max, bescheiden wie immer, blieb davon unbeeindruckt: »Wir bleiben dieselben«, soll er gesagt haben.
Im Ausland nahm man die Rangerhöhung Bayerns sehr zurückhaltend zur Kenntnis. Man empfand die neuen, »von Napoleon gebackenen« Könige als nicht ebenbürtig. In Wien dauerte es einen Monat, bis die Wiener Zeitung überhaupt davon berichtete.
Max hatte die Königswürde natürlich nicht umsonst bekommen: Bayern musste Napoleon Truppen zur Verfügung stellen, und es gab eine aufgezwungene Hochzeit.