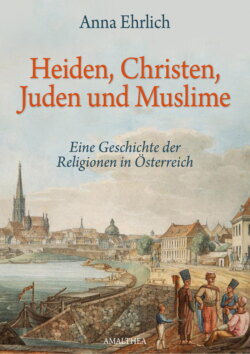Читать книгу Heiden, Christen, Juden und Muslime - Anna Ehrlich - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Sieg des Christentums
ОглавлениеNur elf Jahr nach Florians Tod wurde das Mailänder Toleranzedikt im Jahre 313 von Kaiser Konstantin (272–337) erlassen, und die Zeit der Verfolgungen war vorbei. Die Missionierung der einheimischen, keltisch-römischen Mischbevölkerung erfolgte zuerst von Italien, vor allem von Aquileia, aus. Diözesen wurden gemäß der römischen Verwaltungsstruktur aufgebaut, Aguntum (bei Lienz), Lauriacum (Lorch), Teurnia (bei Spittal an der Drau) und Virunum (bei Klagenfurt) wurden zu Bischofssitzen. Weitere werden in Carnuntum (bei Petronell), Iuvavum (Salzburg), Ovilava (Wels) und Vindobona (Wien) mit einer bischöflichen Fliehburg in Klosterneuburg vermutet. Für die Existenz eines Bischofssitzes spricht, wenn an einem Ort Kirchenfamilien, je zwei Kirchen und ein Taufhaus, gefunden werden. Falsch ist sicher die Annahme, die gesamte Bevölkerung wäre innerhalb kürzester Zeit nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum durchgehend christlich geworden.
Unter Kaiser Theodosius I. (347–396) wurde das Christentum nach seinem »wundersamen« Sieg am Frigidus (dem Fluss Vipava im heutigen Slowenien) zur einzig erlaubten Religion. Waren die Christen zuerst der Meinung gewesen, an den mit Sünde behafteten Geschäften des Staates nicht teilnehmen zu können, so herrschte seit Augustinus ein anderes Verständnis: Der Staat, der als Machtinstitution eigentlich aus teuflischem Herrschaftsbereich stammt, kann, wenn er der Kirche dienstbar wird und ihren Forderungen nachkommt, einen höheren sittlichen Wert erlangen. Zum Garanten der kirchlichen Wahrheit wurde das apostolische Amt des Bischofs, also die ununterbrochene Amtsübertragung von einem Bischof zum anderen (apostolische Sukzession). Die katholische Priesterkirche galt als Vermittlerin zwischen Gott und den Menschen, sie wurde zur Heilsanstalt. Den unmündigen Laien (Laos = Volk) stand der berufsmäßige Klerus (Kleros = Erbteil, Gott als Erbteil der Priester) gegenüber. Die Kirchenhierarchie bildete sich aus, die Stufen waren die Ämter der Patriarchen, Bischöfe, Presbyter, Diakone, Subdiakone, Lektoren und Türsteher. Bald begannen die Kirche, ihre Macht zu zeigen und Forderungen zu stellen. Eine davon war die Verfolgung Andersgläubiger, der Heiden und der Häretiker.
Nach einem Gesetz Kaiser Theodosius’ I. von 391 waren alle heidnischen Tempel zu schließen, und sein Sohn, Kaiser Flavius Honorius (384–423), ordnete im Jahre 408 an: »Wenn irgendwelche Bildnisse noch in Tempeln oder Schreinen stehen, und wenn sie heute oder jemals zuvor Verehrung von Heiden irgendwo erhielten, so sollen sie herunter gerissen werden.« Die Zerstörung der heidnischen Kultstätten im Namen des christlichen Gottes erfolgte mit großer Begeisterung. Der Heide Libanios schildert schon um das Jahr 380 in seinem Brief an Kaiser Theodosius I. die extreme Zerstörungswut von »Banden schwarz gekleideter Mönche«. Von den heidnischen Blutzeugen, die für die alten Götter starben, berichtet die christliche Überlieferung natürlich nichts. Auch ein Großteil der Mithräen wurde zerstört, der Rest verfiel unbeachtet. Die ersten Irrgläubigen, die blutig verfolgt wurden, waren die halbchristlichen Manichäer, zu denen der Kirchenvater Augustinus vor seiner Taufe durch Ambrosius gehört hatte, und die Donatisten. Letztere behaupteten, die Gültigkeit der Sakramente hinge von der Würdigkeit des Spenders ab.
Der Dom von Aquileia
Die Gnostiker vertraten den Dualismus: Die Welt und jede Materie sei das Werk des Demiurgen (δηµιουργóς = Handwerker, für Marcion war auch das Alte Testament dessen Werk) und nicht eine Schöpfung Gottes. Christus hingegen verkünde in seiner menschlichen Erscheinung den unbekannten Gott, mit ihm beginne die Erlösung. Für die Gnostiker gab es drei Arten von Menschen, diejenigen, die ganz aus Materie bestünden; dann diejenigen, die aus Materie und Geist bestünden und wenigstens in der Lage wären, geoffenbarte Wahrheiten aufzunehmen; und schließlich die Gnostiker selbst, die Wissenden, die der Offenbarung gar nicht bedürften, da sie ganz vom göttlichen Geist durchformt wären. Das Gedankengut all dieser von der Kirche abgelehnten Lehren überlebte, wurde von den Bogomilen übernommen und findet sich bei den Ketzerbewegungen des Mittelalters, den Katharern, Waldensern und Hussiten, in der Neuzeit und sogar bei modernen Religionsgemeinschaften wieder.
Parallel zur fortschreitenden Christianisierung verfiel nun auch im Oströmischen Reich die römische Militärmacht. Zuerst übernahmen einzelne Germanen hohe militärische und politische Funktionen, dann wurden ganze Völker innerhalb der Reichsgrenzen angesiedelt, und weitere drängten nach. Eines dieser Völker waren die Goten. Im Jahre 341 wurde der Gote Wulfila (311–383) in Antiochia vom arianischen Reichsbischof von Konstantinopel, Eusebios von Nikomedia, zum »Bischof der Christen im gotischen Land« geweiht, die nächsten Jahre verbrachte er als Missionar bei den Westgoten an der unteren Donau und stieß dabei auf Widerstand seitens der Oberschicht. Mit etlichen Anhängern floh er zu den Römern, die Gruppe wurde unter kaiserlichem Schutz bei Nikopolis angesiedelt. Dort übersetzte er die Bibel3 ins Gotische, wofür er eine eigene Schrift erfand. Er legte damit den Grundstein zur Christianisierung der Goten und der anderen Ostgermanenstämme. Sie brachten während der Völkerwanderung den Arianismus in unser Gebiet, in Pannonien scheint er die vorherrschende Religion geworden zu sein. Auch in Norikum finden sich mancherorts Reste von Kirchen nebeneinander, von denen eine für die Arianer und eine für die Katholiken bestimmt war. Vermutlich benutzten sie aber oft auch eine Kirche gemeinsam.
Der Arianismus verursachte die erste große Kirchenspaltung4. Der heftige Streit zwischen Arianern und Trinitariern, der bereits unter Kaiser Konstantin ausgebrochen war, erfasste das ganze Reich, die kaiserliche Familie und alle Untertanen in Ost und West. Es ging dabei in erster Linie um die grundlegende Frage nach der wahren Natur von Jesus und ob er Teil der Dreieinigkeit oder Teil der Schöpfung sei; also um die Frage, ob der historische Jesus Gott, gottgleich, von Gott adoptiert oder ein erleuchteter Mensch gewesen sei. Die Auseinandersetzung wurde – nach etlichen Konzilien – im Jahre 381 auf dem 1. Konzil von Konstantinopel im Sinne der Trinitarier beigelegt: Jesus war Teil der Dreieinigkeit, Arius († 336), der dies geleugnet hatte, war daher ein Häretiker. Bischof Ambrosius von Mailand († 397), der zu den Kirchenvätern zählt, war einer seiner schärfsten Gegner. Der Arianismus hatte noch bis ins 7. Jahrhundert5 hinein Anhänger, vor allem Ostgermanen, die ja zur Zeit seiner Vorherrschaft zum Christentum übergetreten waren. Es ist aber durchaus möglich, dass ihre Bräuche in entlegenen Gebieten des Tolosanischen und Toledanischen Reiches nie ganz vergessen wurden und ebenfalls in die großen Ketzerbewegungen mündeten.
Die Arianer lasen die Bibel in ihrer Volkssprache und feierten ein Brudermahl nach urchristlichem Vorbild, sie verehrten weder Heilige noch Reliquien, es gab keinen Mutter-Gottes-Kult, keine Ohrenbeichte, keine Kindertaufe. Ihre Priester und Bischöfe gingen einem Beruf nach und waren verheiratet, und es gab zwar Klöster, jedoch mit Mönchen und Nonnen auf Zeit. In Glaubensdingen waren sie tolerant, sie machten keine Versuche, die römisch-katholische Bevölkerung in den eroberten Gebieten mit Gewalt zu ihrem Glauben zu bekehren. »Religion kann man nicht anbefehlen«, befand der in Italien regierende Ostgotenkönig Theoderich (454–526). In den Unterschieden zwischen katholischem und arianischem Christentum liegt der Grund, weshalb sich die arianischen Germanen bei uns nicht mit der keltisch-römischen, trinitarisch gesinnten Bevölkerung vermischten. Im heutigen Frankreich lagen die Dinge anders, da die Franken die katholische Religion annahmen.