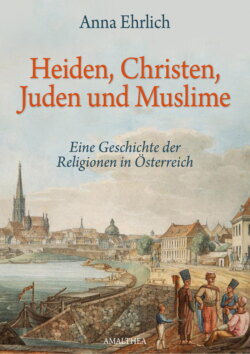Читать книгу Heiden, Christen, Juden und Muslime - Anna Ehrlich - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die religionsgeschichtliche Rolle der Franken
ОглавлениеNach der erfolgten Reichsteilung von 395 gingen Ost- und Westteil des römischen Imperiums verschiedene Wege. Die Beziehungen von Staat und Kirche entwickelten sich sehr unterschiedlich. Im Osten entstand eine Einheit von Staat und Kirche unter dem Kaiser als dem Träger des höchsten Amtes (Cäsaropapismus). Die Kaiserwürde war ein heiliges Amt, verbunden mit kirchlicher Regierungsgewalt, und galt als oberste kirchliche Gerichtsinstanz. Die Kirche war zu einer staatlichen Rechtsinstitution geworden und Häresie galt daher als Staatsverbrechen.
Im Westen gab es hingegen seit dem Zerfall des Römischen Reiches keine eigentliche staatliche oder politische Autorität mehr. Der oströmische Kaiser gab allerdings seinen Anspruch auf Italien noch lange nicht auf, obwohl er ihn meist nicht durchsetzen konnte. An seiner Stelle wurde der Bischof der Ewigen Stadt Rom, an deren Bedeutung als »Nabel der Welt« sich die Völker jahrhundertelang gewöhnt hatten, allmählich zur ersten Autorität, ähnlich einem geheimen weströmischen Kaiser. Papst Gelasius I. († 496) sah Staat und Kirche zwar als zwei gleichberechtigte Gewalten, jede auf ihrem Gebiet Gott verantwortlich. Doch meinte er, dass der Papst vor Gott auch für die Könige verantwortlich, ja ihnen als Spender der Sakramente sogar überlegen sei. Um diesen Anspruch durchsetzen zu können, brauchte er daher machtvolle Unterstützung gegen byzantinische und gotische Forderungen.
Er fand sie bei den Franken, denn der Merowinger Chlodwig benötigte nach der siegreichen Schlacht von Soissons im Jahre 486 dringend die Anerkennung durch seine neuen römisch-katholischen Untertanen und die Vergebung für seine vergangenen und zukünftigen Gräueltaten. Man ging also ein Zweckbündnis ein: Die Franken nahmen das römisch-katholische Christentum an und stärkten dem Papst gegen Arianer und Byzantiner den Rücken, dieser motivierte seinerseits die wohlhabende, römisch-katholische Geistlichkeit in Gallien, den neuen Herrscher Chlodwig und seine Nachfolger zu stützen. Das heilige Salböl für Chlodwigs Taufe brachte eine Taube direkt vom Himmel (eine Phiole davon existierte bis zur Revolution in Reims). Der Papst sollte weiterhin eine wichtige Rolle bei den Franken spielen, unter anderem bei der Übertragung der Königswürde von den Merowingern auf die karolingischen Hausmeier. Dafür stand bei sämtlichen Kriegszügen der fränkischen Könige neben der Unterwerfung der Völker deren mehr oder weniger (Sachsen!) friedliche Bekehrung zur römisch-katholischen Kirche im Vordergrund, war sie doch ein Garant für die völlige Machtkontrolle in den eroberten Gebieten, zu denen bald auch der Donauraum gehören sollte. Auf die Arianer nahm man dabei keine Rücksicht, ihre Kirchen wurden enteignet, ihre Bischöfe und Anführer vertrieben oder umgebracht.
Im 6. Jahrhundert bildete sich westlich der Enns aus Nachkommen der Markomannen und anderer Stämme ein neuer Volksstamm, die damals noch meist heidnischen Bajuwaren, die aber bald von den Franken abhängig und christianisiert wurden. Von Osten her waren die arianischen Langobarden in den Donauraum vorgedrungen, und hinter ihnen erschienen die Awaren mit ihren slawischen Gefolgsleuten. Selbst wenn in entlegenen Gebieten romanische Siedlungen bestehen blieben, verschwanden im Ansturm der Reitervölker doch die meisten christlichen Spuren. Es gibt aber eine Nachricht von »clerici illiterati«, schriftunkundigen Geistlichen, aus dem Jahre 797, die auch Arianer gewesen sein könnten. Möglicherweise wurde christliches Gedankengut nach 488 durch dreihundert Jahre mündlich weitergegeben, was bei der religiösen Toleranz der Awaren zumindest denkbar wäre. Mit der starken awarischen Macht im Hintergrund besiedelten die Slawen Kärnten, Steiermark und Niederösterreich. Die Grenze zwischen Ost und West, zwischen Heiden- und Christentum, verlief also quer durch Österreich, die Enns wurde zum Grenzfluss.